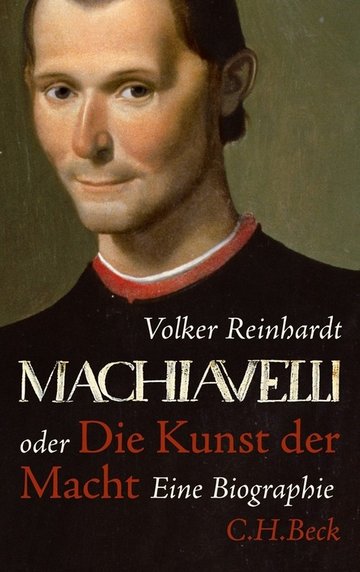PROLOG: «EIN DURCH UND DURCH SCHÄDLICHER MENSCH»
Der Provokateur
Ich sage Euch, dass Ihr ein durch und durch schädlicher Mensch seid und dass ich Euch nicht in meinem Haus haben möchte … Von Grund auf destruktiv seid Ihr, im Wesen schwärzer als Kohle.[1]
So urteilte Filippo de’ Nerli, der päpstliche Gouverneur von Modena, über seinen florentinischen Mitbürger Niccolò Machiavelli in einem an diesen gerichteten Brief vom 1. November 1526. Woher rührte dieser Zorn? Vier Tage später berichtete der so Beschimpfte an einen anderen hohen Würdenträger, Francesco Guicciardini, den Statthalter Papst Clemens’ VII. in der Romagna:
Kaum kam ich nach Modena, da traf ich schon Filippo de’ Nerli, der mich zur Rede stellte: Ist es wirklich möglich, dass ich nichts Sinnvolles getan haben soll? Ich entgegnete ihm daraufhin lachend: Herr Gouverneur, so ist es, doch wundern Sie sich nicht darüber – es ist auch nicht Ihre Schuld. Die Verhältnisse dieses Jahres sind nun einmal so, dass niemand auch nur ansatzweise etwas richtig gemacht hat – im Gegenteil.[2]
Die Zeiten waren äußerst angespannt. Ein kaiserliches Heer aus zerlumpten, halb verhungerten spanischen und deutschen Söldnern war in Norditalien eingefallen und drohte demnächst gegen Florenz und Rom zu ziehen. Kein Wunder, dass bei den Mächtigen die Nerven blank lagen. Dann kam zu allem Überfluss Niccolò Machiavelli als Abgesandter einer florentinischen Behörde, die keinerlei Macht und noch weniger Geld hatte, und sagte den hohen Herren ins Gesicht, dass sie von den Problemen der Zeit kaum etwas verstanden und noch weniger richtig gemacht hatten. Damit es ordentlich weht tat, kleidete dieser zweitklassige Diplomat seine vernichtende Kritik auch noch in ätzende Ironie ein. Für diese Art von beißendem Humor auf Kosten der anderen war Machiavelli bekannt und berüchtigt.
In ruhigeren Zeiten hatte man ihn als Verfasser ebenso witziger wie unmoralischer und zudem latent politischer Komödien durchaus schätzen gelernt. Eines seiner Lustspiele war sogar im Oktober 1525 zur Unterhaltung der gestressten Herrschaften in Modena aufgeführt worden. Es handelte von einem Ehebruch, der am Ende alle glücklich machte, nicht zuletzt den gehörnten Ehemann selbst. Um diese Operation zum Erfolg zu führen, hatte sich ein regelrechtes Komplott gebildet, doch hatten alle Verschwörer durchgehend ein reines Gewissen. Darüber konnten die Politiker und Generäle herzlich lachen, das war beste Truppenbetreuung im Stil der Renaissance. Dass der Autor dieses Loblieds auf den Betrug sie selbst jetzt als politische Irrläufer verspottete, fanden sie hingegen nicht mehr komisch. Hier wurde keine Komödie gespielt, hier ging es um Leben und Tod. Hier waren die Meinungen gesetzter, staatskluger Männer gefragt, nicht die von Exzentrikern wie Machiavelli, die sich die Deutungshoheit über die Geschichte und die Gegenwart anmaßten.
Den Ruf der intellektuellen und moralischen Extravaganz hatte sich Niccolò Machiavelli selbst bei seinen Freunden gründlich erworben, wie ein Brief Francesco Guicciardinis vom 18. Mai 1521 bezeugt:
Doch billige ich Eure Wahl nicht, denn sie scheint mir Eurer Urteilsfähigkeit und jener der anderen nicht angemessen, und zwar umso mehr, als Ihr stets in höchstem Maße von der vorherrschenden Meinung abgewichen und als Erfinder neuer und ungewöhnlicher Dinge bekannt seid …[3]
Das hieß im Klartext: Ihr treibt es zu weit, ihr tretet die Werte der Gesellschaft mit Füßen. Wo hörte für Guicciardini, der so manchen Scherz vertragen konnte, der Spaß auf? Machiavelli war mit einer ganz besonderen Mission in das unweit Modena gelegene Städtchen Carpi gereist. Er sollte unter den Franziskaner-Mönchen, deren Kapitel dort tagte, einen vorbildlichen Prediger für die Fastenzeit in Florenz auswählen. Diese Kür sollte er nach den Kriterien der Frömmigkeit, der Gelehrsamkeit, der Beredsamkeit und des sittlichen Lebenswandels vornehmen – wie es sich für einen guten Christen gehörte. So lauteten die Instruktionen, die Machiavelli vom florentinischen «Innenministerium» der Otto di Pratica mit auf den Weg gegeben worden waren.
Dieser legte die Anweisungen auf seine Weise aus, wie er Guicciardini schildert:
Ich dachte gerade über die Seltsamkeiten dieser Welt nach, als Euer Bote eintraf, und war gerade dabei, mir einen Prediger für Florenz vorzustellen, und zwar einen, der mir gefiel, denn darin bin ich eigensinnig, wie bei meinen anderen Ansichten auch. Und da ich dieser Republik dort, wo ich ihr nützen konnte, nie meine Dienste versagt habe, sondern im Gegenteil immer treu ergeben war, mit Taten, wo möglich, sonst mit Worten und, wo auch das nicht ging, mit Andeutungen, so will ich sie auch diesmal nicht im Stich lassen. Ich bin mir wohl bewusst, dass ich auch in dieser Hinsicht wie bei so vielen anderen Dingen anderer Meinung bin. Die braven Florentiner wollen einen Prediger, der ihnen den Weg ins Paradies aufzeigt, ich aber möchte einen finden, der sie den Weg ins Haus des Teufels lehrt. Sie möchten einen gesetzten, vorsichtigen, aufrichtigen, vernünftigen Mann, ich aber will einen, der verrückter als Ponzo, schlauer als Girolamo Savonarola und heuchlerischer als Fra Alberto ist. Denn das schiene mir eine schöne Sache und der Güte der gegenwärtigen Zeiten angemessen: alles, was wir mit so vielen Mönchen erlebt haben, jetzt nochmals in einem einzigen zu erfahren. Denn das wäre, wie ich glaube, die wahre Art, ins Paradies zu gelangen: den Weg zur Hölle vor Augen zu haben und dennoch nicht zu beschreiten.[4]
Das ging selbst dem notorischen Kirchenkritiker Guicciardini zu weit: Glaubte dieser Mensch überhaupt an Paradies und Hölle? Auch wenn sich die Schlusswendung moralisch einwandfrei auslegen ließ: Die Schmerzgrenze war mit solchen Äußerungen selbst für tolerante Zeitgenossen überschritten.
Das wusste Machiavelli, der Querdenker, sehr genau. Er war sich bewusst, dass er sich mit seinen «exzentrischen» Meinungen unbeliebt machte und ins politische Abseits manövrierte. Doch hielt er an seinen unbequemen Urteilen fest, weil er davon überzeugt war, eine Mission zu erfüllen. So viele in ihre eitle Geschwätzigkeit verliebte humanistische Gelehrte hatten Rhetorik, Grammatik, Dichtkunst, Moralphilosophie und Geschichtsschreibung des Altertums wiederbelebt; Architekten, Bildhauer und Maler hatten sich an griechischen und römischen Kunstwerken berauscht. Doch über all diese Nebendinge hatte die Nachwelt den wahren Schatz der Antike übersehen: die ewig gültigen Gesetze der Geschichte und der Politik. Diese ehernen Regeln seiner abgesunkenen Gegenwart vor Augen zu halten und Italien dadurch aus der Talsohle der Geschichte zu neuen Höhen empor zu führen: Darin sah Machiavelli seine Aufgabe. Doch die Unbelehrbarkeit des Menschen im Allgemeinen und der Politiker im Besonderen machte ihn, den Überbringer der politisch-historischen Heilslehre, zum Sonderling; die Uneinsichtigkeit der Zeit verwandelte den politischen Missionar in den intellektuellen Hofnarren der Mächtigen. So lässt sich Machiavellis Selbsteinschätzung am Ende eines an Enttäuschungen reichen Lebens umreißen.
Nicht er, der Denker, sondern der Lauf der Welt war «extravagant». Dieser Überzeugung gemäß musste der Mahner und Warner notwendigerweise zum Spötter werden. Ätzender Hohn und heiliger Ernst, Pathos und Ironie vermischen sich überall in seinen Texten. Davon zeugte schon sein Brief über die Anstellung des Bußpredigers für Florenz. Dass er dem Staat, solange man ihn ließ, treu bis zur Selbstaufopferung gedient habe, war Machiavellis aufrichtigstes Glaubensbekenntnis. Doch in einer verkehrten Welt ließ sich ein solches Credo nur mit nacktem Sarkasmus garnieren.
Welche Wahrheiten hatte der Missionar im Spöttergewand seiner Zeit zu verkünden? Im Folgenden eine kleine Auswahl aus seinen Schriften, die zumindest den Eingeweihten unter seinen Zeitgenossen zugänglich waren:
Erfolg ist das Maß aller Dinge. Erfolg rechtfertigt alles, auch die moralisch fragwürdigsten Methoden, schon deshalb, weil nach dem Triumph niemand mehr fragt, wie er zustande kam. Am erfolgreichsten aber ist, wer die Techniken der Gewalt und der Hinterlist am virtuosesten beherrscht, jeweils zur rechten Zeit und in der passenden Situation. So sollen die Vertreter der führenden Familien in einer wohlgeordneten Republik in dauernder Furcht vor dem Gesetz leben; auch wenn sie diese Regeln nicht übertreten, müssen sie durch politische Prozesse im Zaum gehalten werden. Der Staat hat also nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht, individuelle Existenzen zu vernichten, wenn es seiner Größe und Stärke dient.
Ziel des Staates ist nicht der Friede, sondern der Krieg. Krieg allein macht eine gute Ordnung im Inneren möglich. Sie besteht darin, dass Volk und einflussreiche Persönlichkeiten in dauernder Konkurrenz leben; durch diese Reibungsfläche wird eine Energie erzeugt, die sich in erfolgreiche Expansion umwandeln lässt. Jeder Bürger muss daher zugleich...