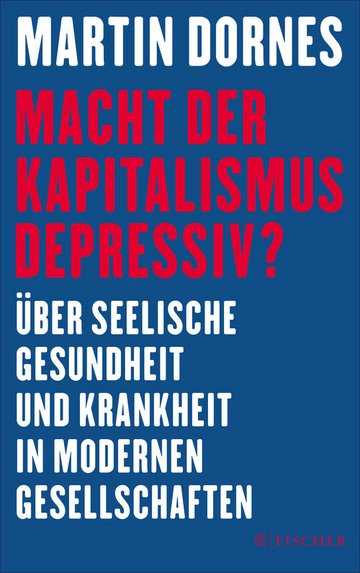Einleitung
In der Öffentlichkeit, aber auch in manchen Fachkreisen, ist die Auffassung weit verbreitet, die Entwicklung moderner Gesellschaften gehe mit einer Zunahme psychischer Erkrankungen einher. Eine solche Feststellung wird oft mit einer Gesellschaftskritik verbunden, der zufolge die Entwicklung vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat zum neoliberalen Kapitalismus seit 1980 für diese Entwicklung mitverantwortlich sei. Vor allem die Verschärfung des Konkurrenz- und Leistungsdrucks in Betrieb und Schule, die Zunahme sozialer Ungleichheit sowie die allgemeine Beschleunigung des Lebenstempos sollen zu Veränderungen in der primären Sozialisation und in der Lebenswelt geführt haben, die das gehäufte Auftreten von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen und von Depressionen im Besonderen begünstigen. Im vorliegenden Essay wird diese Auffassung in ihrem Wirklichkeitsgehalt untersucht.
Im ersten Kapitel zeige ich, dass die These, psychische Krankheiten hätten zugenommen, einer genaueren Überprüfung nicht standhält. Was jedoch zugenommen hat, ist die Sensibilität für Symptome oder Syndrome, die wir früher nicht unter der Rubrik Krankheit wahrgenommen, sondern ignoriert oder als Bestandteil gewöhnlichen Lebensunglücks verstanden haben. Diese Wahrnehmungsveränderung ist Ausdruck eines Sensibilisierungsprozesses. Er geht einher mit häufigeren und genaueren Untersuchungen, einer Ausdehnung des Spektrums möglicher Krankheiten, einer Ausweitung des Versorgungsangebots und – im Gefolge all dieser Entwicklungen – mit einer Zunahme von Krankheitsdiagnosen. Diese spiegeln jedoch keine Zunahme der wirklichen Erkrankungen wider, sondern einen kulturellen Wandel im Krankheitsverständnis bzw. in der Definition von psychischer Krankheit. Um es in einem Bild auszudrücken: Die Größe eines Eisbergs kann konstant bleiben, aber wenn der Wasserpegel sinkt, sehen wir immer mehr von ihm. Der sinkende Wasserpegel in diesem Bild entspricht der steigenden Sensibilität. Wir sehen mehr Krankheiten, obwohl es nicht mehr geworden sind. Ein vergleichbares Phänomen ist in der Kriminologie unter dem Begriff der Dunkelfeldaufhellung bekannt. Wenn die Zahl der Gewalttaten auf Schulhöfen (scheinbar) zunimmt, sind wir nur allzu bereit anzunehmen: »Schulgewalt nimmt zu.« Aber in Wirklichkeit hat die Sensibilität für Schulgewalt zugenommen. Wir schauen genauer hin, betrachten manches als Gewalt, was wir früher als Rauferei betrachtet hätten, und melden einschlägige Vorfälle häufiger. Deshalb nimmt die statistisch erfasste Schulgewalt zu, obwohl die wirkliche Häufigkeit konstant geblieben ist oder sogar abgenommen hat. Ähnlich verhält es sich mit Gewalt in der Ehe oder sexuellem Kindesmissbrauch. Sie alle haben abgenommen, obwohl der gegenteilige Eindruck entsteht, weil noch nie so viel darüber berichtet wurde wie heute. Die zentrale Erkenntnis des ersten Kapitels ist, dass die Krankheitsdiagnosen zunehmen, aber die Krankheiten nicht. Einer Sozialkritik, die sich auf die Behauptung stützt, die Gesellschaft mache in zunehmendem Maße psychisch krank, fehlt somit das sachliche Fundament.
Im zweiten Kapitel gehe ich den verschiedenen Begründungen für die (angeblich) steigenden psychischen Erkrankungen nach, insbesondere der These, Arbeit und Schule würden immer anstrengender und leistungsintensiver. Dieses Thema ist unter der Überschrift »Burn-out« in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Auch hier komme ich nach Auswertung der einschlägigen Forschungsergebnisse zu einem anderen Ergebnis. Die Leistungssteigerungsthese ist häufig nur unzureichend belegt, und selbst wenn sie richtig wäre, muss das nicht zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen führen, weil mit steigenden Anforderungen auch die Kompetenzen zur Problembewältigung wachsen (können). Ich stelle weiter dar, dass den meisten Überforderungstheorien ein unterkomplexes Krankheitsmodell zugrunde liegt, welches Auslöser nicht hinreichend von Ursachen unterscheidet und so die Entstehung psychischer Krankheiten unzulässig vereinfacht, etwa wenn der von der Werbeindustrie bevorzugte Typ des »Magermodels« für eine Zunahme von Anorexien verantwortlich gemacht wird. Schließlich gehe ich in diesem Kapitel der Frage nach, ob der steigende Gebrauch psychoaktiver Medikamente wie Antidepressiva oder Ritalin ein Indiz dafür sein könnte, dass wir überfordert sind oder psychisch kränker werden. Ich komme zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist. Der zweifellos zunehmende Gebrauch von Psychopharmaka stellt nämlich zum Ersten keinen übermäßigen Gebrauch dar, sondern beseitigt eine bisherige Unterversorgung. Zum Zweiten ist er im Kern kein Versuch, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, sondern einer, die Leistungserbringung zu erleichtern und/oder ein gegebenes Niveau an Leiden zu lindern, was erst durch neue Behandlungsmethoden möglich wird. Diese Lesart ist kontrovers, und ich räume ein, dass letzte Gewissheiten in dieser Frage nicht zu haben sind. Ich betrachte den steigenden Medikamentengebrauch ähnlich wie andere Zunahmen der Inanspruchnahme medizinischer Versorgungsleistungen (etwa Hüft- oder Knieprothesen). Sie alle sind in meinen Augen legitime Versuche, mit den immer vorhandenen Problemen des Lebens leidmindernd umzugehen, auch wenn es andere Möglichkeiten geben mag, über deren Vorzugswürdigkeit ich nicht urteilen will. Die medikamentöse Form des Umgangs führt gelegentlich zu Entgleisungen oder Übertreibungen. Eine davon wird derzeit unter dem Begriff des Hirndopings diskutiert. Ich zeige, dass es sich dabei um ein eher situatives und wenig verbreitetes Problem handelt, das man keineswegs ignorieren, aber auch nicht dramatisieren sollte.
Im dritten Kapitel analysiere ich eine Form der Gesellschaftskritik, die ihre Überzeugungskraft aus einer Verklärung der Vergangenheit bezieht. Die guten alten Zeiten waren jedoch in kaum einer Hinsicht besser als die heutigen – weder in der Welt der Familie noch in der Arbeitswelt, noch in der soziokulturellen Realität von Kindererziehung, Geschlechterverhältnissen oder Umgang mit Minderheiten. Es besteht kein Anlass, die Nachkriegsepoche als die »30 wunderbaren Jahre« (Colin Crouch) zu verklären und eine Wiederbelebung solcher Verhältnisse anzustreben. Ich halte das weder für wünschenswert noch für erfolgversprechend. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels befasse ich mich mit Problemen gegenwärtiger Zeitdiagnosen. Der Topos der »Müdigkeitsgesellschaft« oder der »Gesellschaft der Angst« hat es zu einiger Prominenz gebracht. Ich unterscheide zwischen Behauptungen, die besagen, dass depressive oder Angsterkrankungen zunehmen, und solchen, die eine Zunahme kollektiver Stimmungen wie Müdigkeit oder Angst postulieren, und zeige, dass Stimmungsdiagnosen und Krankheitsdiagnosen verschiedene Phänomene sind. Ich bin skeptisch gegenüber Stimmungsdiagnosen, weil sie (zu) häufig auf schwankendem empirischen Grund stehen, d.h. Belege für die Zunahme von Stimmungen verwenden, die ich aus verschiedenen Gründen für problematisch halte.
Im vierten Kapitel wende ich mich schließlich den psychosozialen Problemen der Gegenwart zu, die ich weder in der Zunahme von Krankheiten noch in steigendem Medikamentenkonsum sehe. Ich skizziere vielmehr drei neue Entwicklungen: den Strukturwandel der Psyche von der autoritären zur postheroischen Persönlichkeit, den Strukturwandel des Sozialstaats vom schützenden zum befähigenden Sozialstaat und die Veränderung der Arbeitswelt von der hierarchisch organisierten, monotonen Fließbandarbeit zur heutigen netzwerkartig organisierten und komplexeren Arbeitswelt sowie die Verzahnung dieser drei Entwicklungen. Sie bringen neue Chancen, aber auch andere Probleme mit sich. Ich stelle dar, dass die Probleme überbetont und die Chancen zu wenig gewürdigt werden. Im Schlussabschnitt dieses Kapitels befasse ich mich mit neuen psychosozialen Leiden, die innerhalb einer neuen Lebens- und Arbeitswelt entstehen. Heute mischen sich in bestimmten Gruppen der Gesellschaft, und zwar sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen, psychische Probleme in einer Weise, dass sich der klassische Sozialfall und der klassische Psychotherapiefall überschneiden. Die sogenannte »Neue Morbidität« stellt sowohl den Sozialstaat wie das psychosoziale Versorgungssystem vor neue Aufgaben. Die Probleme betreffen indes nur eine Minderheit, die im derzeitigen Problemdiskurs oft falsch etikettiert wird. Nicht Helikoptereltern, bildungspanisch gewordene Mittelschichteltern, ausgebrannte Leistungsträger oder erschöpfte Mittelschichtarbeitnehmer sind die wirklichen Problemgruppen in modernen Gesellschaften, sondern Personengruppen (vorwiegend) aus dem ärmsten Fünftel der Bevölkerung, denen es an psychosozialen und beruflichen Kompetenzen fehlt, die zur Lebensbewältigung nötig sind. Als zentrales psychosoziales Problem liberaler Gesellschaften betrachte ich die Selbststeuerungsfähigkeit der Individuen. Diese Fähigkeit wird in der demokratisierten Familie grundgelegt, ist bei diesen Gruppen aber zu wenig entwickelt und muss durch komplexe Präventions- und Interventionsmaßnahmen verbessert werden.
Im Schlussabschnitt ziehe ich eine Bilanz, die moderat optimistisch ausfällt. Weder ist die moderne Gesellschaft auf dem Weg, zu einem großen psychiatrischen Krankenhaus zu werden, noch sind die Menschen von der gegenwärtigen Lebens- und Arbeitswelt zunehmend erschöpft oder überfordert. Eine Fundamentalkritik am gegenwärtigen Kapitalismus – ich verstehe darunter eine Gesellschaftsform westlichen Typs, die marktwirtschaftlich organisiert sowie rechtsstaatlich und repräsentativdemokratisch verfasst ist – lässt sich mit den von mir dargestellten Befunden und...