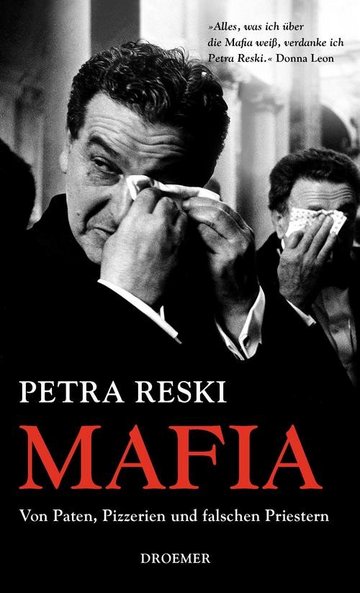Marcello Fava
Es ist immer hässlich, bei einem Mord anwesend zu sein. Besonders, wenn es sich dabei um eine Person handelt, die du kennst. Und wenn du nicht weißt, warum diese Person gerade stirbt oder gestorben ist. Du weißt es nicht, und du wirst es auch nie erfahren. Denn wenn du als normaler Soldat handelst, wie wir das in der Cosa Nostra nennen, dann geben sie dir keine Erklärungen.
Der Mann trägt sein dunkelblondes Haar gescheitelt. Er hat wasserblaue Augen, ein kleines Doppelkinn und die Lippen einer Frau. Er ist in einen nachtblauen Zweireiher mit goldenen Knöpfen gehüllt und balanciert unbeholfen einen Aktenkoffer auf den Knien.
Er schaut auf seine Uhr und auf die Abflugtafel unseres Fluges von Venedig nach Palermo. Die angekündigten zwanzig Minuten Verspätung sind fast vorbei. Als die Stewardess das Gate öffnet, steht er auf und zieht sich den Stoff seines Anzuges über den Knien glatt. Er wirkt seltsam altertümlich. So wie Sizilianer oft wirken, wenn sie das Leben nach Norden gespült hat – ganz so, als entstammten sie längst vergangenen Zeiten. Sicher trägt er ein Hemd mit Monogramm. Sizilianer zelebrieren Eleganz mit heiligem Ernst, etwa so wie der Geschäftsmann im Nadelstreifenanzug, der vor dem Gate auf und ab schreitet und in der Hand einen kleinen, erloschenen Zigarillo hält. Ganz wie in Die Ehre der Prizzis. Oder die Frau mit den großen Ohrringen und den halterlosen Strümpfen, deren Strumpfbänder sich unter ihrem engen Rock abzeichnen, wenn sie die Beine überschlägt. Ganz wie Sophia Loren in Gestern, heute, morgen. Oder das alte Ehepaar, das aussieht wie die Komparsen einer Dolce&Gabbana-Werbekampagne: die Frau mit Haarknoten, in ein schwarzes Kostüm gekleidet, der Mann in einem groben, karierten Jackett – ein Ehepaar, das sich nur flüsternd miteinander verständigt und dem man ansieht, dass es sein Dorf nur einmal im Jahr verlässt, um den Sohn zu besuchen, der im Veneto Arbeit gefunden hat. Was die Eltern für einen schweren Schicksalsschlag halten. Außer diesen sichtbaren Sizilianern gibt es noch die Unsichtbaren, die in Venedig überhaupt nicht sizilianisch aussehen, ganz so, als seien sie fern von Sizilien verblasst. Und die sich während des Fluges verwandeln. Die mit jeder Flugminute, die sie näher nach Sizilien bringt, wieder ihre ursprüngliche Farbe annehmen.
Der Mann im nachtblauen Zweireiher hat als Erster den Flughafenbus bestiegen, er hat den kleinen Aktenkoffer nicht auf dem Boden abgestellt, sondern trägt ihn unter dem Arm, was ihm etwas seltsam Ängstliches gibt, wie ein Kind, das zum ersten Mal auf Reisen geht.
Meist wird das Opfer von einem Freund in ein Haus gebracht, möglichst von seinem besten Freund, damit es sich sicher fühlt. Dann ergreift man ihn, und wenn er noch etwas zu sagen hat, dann sagt er es jetzt. Ich möchte den sehen, der nicht spricht, mit einer Schlinge um den Hals. Aber egal, ob er spricht oder nicht, umgebracht wird er auf jeden Fall.
Als wir das Flugzeug besteigen, verliere ich ihn aus den Augen. Die Sizilianerin mit den Strumpfbändern wiegt sich durch die Reihen zu ihrem Platz. Das alte sizilianische Ehepaar schleppt so viele Plastiktüten und verschnürte Pakete durch den Gang, als beabsichtige es, seinen gesamten Hausrat im Gepäckfach zu verstauen. Bis auf ein paar übergewichtige amerikanische Touristen, die sich durch die engen Sitzreihen quälen, ist das Flugzeug voller Italiener, meist Geschäftsreisende.
Ich nehme von Venedig aus immer den Abendflug nach Palermo, es gefällt mir, in der Nacht anzukommen, gerade noch früh genug, um zu Abend zu essen. Als ich bereits sitze, schicke ich noch zwei SMS, eine an Salvo, den Taxifahrer meines Vertrauens, eine an Shobha, die Fotografin, mit der ich schon so lange zusammenarbeite, dass uns ein fast eheähnliches Verhältnis verbindet. Ich kündige an, dass wir zwanzig Minuten Verspätung haben, und bitte Shobha, für uns einen Tisch im Restaurant zu reservieren.
Wie immer nehme ich mir vor, auf dem Flug noch etwas zu arbeiten, und beginne, in meinem Archivmaterial zu blättern. Dann ziehe ich aus meiner Tasche das Buch über das Geheimnis des roten Kalenders von Staatsanwalt Paolo Borsellino hervor. Als ich es aufschlage, habe ich sofort das Gefühl, als würde jemand mitlesen. Der sizilianische Verfolgungswahn setzt schon ein, wenn ich noch gar nicht in Sizilien bin. Jedes Mal, wenn ich nach Palermo fliege, frage ich mich, ob es klug ist, im Flugzeug in Artikeln über Bosse, Investitionsstrategien der Mafia oder Vorträgen über Mafia und Macht zu blättern. Oder gar die Zeitung Antimafia 2000 zu lesen, eine Zeitung, die Abonnenten stets in einem auffällig neutralen Umschlag geschickt wird, ganz so, als handele es sich um Pornohefte. Manchmal verspüre ich eine gewisse Aufsässigkeit und denke: Mir doch egal. Schließlich leben wir in Europa und nicht in Transsinistrien! Italien ist Gründungsmitglied der EU! Und manchmal klappe ich mein Buch wieder zu und stecke es weg. So wie jetzt.
Als der Mann im nachtblauen Zweireiher in der gleichen Reihe wie ich Platz nimmt, blättere ich bereits gelangweilt im Bordmagazin, in dem davon die Rede ist, dass eine Wohnung in Venedig goldene Eier lege, weil man sie als Ferienwohnung das ganze Jahr über vermieten könne. Er nickt mir freundlich, aber unbeteiligt zu, so wie man eine Fremde grüßt, mit der man nicht mehr als die Flugstrecke gemein hat. Der Sitz zwischen uns ist leer, und der Mann stellt seinen Aktenkoffer dort ab.
Bevor ich jemanden umbringen musste, bekreuzigte ich mich. Ich sagte: Lieber Gott, steh mir bei! Mach, dass nichts passiert! Ich war aber nicht der Einzige, der sich vorher bekreuzigte und zu Gott betete. Wir machten das alle so.
Ich erinnere mich noch an jeden seiner Sätze. Um mit ihm sprechen zu können, hatte ich einen Antrag beim Innenministerium stellen müssen, ich musste meine Motive formulieren und garantieren, dass ich ihm keine Fragen zu laufenden Prozessen stellen würde. Unserem Treffen musste nicht nur der Staatssekretär des Innenministeriums zustimmen, sondern auch jeder einzelne Staatsanwalt der Mafiaprozesse, in denen Marcello Fava als Angeklagter oder Zeuge auftrat. Um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, rief ich anfänglich fast jede Woche den Servizio Centrale an, jene Abteilung des römischen Innenministeriums, die für abtrünnige Mafiosi verantwortlich ist und deren Name klingt wie der eines Geheimdienstes. Allerdings wurde mir sehr bald klargemacht, dass meine Nachfragen die Sache nicht beschleunigen würden. Don’t call us, we call you. Ein halbes Jahr lang hörte ich gar nichts. Und eigentlich hatte ich bereits jede Hoffnung aufgegeben, als ich eines Nachmittags einen Anruf aus Rom erhielt. Servizio Centrale, sagte eine Stimme. Mein Antrag sei genehmigt worden. Ich sollte mich in einer Bar in Rom einfinden, die einer Ironie des Schicksals zufolge den Namen Lo Zio d’America trug. Der Onkel aus Amerika.
Wenige Tage später setzte mich ein Taxi einige Meter vor der Bar ab. Die Bar sah aus wie eine jener labyrinthischen italienischen Autobahnraststätten, die man betritt, um einen Espresso zu trinken, und die man mit fünf CDs, sardischer Eselswurst und einem Parmesankäse verlässt. Hinter einer endlos langen Theke standen Barmänner mit Papierschiffchen auf dem gegelten Haar. Als ich mir einen Espresso bestellen wollte, klingelte mein Telefon. Ich tastete in meiner Tasche, aus deren Tiefen es weiterklingelte, bis ein neben mir stehender Mann sagte: Ich habe Sie angerufen. Bitte folgen Sie mir.
Seinen Namen hatte ich nicht verstanden. Ich ging mit etwas Abstand hinter ihm her. Für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, was geschehen würde, wenn der Mann, dem ich folgte, nicht der Mann wäre, für den ich ihn hielt. Ich folgte ihm über löchrige Bürgersteige, vorbei an Sechziger-Jahre-Wohnblocks und Buchsbaumhecken, die nach Katzendreck rochen. Rom ist in seiner Peripherie so gesichtslos, dass ich Mühe hatte, mir den Weg zu merken. Schließlich blieb er vor einem Hauseingang stehen, neben dem zwei Männer mit jener auffälligen Unauffälligkeit warteten, die Polizisten eigen ist. Der Flur sah nach sozialem Wohnungsbau aus, graugelb blätterte die Farbe von den Wänden.
Danach sind wir oft zusammen essen gegangen. Vielleicht ist das Sadismus, tja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Aber es war wirklich so. Am Abend haben wir uns getroffen und sind zusammen essen gegangen. Du musst vergessen. Du musst diese Sache einfach vergessen. Es ist überhaupt nichts passiert.
Der Mafioso Marcello Fava wartete im dritten Stock auf mich. In einer Wohnung, die vom Innenministerium unter falschem Namen angemietet worden war – für »Mitarbeiter der Justiz«, wie abtrünnige Mafiosi politisch korrekt und etwas euphemistisch in der Sprache der Juristen genannt werden. Seitdem Marcello Fava mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitete, mussten er, seine Frau und seine beiden Söhne vor der Rache der Cosa Nostra geschützt werden. Sie hatten Sizilien verlassen müssen und lebten unter Polizeischutz und unter fremden Namen irgendwo in Italien.
Obwohl die Wohnung unbewohnt war, steckte sie doch voller Spuren eines fremden Lebens: An einer Wand hingen ein Schäferidyll und ein fast erblindeter venezianischer Spiegel, in einer Ecke stand ein verschlissenes senffarbenes Sofa, daneben ein ausgefranster Korbstuhl, ein alter Gasherd. Der Gasherd war abgenutzt, und auf dem Esszimmertisch lag eine alte Wachstuchdecke mit Schnittspuren. Es war, als seien die Bewohner nur kurz weggegangen, gleich...