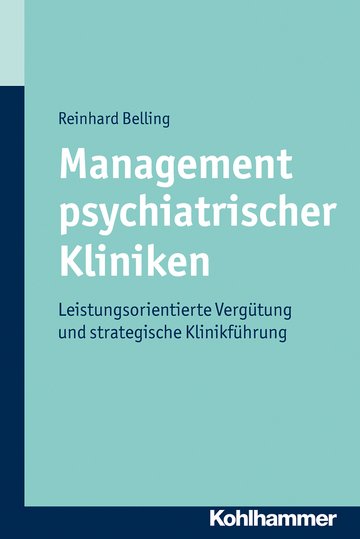1 Rahmenbedingungen und Wettbewerbsumfeld
1.1 Demografische Grundlagen
Die Gesundheitsbranche gilt vielen als einer der stärksten Wachstumsmärkte in der zukünftigen Entwicklung des Industrie- und Dienstleistungsstandortes Deutschlands. In einer Studie geht das Baseler Institut Prognos davon aus, dass der Bereich Gesundheit der große Gewinner des kommenden Jahrzehnts werden wird. Der alternden Bevölkerung und ihrer Nachfrage nach Medizin und Wellness-Angeboten entsprechend soll die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren weit überdurchschnittlich wachsen und 500.000 neue Arbeitsplätze generieren. Auch für den Krankenhausbereich werden basierend auf den Prognosen zur demografischen Entwicklung ähnliche Wachstumsprognosen aufgestellt (Handelsblatt 2011, S. 6).
Die Zahlen zur Alterung der Gesellschaft sind beeindruckend. Im neuesten Demografiebericht der Bundesregierung werden wesentliche Kennzahlen des demografischen Wandels zusammengefasst: Unsere Bevölkerung nimmt seit dem Jahr 2003 ab und ist mittlerweile auf 81,7 Mio. Einwohner gesunken. Die hohen sogenannten Sterbefallüberschüsse werden seit diesem Jahr nicht mehr durch einen Überschuss an Zuwanderung ausgeglichen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und daher die Bevölkerung bis zum Jahr 2060 auf 65 bis 70 Mio. Menschen zurückgeht. Dies würde einem Rückgang von 15 bis 21 % innerhalb von 50 Jahren entsprechen. Der Rückgang geht einher mit einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Während heute die Bevölkerung noch zu jeweils einem Fünftel fast in gleichen Teilen aus Kindern und Jugendlichen unter zwanzig Jahren auf der einen Seite und Menschen über 65 Jahren auf der anderen Seite besteht, werden im Jahr 2060 mehr als ein Drittel über 65 Jahre alt sein. Die Veränderung des Altersaufbaus unserer Bevölkerung hat die bekannten zwei Ursachen. Erstens: Der positive Aspekt des Älterwerdens. Seit 150 Jahren steigt die Lebenserwartung in Deutschland pro Jahr um knapp drei Monate. Nachdem dies zunächst auch durch einen Rückgang der Kindersterblichkeit begründet war, liegt dies seit einigen Jahrzehnten an einem Zugewinn an Lebensjahren in den späten Lebensabschnitten (alle Daten BMI 2011).
Zweite Ursache für die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur ist die Geburtenrate. Diese liegt bereits seit Mitte der 1970er Jahre bei rund 1,4 Kindern je Frau und damit deutlich unterhalb der Quote von 2,1 Kindern, die erforderlich wäre, um die Elterngeneration zu ersetzen. Die Wirkung der niedrigen Geburtenrate zeigt sich nun seit einigen Jahren in vollem Maße, da die Babyboomergeneration ihre Familienplanung weitgehend abgeschlossen und nun die Zahl der potenziellen Eltern abgenommen hat.
Auch wenn die Entwicklung in Deutschland repräsentativ für entwickelte Staaten ist, so ist sie doch bei uns am ausgeprägtesten: »Deutschland ist das EU-Altenheim« titelt die Tagespresse (NNP 2011). Das Durchschnittsalter von 44,2 Jahren ist das höchste in Europa, der Anteil der Menschen ab 65 Jahren ist der höchste und auch die Geburtenrate ist mit 1,36 Kindern pro Frau am unteren Ende.
Zu den Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Krankenhäuser: In der Studie »Demografischer Wandel in Deutschland, Auswirkungen auf Krankenhausbehandlungen und pflegebedürftige im Bund und in den Ländern« gehen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder von einer Steigerung der Krankenhausfälle um 1,4 Mio. auf 19,3 Mio. im Jahr 2030 aus (2010, S. 11). Dies wäre ein Anstieg um 8 %. Bis zum Jahr 2020 wird eine Steigerung auf 18,8 Mio. Fälle prognostiziert. Grundlage dieser Überlegung ist ein Status-quo-Szenario, nach dem die Wahrscheinlichkeit, infolge einer Erkrankung stationär behandelt zu werden, heute und in Zukunft allein vom Alter und vom Geschlecht abhängt. Die Berechnung basiert auf der Prognose, in Deutschland lebten im Jahr 2030 rund 7,3 Mio. mehr Personen über 60 Jahre als im Jahr 2009. Dies entspreche einer Zunahme von 34,5 %. Im Jahr 2030 würden dann 37 % der Einwohner in Deutschland zu den 60-Jährigen und älteren zählen, während dies 2009 nur jeder vierte ist.
1.2 Kapazitätsentwicklungen in der Psychiatrie und Psychotherapie
In einer tiefergehenden Betrachtung nach Diagnosegruppen kommt das Statistische Bundesamt zu dem Schluss, dass sich für die Gruppe der psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen die Zahl der Krankenhausfälle von 1.124.000 im Jahr 2008 auf 1.050.000 im Jahr 2020 und 1.002.000 im Jahr 2030 reduzieren soll (► Abb. 1.1).
In der Status-quo-Betrachtung ändern daran auch die Demenzerkrankungen nichts. Zwar ist hier von einem deutlichen Anstieg der Fälle auszugehen, jedoch fallen Krankenhausbehandlungen wegen Demenz zurzeit in absoluten Zahlen kaum ins Gewicht. Eine Zunahme Demenzkranker würde sich demnach hauptsächlich im Bereich der häuslichen Pflege auswirken.
Abb. 1.1: Veränderung der Krankenhausfälle nach Diagnosegruppen 2008–2030 in Prozent
Aufgrund der getroffenen Annahmen, sind die Aussagen folgerichtig, jedoch mögen sie vielen Psychiatrie-Fachleuten im Widerspruch zum tatsächlichen Geschehen der jüngeren Vergangenheit stehen. ► Tabelle 1.1 zeigt nochmals die Entwicklung in der stationären Krankenhausversorgung im Bereich der Erwachsenen-Psychiatrie in den vergangenen zwanzig Jahren: In hohem Maße verursacht durch die Enthospitalisierung ist die Verweildauer in den Fachabteilungen der Erwachsenenpsychiatrie zwischen 1991 und 2009 von 64,8 Tagen auf 23 Tage gesunken. Dies hat einen Bettenabbau in derselben Zeit von 84.000 auf knapp 54.000 ermöglicht. Gleichzeitig hat sich jedoch die Fallzahl im selben Zeitraum fast verdoppelt: Von ungefähr 407.000 auf 796.000.
Tab. 1.1: Entwicklung der Psychiatrie und Psychotherapie 1991–2009
Jahr | Betten | Fallzahl | Verweildauer |
Für eine genauere Marktanalyse lohnt ein Blick in die jüngere Entwicklung. Die Verweildauer ist in den vergangenen Jahren nur noch moderat gesunken. Lag sie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2005 noch bei 24,2 Tagen, so ist sie in kleinen Schritten im Jahr 2009 auf 23,0 Tage gesunken. Diese geringfügige Absenkung der Verweildauer führt zu dem Effekt, dass die kontinuierlich steigenden Fallzahlen auch zu einer Steigerung der psychiatrischen Kapazitäten führen. Das Jahr 2005 scheint das Jahr der Trendumkehr zu sein (► Abb. 1.2).
Abb. 1.2: Fallzahl- und Bettenentwicklung 2004–2009 Psychiatrie und Psychotherapie
Die Abbildung zeigt wie die Bettenkapazitäten in der Erwachsenen-Psychiatrie nach dem Jahr 2005 erstmals steigen – von 52.800 auf 53.800 im Jahr 2009. Zurzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendumkehr, so dass in Zukunft von einer weiteren Ausweitung der Nachfrage und damit auch der angebotenen Kapazität ausgegangen wird. Die Datenlage und auch die Einschätzung vieler Fachleute deuten auf einen wichtigen Umstand: Die Inanspruchnahme vollstationärer psychiatrischer Leistungen wurde in den vergangenen Jahren nicht von der demografischen Entwicklung getrieben, sondern durch andere Faktoren bestimmt. Als treibende Faktoren für die Inanspruchnahme psychiatrischer Leistungen gelten:
- Die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung für psychische Erkrankungen
- Die zunehmende Entstigmatisierung psychiatrischer Erkrankungen
- Verbesserte ambulante Strukturen, die einen Zugang zum psychiatrischen Versorgungssystem ermöglichen
- Steigende Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt
- Die Auflösung familiärer und sozialer Strukturen und damit der Wegfall auffangender Systeme
Die Entwicklung hat auch ihre Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen. In der Zeit zwischen 2001 und 2010 sind die hierdurch bedingten Arbeitsunfähigkeitstage von 33,6 Mio. auf 53,5 Mio. gestiegen. Dies bedeutet eine Erhöhung des Anteils an den gesamten Fehltagen von 6,6 auf 13,1 % (Deutsches Ärzteblatt, 19/2012).
Die spezifischen Prognosen zur Entwicklung psychiatrischer Erkrankungen gehen von einem weiteren Anstieg des Behandlungsbedarfs in der Psychiatrie aus. Ein weiteres Beispiel ist der sogenannte Global Burden of Disease. Nach Hochrechnungen der WHO kommen im Jahr 2030 in den industrialisierten Ländern fünf der zehn stärksten Beeinträchtigungen aus dem Bereich der Psychiatrie (Schneider et al. 2011, S. 9). Es gibt keine Hinweise auf eine Umkehr des Bedarfs an psychiatrischen Kapazitäten. Insofern wird an dieser Stelle den Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes nicht gefolgt. Die gesetzten Annahmen zur...