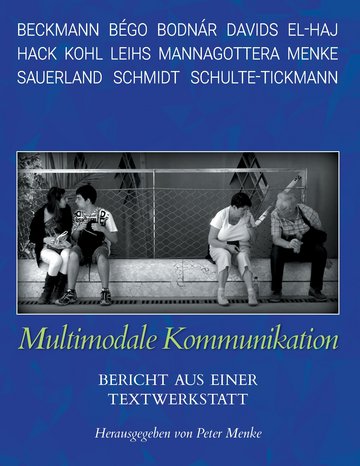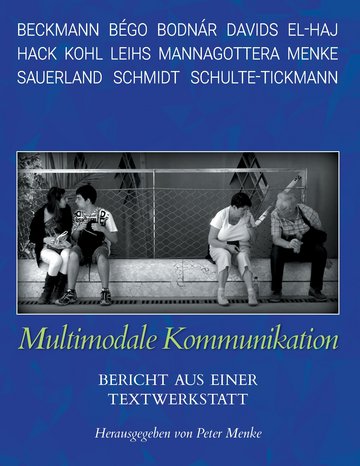KAPITEL 2
Theoretische Vorüberlegungen
Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, gehen wir hier zunächst von der klassischen linguistischen Sicht aus, menschliche Kommunikation funktioniere primär über gesprochene Äußerungen. Wir stellen dann einige Überlegungen an, inwiefern sich kommunikative Praktiken wie Gestik oder Mimik hier einordnen lassen. Es wird deutlich werden, dass der Kommunikationsbegriff weiter gefasst werden muss, und dass wir uns zunächst überhaupt klar werden müssen, was wir genau unter Begrifflichkeiten wie Sinn, Kanal oder Modalität verstehen wollen.
2.1 Kommunikation
Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) präsentieren in ihrem Studienbuch Linguistik eine Taxonomie menschlichen Verhaltens (S. 197f.), das die eigentliche sprachliche Kommunikation als in vielerlei Hinsicht besonders darstellt: Sie ist intentional (gilt somit als Handlung), partnerorientiert (ist daher Interaktion), ist symbolisch (somit Kommunikation) und zuletzt auch noch verbal. Während in den jeweils komplementären Kategorien zwar diverse nonverbale Verhaltensweisen beschrieben werden, erfolgt dies im Vergleich zur gesprochenen Sprache sehr viel oberflächlicher – der Hauptzweck ist hier die negative Abgrenzung. Blicke werden in diesem Schema pauschal als nicht-kommunikative Interaktion abgetan – eine Sichtweise, die wir für zumindest problematisch halten, wenn man daran denkt, dass mit Blicken beispielsweise aktiv gezeigt werden kann (vgl. Shepherd, 2010).
Weiterhin wird klar, dass Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) eine einseitige Perspektive auf das Phänomen Kommunikation innehaben: »Das Schema definiert die Begriffe vom Standpunkt des Produzenten aus« (ebd., S. 198). Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf alternative Sichtweisen, wie etwa die bekannte von Watzlawick, Bavelas und Jackson (2007) eingenommene Perspektive, dass im Grunde alles, was wahrgenommen werden kann, auch potentieller Bestandteil von Kommunikation ist, nehmen diese Perspektive in ihrem Schema jedoch nicht auf.
Wir sind der Auffassung, dass die vorgeschlagene taxonomische Klassifikation nicht alle Feinheiten multimodaler Kommunikation erfassen kann. Etwas allgemeingültigere und daher (zunächst) brauchbarere Modelle finden wir in der Semiotik, beispielsweise bei Krampen (1997). Das dort vorgeschlagene Modell abstrahiert von den konkreten Erscheinungsformen von potentiellen Signalen – alles, was von einem Organismus rezipiert werden kann, kann auch durch eine entsprechende Interpretation Bedeutung erlangen. So können nun auch solche Beobachtungen Teil von kommunikativen Prozessen werden, die nach dem Modell von Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) überhaupt nicht berücksichtigt werden, wie etwa unterbewusst oder unbewusst erzeugtes Verhalten, wie ein erschrecktes Luftholen oder eine Weitung der Augen nach der Entgegennahme einer unbekannten negativen Information. Obwohl diese Verhaltensweisen in der Regel nicht intendiert sind, tragen sie doch zu den weiteren Iterationen der Kommunikation bei, wenn sie von Rezipienten dahingehend interpretiert werden, dass der Produzent durch die neuen Informationen in einer bestimmten Weise beeinflusst worden ist (sei es lediglich durch Überraschung oder sogar durch Veränderung seiner emotionalen Einstellung).
Krampens Modell ist bis dahin primär rezipientenorientiert, jedoch werden auch hier reaktive produktionsbezogene Elemente angesprochen: Auf der Basis der aus den rezipierten Beobachtungen entnommenen Informationen veranlasst die sogenannte interpretierende Einheit den Organismus zu einem bestimmten Verhalten. Dieses Verhalten wiederum kann Kanäle in der Außenwelt manipulieren (wie etwa die Luft in Form von Schallwellen oder Licht), was wiederum (in der nächsten Iteration der Semiose) von weiteren Teilnehmern rezipiert und verarbeitet werden kann.
Natürlich vereinfacht auch dieses Modell die kommunikative Wirklichkeit. Beispielsweise ist Kommunikation nie so streng sequenziell, wie es dieses Modell suggeriert. Dennoch ist sein großer Vorteil die Abstraktion von einer vorherrschenden kommunikativen Strategie – gesprochene Sprache ist hier nur eine Möglichkeit unter vielen, und der Organismus kann neben dem akustischen auch über eine ganze Reihe anderer Pfade Informationen aus der Umwelt aufnehmen. Diesem Aspekt der Kommunikation widmen wir uns im folgenden Abschnitt.
Literatur
Krampen, Martin (1997). »Models of Semiosis«. In: Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. Hrsg. von Posner, Roland. Bd. 1. Berlin: de Gruyter. Kap. 5, S. 247–287
Linke, Angelika, Nussbaumer, Markus und Portmann, Paul R. (2004). Studienbuch Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer
Watzlawick, Paul, Bavelas, Janet Beavin und Jackson, Don D. (2007). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 11., unveränderte Auflage. Bern: Huber
Von Peter Menke.
2.2 Sinne
Wie viele Sinne hat der Mensch? Die offensichtliche Antwort, die der Fragesteller erwarten würde, wäre sicherlich »fünf«. Diese Antwort ist jedoch nicht nur offensichtlich, sondern auch zu vereinfacht. So antwortet ein Artikel in der Onlineausgabe von Spektrum (Schönfelder, 2013) auf diese Frage mit »sechs«, und rechnet zu den bekannten Sinnen Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken und Riechen auch noch das Gleichgewichtsgefühl hinzu.
Was macht das Gleichgewichtsgefühl zu einem Sinn? Was macht irgendeinen der anderen fünf Sinne zu einem Sinn? Sehr vereinfacht gesagt, lässt sich ein Sinn als aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt sehen:
Einerseits gibt es, damit die Sinneswahrnehmung zustande kommt, ein Signal, einen Sinnesreiz. Dieser Reiz muss allerdings nicht von außerhalb des Körpers kommen. Andererseits gibt es ein Organ am oder im Körper, das diesen Reiz wahrnimmt: ein Sinnesorgan. Die Sinneswahrnehmung dabei ist stets auch individuell, und mag sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Diese Darstellung von Sinnen erlaubt es einem nun auch, interessante alternative Sichtweisen darauf, was ein Sinn überhaupt ist, nachzuvollziehen.
Während die klassische Sichtweise der fünf Sinne sich bereits bei Aristoteles zeigt (in De anima III, 1), unterscheidet Lowenstein (1966) beispielsweise nur drei Arten von Sinnen, die er danach kategorisiert, auf welchem physikalischen Weg das Signal übermittelt wird: chemisch (wie beim Schmecken und Riechen), elektromagnetisch (wie beim Sehen) oder mechanisch (wie beim Hören und Fühlen).
Schmidt (2007) dagegen geht von den altbekannten fünf Sinnen aus, er betrachtet aber auch noch andere Möglichkeiten. Speziell wirft er die Frage auf, ob Jucken, Schmerz, Kitzel Sinne seien. Schmidt sagt dort treffend: »Es wird immer eine Interpretationsfrage sein, über wie viele Sinne der menschliche Körper verfügt.« Hinzugefügt sei noch, dass es auch vermutlich eine Frage der jeweiligen Disziplin sein mag, aus der man kommt.
Das die allgemeine Vermutung, die fünf Sinne des Menschen seien ein Fakt, sich so nicht halten lässt, führt (hoffentlich) zu weiterem Interesse an der Auseinandersetzung mit diesem weiten Feld.
Literatur
Aristoteles. De anima
Lowenstein, Otto (1966). The senses. Harmondsworth: Penguin Books
Schmidt, Robert F. (2007). Physiologie des Menschen. Hrsg. von Lang, Florian und Thews, Gerhard. 30. Aufl. Springer-Lehrbuch 30. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, S. 994
Schönfelder, Vinzenz (2013). Wie viele Sinne hat der Mensch? URL: http://www.spektrum.de/quiz/wie-viele-sinne-hat-der-mensch/867032
Von Rick Davids.
2.3 Modalitäten
Nachdem durch den vergangenen Abschnitt schon deutlich geworden sein sollte, dass ein vermeintlich so klarer Begriff wie der des Sinnes gar nicht so eindeutig zu bestimmen ist, soll dieser Abschnitt kurz darstellen, dass auch das Konzept der Modalität in verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich verstanden und gleichzeitig oft gar nicht ausreichend genau definiert wird. Hierfür versuchen wir, die Literatur nach einer für all unsere Fälle gültigen und hilfreichen Definition von »Modalität« zu durchforsten.
Zunächst grenzen wir, um initiale Missverständnisse zu vermeiden, den Bereich der Modalsemantik aus, mit ihrem unter das Adjektiv »modal« subsumierbaren Themenfeld, das sich mit der sprachlichen Kennzeichnung von Notwendigkeit oder Möglichkeit bestimmter Ereignisse befasst (und hier beispielsweise mit den bekannten Modalverben wie »müssen« oder »dürfen«). Diese Lesart ist in unserem Fachgebiet ausdrücklich nicht gemeint, auch wenn die Prominenz dieser Bedeutungsvariante von »Modalität« ein nicht zu unterschätzender potentieller Verwirrungsfaktor ist.4
Stattdessen verstehen wir unter Modalität zunächst erst einmal ganz naiv eine bestimmte Technik, Art oder Weise, zu kommunizieren. Als Einstieg eignet sich hier eine extensionale...