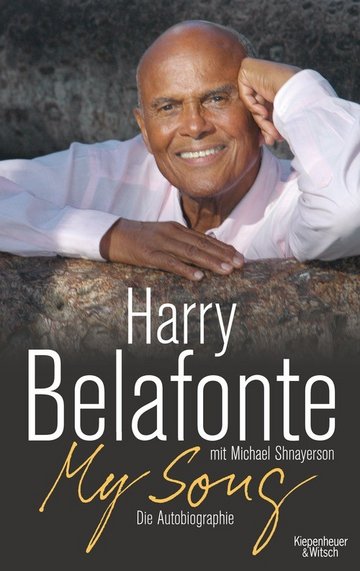2
Ich wurde in Armut hineingeboren, wuchs in Armut auf, und lange Zeit glaubte ich, die Armut niemals loswerden zu können. Sie hat mich geprägt; und in tiefster Seele denke ich, sie prägt mich noch immer. Was ich empfand, war nicht nur Zorn, sondern auch Angst und Ausgeliefertsein. Das alles empfand auch meine Mutter, als sie am 20. Juli 1926 von einem Dampfer namens Cananova auf Ellis Island US-amerikanischen Boden betrat. Bei ihr kam aber anfangs noch Hoffnung dazu.
Meine Mutter, Melvine Love, war eine echte jamaikanische Schönheit von einundzwanzig Jahren: dunkle Augen, hohe Wangenknochen und eine schlanke Figur, die sie so gerade hielt, dass ihr Stolz und ihre Entschlossenheit niemandem entgehen konnten. Sie war eins von dreizehn Kindern einer Bauernfamilie in den Bergen von St. Ann Parish an der Nordküste der Insel, und ihre milchkaffeebraune Haut zeugte von ihrer gemischten Herkunft. Ihr Vater war ein schwarzer Farmpächter, ihre Mutter eine Weiße, Tochter eines Schotten, der als Plantagenaufseher nach Jamaika gekommen war. Das war nicht ungewöhnlich in der Karibik. Und nicht selten hatten in den großen Familien die Kinder unterschiedliche Elternteile. Einige Geschwister meiner Mutter hatten verschiedene Väter, was an ihrer dunkleren oder helleren Haut zu erkennen war, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Großvater in den Bergen der Umgebung auch noch etliche andere Sprösslinge hatte. Millie, wie meine Mutter genannt wurde, war eins der zehn Kinder ihrer Familie, die das Kindesalter überlebten. Auf Jamaika hatten sie nur die Aussicht auf ein armseliges Bauernleben, weshalb vier von Millies Geschwistern bereits nach New York gegangen waren; zwei davon erwarteten sie im Empfangsbereich. Meine Tante Liz trug einen schicken Hut und ein eng geschnittenes Wollkostüm. Das Kostüm sollte Eindruck machen, und tat es auch. Sie war in Begleitung meines Onkels Castel gekommen, der vermutlich wie ihr Chauffeur aussah; er besaß ein Auto, das er als Taxi nutzte. Er kutschierte Kunden nach Harlem, wozu sich anständige weiße Taxifahrer niemals bereit erklärt hätten – die ließen sich in Harlem überhaupt nicht blicken.
Millie, die im jamaikanischen Hinterland in einer Zweizimmerhütte aufgewachsen war, musste sich an Liz’ Arm festhalten, so eingeschüchtert war sie von den Massen drängelnder Menschen und hupender Automobile, die sie in Manhattan begrüßten. Eingeschüchtert und überwältigt. Aber es gab kein Zurück. Wenn Zweifel in ihr aufkamen, musste sie nur daran denken, woher sie gekommen war. Millie hatte von ihrer Mutter mithilfe einer kleinen Schiefertafel lesen und schreiben gelernt und davon geträumt, eine gebildete Frau zu werden. Als sie acht war, hatte sie die Tafel stolz ihrem Vater gezeigt, das Herz voller großer Erwartungen. »Schön, mehr brauchst du nicht«, hatte ihr Vater gesagt. »Jetzt kannst du vormittags deinem kleinen Bruder beibringen, es genauso gut zu machen, und nachmittags kannst du auf dem Feld mithelfen.« Eine Ausbildung? Was für eine verrückte Vorstellung! Jahre später bewunderte ich die perfekten Kurven und Striche ihrer schönen Schrift, das Einzige, was von ihren Mädchenträumen geblieben war.
Millies erste Taxifahrt führte sie zur Kreuzung 145th Street und 7th Avenue im westindischen Viertel von Harlem. Liz’ Wohnung befand sich in einem der besseren Gebäude des Blocks. Als sie mit ihrer jüngeren Schwester das Haus betrat, wurden sie von einer Nachbarin fröhlich begrüßt: »Hallo, Miz Hines.« Millie schaute sie neugierig an, sagte aber nichts, als sie die Treppe hinauf gingen und eine geschmackvoll eingerichtete Sechszimmerwohnung mit vier Schlafzimmern betraten. Erst hier bekam sie ein Wort heraus:
»Schön«, sagte sie. »Leben alle Leute in New York so?«
Liz erklärte, drei der vier Schlafzimmer seien untervermietet, auf die Weise könne sie die Miete bezahlen. Eins der Schlafzimmer hatte sie für Millie freigemacht, was, wie Liz kaum zu betonen brauchte, ein finanzielles Opfer darstellte. Millie könne dort wohnen, sagte Liz, bis sie selbst etwas gefunden habe. Liz lachte bei diesen Worten, und selbst Millie verstand, was sie damit meinte: Bis du einen Mann gefunden hast.
Millie war das neueste Mitglied einer Gruppe von Einwanderern innerhalb einer größeren Immigrantengruppe. 1926 konnten weiße New Yorker vermutlich keinen Unterschied zwischen den amerikanischen und den karibischen schwarzen Einwohnern von Harlem erkennen, vom besonderen Singsang der Insulaner vielleicht abgesehen. Und doch waren die Unterschiede beträchtlich. Amerikanische Schwarze hatten vor dem Bürgerkrieg zweihundert Jahre lang Sklaverei erduldet und litten seither unter der Rassentrennung. Die meisten hatten so lange in Armut gelebt, dass sie jede Hoffnung verloren hatten. Zwar kämpften sie noch immer dafür, diesem Leben voller Schmerz und Erniedrigung zu entkommen, hatten aber auch gelernt, sich damit zu arrangieren. Mit den Leuten aus der Karibik in Harlem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verhielt es sich ganz anders. Sie waren Einwanderer der ersten Generation, voller Ehrgeiz und Elan, sich ein besseres Leben aufzubauen. Ihre Vorfahren hatten als Sklaven oft unter noch brutaleren Bedingungen gelebt als die in den Südstaaten – mussten sich wie Maultiere zu Tode schuften –, aber genau deswegen hatten sie auch häufiger rebelliert und sich für die Flucht entschieden. Die Möglichkeit, sich durch angepasstes Verhalten eine bessere Behandlung zu erwerben, wie das manchen Sklaven im amerikanischen Süden gelungen war, hatte es für sie nie gegeben. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Rebellion sahen sich Spanien, Frankreich und England Mitte des neunzehnten Jahrhunderts dazu genötigt, die Sklaverei in ihren Kolonien abzuschaffen. Dass diese Staaten dann eine Schicht von fähigen Beamten ausbildeten, die als Aufseher auf den Plantagen ihrer anderswo lebenden Besitzer arbeiteten, reichte allerdings nicht aus, den rebellischen Geist der Kariben zu zügeln. Und so gestand man ihnen nach und nach die Unabhängigkeit zu, bis Mitte der Zwanzigerjahre den Schwarzen auf den Inseln der Weg offenstand, Landbesitzer, Anwalt oder Arzt zu werden. Auf einer der Inseln stellten sie sogar die Mehrheit dar. Die meisten waren immer noch arm, aber es fehlte ihnen nicht an Stolz und Zielstrebigkeit.
Viele von denen, die schließlich nach Harlem kamen, waren zunächst in Gulfport, Mississippi, gewesen, angelockt von Versprechen auf feste Arbeit, die sich zu einer neuen Art von Sklaverei entwickelte: Vertragsknechtschaft. Unternehmer ließen diese Leute ins Binnenland verfrachten, wo sie Zuckerrohr ernten, Baumwolle pflücken und in primitiven Baracken hausen mussten; Lebensmittel bekamen sie nur in betriebseigenen Läden, und ihr Lohn war so gering, dass sie sich unweigerlich verschuldeten. Den zähesten und entschlossensten von ihnen – entlaufene Sklaven wie ihre Vorfahren auf den Inseln – gelang die Flucht in den Norden.
Die karibischen Bewohner von Harlem waren demnach Leute, die sich von nichts und niemand daran hindern ließen, ihren Weg zu gehen. Die ausweglos erscheinende Armut, in der viele amerikanische Schwarze sich gefangen sahen, war für sie nicht hinnehmbar. Die amerikanischen Schwarzen ihrerseits nannten die Leute aus der Karibik die »Juden« ihrer Gemeinde. Auch wenn daraus ein gewisser Antisemitismus sprach, steckte mehr als nur ein Körnchen Wahrheit darin. Wie die Juden, die sich in anderen Gegenden von Harlem angesiedelt hatten, legten die Kariben Wert auf Bildung – Bildung als solche, aber auch als Mittel, der Armut zu entkommen. Wie die Juden hatten sie hochgesteckte Ziele. Und wie manche amerikanische Juden in den 1920er-Jahren, die auf legale Weise nicht ans Ziel kamen, schafften sie es auf illegale. Damals herrschte Prohibition, und viele Insulaner waren zwischen den karibischen Inseln und der Ostküste als Schnapsschmuggler unterwegs. Andere organisierten in Harlem illegale Lotterien. Millie muss das gleich mitbekommen haben, da auch Liz zusammen mit ihrem Freund Jimmy Hines eine betrieb.
Diese Art von Lotterie war erst vor Kurzem von ein paar Kariben erfunden und nach Harlem gebracht worden; Mitte der Zwanziger hatte sich daraus ein ungeheuer profitables – und illegales – Geschäft entwickelt. Die Idee war genial einfach: Man wettet auf die letzten drei Ziffern irgendwelcher an diesem Tag öffentlich bekannt gegebenen Zahlen. Zum Beispiel die Schlussnotierung der Börse. Oder der Saldo des Staatsbudgets. Am populärsten war die Gesamtsumme aller Wettgewinne des Nachmittags auf irgendeiner bestimmten Pferderennbahn. Alle diese Zahlen, in Dollar und Cent ausgedrückt, bestanden aus mehr als drei Ziffern, und die Spieler tippten auf die letzten drei – die natürlich am schwierigsten zu schätzen waren. Angenommen, die Summe aller Gewinne auf einer Rennbahn betrug 264,64 Dollar, dann lautete die Gewinnzahl der Lotterie 464. Alle drei in der richtigen Reihenfolge zu tippen, war extrem unwahrscheinlich – genau genommen standen die Chancen 1 zu 1000. Man konnte aber auch auf eine einzelne oder zwei Ziffern setzen – zum Beispiel die erste oder die ersten beiden –, womit natürlich nur kleinere Gewinne zu erzielen waren.
Als Lotteriebetreiberin hatte Liz ihre eigene Bank, das heißt, sie sammelte die Wettbeträge in den umliegenden Straßen ein. Jeden Morgen schwärmten ihre Läufer im Viertel aus und klopften an jede Tür. »Was setzen Sie heute, Mrs. Davis?« »Ich nehme drei-vier-eins zu fünfundzwanzig Cent.« Der Mindesteinsatz war so gering, dass fast alle wetteten. Und jeder...