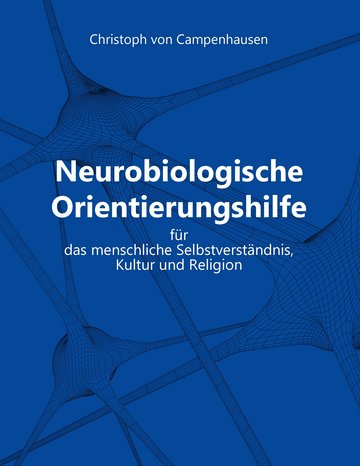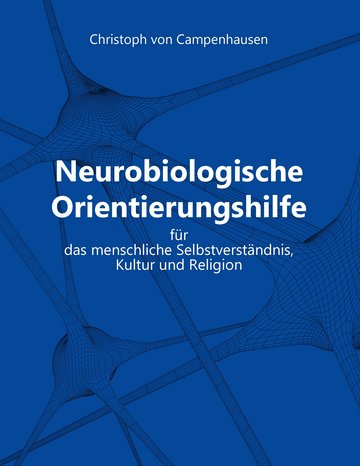I. Vom Einfluss der Neurobiologie auf das menschliche Selbstverständnis
1. Menschen, Tiere und Maschinen
Zoologen sind Glückskinder. Sie können davon ausgehen, dass sich fast alle Menschen für ihre Wissenschaft interessieren. Die einschlägigen Schriften von Aristoteles (384–322 v. Chr.) bis hin zu Brehms und Grzimeks Tierleben aus dem 19. und 20. Jahrhundert werden auf der ganzen Welt in vielen Sprachen gelesen. Im Fernsehen erzielen Tiersendungen hohe Einschaltquoten. Tiere waren für Menschen schon immer wichtig – als gefährliche Feinde, als mögliche Beute und seit einigen Jahrtausenden auch als gezähmte Nutztiere. Zu Hunden, Pferden und anderen Haustieren entwickeln Menschen freundschaftliche Beziehungen. Sie sprechen mit ihnen wie mit kleinen Kindern. Sie beobachten hingebungsvoll ihre artspezifischen Besonderheiten und lassen sich auch gerne darüber belehren. Dass es Unterschiede zwischen Menschen und Tieren gibt, bestreitet niemand. Unterschiede schließen aber Gemeinsamkeiten nicht aus.
Auf die lächerliche Ähnlichkeit von Affen und Menschen muss man niemanden aufmerksam machen. Das sehen Kinder im Zoo schon von alleine. Bereits Aristoteles fand gute Gründe dafür, den Menschen in das System der Tiere einzuordnen. Spätere Gelehrte konnten die Richtigkeit dieser Entscheidung immer nur bestätigen. Heute kann man die genetische Verwandtschaft durch Untersuchung der Erbinformation studieren, die bei allen Lebewesen, die man kennt, in Nukleinsäure-Molekülen verschlüsselt ist. Was Menschen mit anderen Lebewesen gemeinsam haben, kann man mit naturwissenschaftlichen Methoden erforschen.
Was die Menschen von den anderen Lebewesen unterscheidet, beruht auf Überlegungen anderer Art. Immer schon wird den Menschen eine Sonderstellung in der Natur zugeschrieben. Als Begründung werden in der Regel ihre geistigen Fähigkeiten angeführt. Prägend ist aber auch das nicht weiter hinterfragte überlieferte kulturelle Selbstverständnis der Menschen. Die Anfänge kann man bis in älteste Schöpfungsmythen der Menschheit zurückverfolgen. In der Bibel wird der Mensch als Gottes Ebenbild gedeutet.2 Damit wird seine Sonderstellung in der Natur begründet. Daraus folgt u. a., dass man Menschen nicht töten darf.3 In abendländischen Kulturen sind die meisten Menschen von ihrer singulären Einzigartigkeit in so hohem Maße überzeugt, dass ihnen alles, was Menschen mit Tieren verbindet, unwichtig zu sein scheint. In dieser geistigen Tradition gelten Vergleiche von Mensch und Tier als wenig aufschlussreich und schon eher als Angriff auf die Menschenwürde. Die wissenschaftlichen Fächer, die diese kulturelle Einstellung pflegen oder wenigstens begünstigen, werden oft unter der Sammelbezeichnung Geisteswissenschaften4 zusammengefasst.
Dass Tiere und Menschen manches gemeinsam haben und sich trotzdem in anderer Hinsicht unterscheiden, ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Trotzdem wollen manche Denker unbedingt eine klar definierte Grenze zwischen Tier und Mensch ziehen. Davon erhoffen sie sich Argumente für die Sonderstellung der Menschen in der Welt sowie für eine angemessene Regelung ihres Umgangs mit Tieren, den Tierschutz oder die Frage nach Tierrechten in Analogie zu Menschenrechten. Auch Männer und Frauen haben vieles gemeinsam, obwohl sie genetisch, morphologisch und in ihrem Verhalten mehr oder weniger verschieden sind, so dass die subjektive und die rechtliche Zuordnung manchmal zum Problem wird. Leider kann man die Genderprobleme und übrigens auch den Rassismus und den Sexismus nicht aus der Welt schaffen, indem man entweder die real existierenden Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten leugnet.5
Um Klarheit zu schaffen, befragt man gern die Wissenschaft. Aber von dort kommt bis jetzt kaum Hilfe. Es gibt vielmehr zwei entgegengesetzte akademische Ansichten, eine zoologische, in der die biologischen Gemeinsamkeiten von Tieren und Menschen den Vorrang vor den Unterschieden genießen, und eine abendländisch-kulturelle, nach der die prinzipielle Verschiedenheit allen Gemeinsamkeiten vorgeordnet ist. Eine weiterführende Sicht auf das Tier-Mensch-Verhältnis ist erstrebenswert. Die Verständigung zwischen den Vertretern der Natur- und Geisteswissenschaften ist allerdings erfahrungsgemäß schwierig. Jede wissenschaftliche Disziplin beansprucht für sich die Deutungshoheit in grundsätzlichen Angelegenheiten. Man sollte aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich neue Ansätze für einen interdisziplinären Gedankenaustausch finden lassen, die mehr Klarheit in die Beziehung zwischen Mensch und Tier bringen. Dazu will diese hoffentlich allgemeinverständliche Abhandlung einen Beitrag leisten.
Die Menschen haben sich immer schon für die Zusammenhänge und Unterschiede von Mensch und Tier interessiert. So wurde beispielsweise die Darstellung menschlicher Charaktere in der Gestalt von Tieren zu einer hohen Kunst entwickelt. Man denke nur an die Fabeln des Äsop (um 600 vor Christus), von Jean de la Fontaine (1621–1695) oder an die mittelalterlichen Geschichten von Reineke Fuchs, die Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) nachdichtete. In diesen menschlichen Tiergeschichten kommen die verbindenden und trennenden Eigentümlichkeiten von Menschen und Tieren gleichermaßen zum Vorschein. Auch die bildende Kunst kennt Mischwesen aus Menschen und Tieren wie die Sphinxe, Kentauren oder Meerjungfrauen mit Fischschwanz. Bewusstsein und Geist wurden immer schon nicht nur den Menschen zuerkannt, sondern auch bei Tieren vermutet. Poeten und Tierfreunde reden deshalb unwidersprochen von Angst, Freude und Schmerz der Tiere wie auch von ihren Befindlichkeiten wie Hunger und Durst, Mutterliebe oder Bewusstsein.
Heute benutzen auch die Verhaltensforscher diese menschliche Terminologie. Sie wissen, dass man am Seelenleben anderer Lebewesen nicht unmittelbar teilnehmen kann. Der subjektive Lebensbereich ist bekanntlich eine individuelle Privatangelegenheit, jedenfalls von außen nicht einfach einsehbar. Wenn man sich vorstellen will, wie anderen zumute ist, was sie denken und fühlen, muss man noch immer von den eigenen subjektiven Erlebnissen auf die der anderen schließen. Das gilt für die Mitmenschen, für Tiere und sogar für Maschinen. Es gibt bekanntlich lernende Automaten mit Informationsspeichern und der Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen. Auch bei diesen Geräten ist die innere Informationsverarbeitung von außen nicht erkennbar. Darum können Schach-Computer ihre menschlichen Gegner überlisten und schlagen. So gibt es auch zwischen Lebewesen und Maschinen nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten.
Wenn man die Unterschiede zwischen Maschinen und Menschen suchen möchte, sollte man nicht bei den molekularen Vorgängen in den lebenden Zellen anfangen. Diese kann man nämlich von unbelebten Prozessen nicht unterscheiden. Die Herstellung einer künstlichen Zelle mit Eigenschaften, die man von natürlichen Zellen kennt, wäre beim heutigen Stand der Forschung ein experimentelles Kunststück, aber nicht unmöglich. Unter dem Stichwort „Synthetische Biologie“ wird darüber diskutiert. Es gibt bereits viele erfolgreiche von der Natur kopierte molekulare Maschinen und genetisch veränderte Lebewesen, die dem Menschen dienen, z. B. bei der Herstellung bestimmter Chemikalien. Weil ihre Herstellung viel Geld kostete, möchte man die Eigentumsrechte an ihnen schützen. Ob man Lebewesen patentieren darf, ist allerdings umstritten.
Zur Bestimmung der Unterschiede von Maschinen und Menschen muss man nach anderen Ansätzen suchen. Von Maschinen kennt man für gewöhnlich einen Konstruktionsplan und den Zweck, für den sie gebaut wurden. Weil somit Sinn und Zweck von Maschinen normalerweise bekannt sind, kann man prüfen, ob sie die vorgesehenen Aufgaben dem Zweck entsprechend erfüllen. Je nach Ergebnis kann man sie benutzen, reparieren oder mitleidlos entsorgen. Dass das beim Umgang mit Menschen nicht üblich ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Es lässt sich aber auch begründen.
Tatsächlich kennt man von den Menschen und allen anderen Lebewesen weder den Ursprung noch Sinn und Zweck ihrer Existenz. Das muss man nicht als Mangel auffassen. Es ist vielmehr die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich selbst über den Sinn ihres Daseins Gedanken machen und dass sie ihre vorfindlichen Begabungen weiterentwickeln können. Man wüsste selbstverständlich gerne, worin Sinn und Zweck des Menschseins bestehen. Die Frage danach ist aber letztlich unsinnig, weil sie zu keiner erschöpfenden Antwort führen kann. Niemand kann genau wissen, warum und wozu es Menschen gibt. Weil eine vollständige Instruktion dazu nicht zu haben ist, sollte man für teilweise Einsichten dankbar sein. Sie sind besser als gar nichts und reichen trotz ihrer Unvollständigkeit bereits für wichtige Folgerungen aus. Offensichtlich kann und soll man Menschen nicht instrumentalisieren, d. h. man soll Menschen nicht wie Maschinen verwenden und ausbeuten, so als ob man genau wüsste, warum und wofür sie existieren. Selbst wenn...