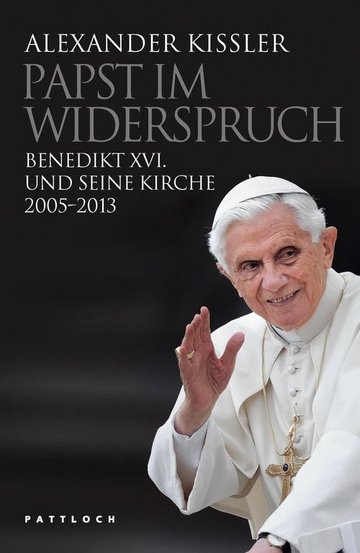Mystiker aus Einsicht
Wie Joseph Ratzinger die Welt sieht
Ein Stellvertreter dankt ab. Ein Heiliger Vater gibt die Vaterschaft zurück. Ein Papst kappt dem Papsttum die monarchische Spitze. All dies geschah am Vormittag des 11. Februar 2013 zu Rom, als Benedikt XVI. den versammelten Kardinälen auf Lateinisch erklärte: Genug ist genug. Fortan will ich nur noch beten, fernab der Welt. Meine Kräfte schwinden. Fortan auch wird man die Geschichte der Kirche in ein Davor und ein Danach einteilen, und Joseph Ratzingers kühne Tat wird das Scharnier sein.
Was hatte er da eben gesagt? Haben uns unsere Ohren getrogen? »Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.« Niemand hat damit gerechnet, wohl niemand ist in diesen einsamen Entschluss eingeweiht gewesen. Auf den 10. Februar 2013 datiert das Papier, das da der Mann, der bald kein Papst mehr sein würde, vorträgt: »Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin- und hergeworfen.«
Ein »Aber« steht zwischen der Option Johannes Pauls II., die Joseph Ratzinger aus nächster Nähe mitverfolgt hatte, und der Option Benedikt. Der Vorgänger starb im Amt, machte das öffentliche Siechtum zu einem Lehrstuhl des Leidens, einem weltweit bewunderten Magisterium der Schmerzen in Christi Namen. Er opferte seinen Leib vor aller Augen auf, so wie er unzählige Male den Leib Christi in der Messe aufgeopfert hatte. Er wurde christusähnlich in gebückter, starrer, stummer Gestalt. Joseph Ratzinger stand daneben und fasste vielleicht in jenen Tagen schon den Entschluss: So soll es mir einmal nicht ergehen.
Das »Aber« erklärt den Grund: Nicht weil Leid entstellt, weil Sterben ein intimer Vorgang ist, weil die Qual dem Amt nicht geziemt. Nein, allein weil die Welt »heute«, anno 2013, sich noch schneller verändert als zu Beginn des Jahrtausends, weil die »Fragen«, die sie dem christlichen Glauben aufgibt, noch gewaltiger sind. In einer solchen Situation muss sichergestellt sein, was Benedikt fast genau ein Jahr vor seiner Rücktrittsankündigung, im Februar 2012, ebenfalls vor den Kardinälen für sich erbat: »… dass ich dem Volk Gottes immer das Zeugnis der sicheren Lehre geben und mit milder Festigkeit das Steuer der heiligen Kirche führen kann.« Auf rauher See braucht es einen starken Steuermann.
Zwölf Monate danach fuhr der Pontifex fort: Um »das Schifflein Petri zu steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig, eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen«. So lautet die offizielle deutsche Übersetzung. Der Kern der Sache war, wie es im Original hieß, eine doppelte Art von »vigor«, von Kraft, die rapide geschwunden sei, »vigor quidam corporis et animae«. Die Kraft des Körpers war gemeint, ganz fraglos, und der »vigor animae«, ein schillernder Begriff. »Anima« meint Seele, meint das Lebensprinzip, die Lebenskraft, eben nicht nur den Geist. Somit sind es nicht Konzentrationsschwächen oder Erinnerungslücken, sondern schwächer und schwächer werdende Lebenskräfte, die Benedikt den Rücktritt unausweichlich erscheinen ließen. Er spürte, wie das Leben sich aus ihm zurückzieht. Darum zog er sich vom Amt zurück, zog um in das Reich der Stille.
»Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes«, hieß es sodann, »erkläre ich daher mit voller Freiheit, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, so dass ab dem 28. Februar 2013, um 20.00 Uhr, der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird.« Nur frei darf eine solche radikale Entscheidung – wenn überhaupt – getroffen werden. Das Kirchenrecht will es so. Niemand hat Benedikt dazu drängen dürfen, niemand hat es vermutlich getan. Er gibt ein Amt retour, das ihm durch Wahl übertragen worden ist, ein Dienstamt, das ohne Weihe auf ihn überging. Er hat sich nie danach gedrängt, sprach unmittelbar nach der Wahl vom »Fallbeil«, das auf ihn herabgefallen sei, und bat um das Gebet, »dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe«. Nun schnitt er selbst das Seil zwischen Amt und Person durch – solange er sich dazu noch imstande fühlte.
Warum aber sollte der Rücktritt des 85-Jährigen erst 17 Tage später gültig werden, exakt um 20 Uhr? War es ein zufälliges Datum, gewählt aus Rücksicht auf die vatikanische Bürokratie, die bald ein Konklave würde vorbereiten müssen? Verbarg sich dahinter Zahlensymbolik? Viele Rätsel gab dieser Rücktritt auf, der die Grundfeste des Papsttums nachhaltig erschüttern könnte: Werden künftige Nachfolger Petri damit rechnen müssen, dass man ihnen unter tadelndem Verweis auf den 11. Februar 2013 den Rücktritt nahelegt, sobald diese oder jene Dinge sich in die – je nach Blickwinkel – falsche Richtung entwickeln? Wird so der »Vicarius Christi« entmythologisiert, entzaubert, demokratischer, gewöhnlicher?
Kein Rätsel ist indes das seelische Procedere, das Benedikt zu diesem radikalen Entschluss geführt hat. »Wiederholt« hat er sein Gewissen vor Gott geprüft. Den Ruf des Gewissens zu vernehmen, ist das eine. Ihm zu folgen, demütig und entschlossen zugleich, das andere. Benedikt XVI. tat es, weil ihm der Blick nach innen keine Ausnahme war in Grenzsituationen, sondern die menschliche Regel. Er war ein Mystiker auf dem Papstthron. Der Kernsatz des romantischen Dichters Novalis war ihm Programm: »Nach innen geht der geheimnisvolle Weg.« Natürlich wäre es ein Irrtum, sich Benedikt XVI. als verzückungsbereiten Charismatiker vorzustellen, nur weil er tatsächlich ein Mystiker war. Ja, mystisch war das Koordinatensystem Benedikts. Er schätzte die Vernunft, diesen göttlichen Schöpfungsfunken, viel zu hoch ein, als dass er sie zum Universalschlüssel für alle Probleme herabwürdigen wollte. Er kannte die Schranken von Ich und Vernunft, die beide, um zu dauern, verwandelt werden müssen in liebende Erkenntnis, erkennende Liebe. Was wäre eine Vernunft wert, was ein Ich, wenn sie spurlos zerfielen beim letzten Atemzug? Nur was im Sterben trägt, trägt im Leben, und das ist nun einmal jenes große, sich uferlos verschenkende Geschenk, die Liebe: Davon war Benedikt XVI. durchdrungen. Darum war er Mystiker, darum sah er im Kontinent der Seele das menschliche Königtum verbürgt, das kein Tod zuschanden machen kann.
Sucht man nach dem kleinsten homiletischen Nenner dieses fast achtjährigen Pontifikats, so stößt man auf die drei Wörtlein »von innen her«. Sie waren zentral für die Verkündigung Benedikts. Das Hören und Annehmen des Wortes Gottes verwandle »von innen her«, der Heilige Geist animiere »von innen her«, Jesus habe »von innen her« auf die Abschiedsstunde am Gründonnerstag gewartet. Seit damals wolle er »den Menschen retten durch die innere Befreiung vom Bösen, durch eine Umwandlung von innen her«. Christen seien aufgerufen, ihr »Leben von innen her umzuarbeiten«, »von innen her neu zu werden«, besonders mit Hilfe der Eucharistie, durch die Christus »in jeder Generation sein Reich von innen her« aufbaue und die darum »von innen her mitzufeiern« sei. Vorbilder auf diesem Weg seien die Heiligen, die sich »gleichsam von innen her ausgestreckt« haben auf Christus. In seiner vorletzten Generalaudienz am 13. Februar 2013 bekräftigte er einmal mehr: »Unser innerer Mensch muss sich darauf vorbereiten, von Gott aufgesucht zu werden.«
Woher stammt die stete Mahnung zum Perspektivenwechsel, zum Blick nach innen, der keine Nabelschau werden darf? Benedikt XVI. war Mystiker aus Einsicht, nicht aus Ekstase. Er kannte die Gefahren einer verzärtelten, verkitschten Mystik ebenso wie die Abgründe einer halbierten Vernunft. Keinen Widerspruch erhöbe er gegenüber Gilbert Keith Chesterton, der den »Kult um den ›Gott im Innern‹ (…) von allen schrecklichen Religionen die schrecklichste« nannte; »dass Meier den Gott in seinem eigenen Innern anbeten soll, läuft letztlich darauf hinaus, dass Meier Meier anbetet«. Bei Chesterton findet sich auch die nicht minder wichtige Erkenntnis, »dass nur das Mystische überhaupt eine Chance hat, vom Volk verstanden zu werden«. Chesterton ergänzte seine Ablehnung eines ganz unchristlichen Innerlichkeitskults deshalb um ein Stoppschild zur anderen, zur rationalistischen Seite hin: Sogar das Licht der Vernunft könne in die »heillose Verzweiflung« führen und der Verstand in die Irre; »das heidnische Ideal vom einfachen und rationalen Weg zur Vollkommenheit« sei gottlob Geschichte. Ein solcher Fortschritt wäre ein Trugschluss und eine Blasphemie, ein ewiger Komparativ ohne anerkannten Superlativ.
Vor genau dieser Projektion warnte Benedikt XVI. in seiner zweiten und wichtigsten Enzyklika, »Spe salvi« von 2009: »Wenn dem technischen Fortschritt nicht Fortschritt in der moralischen Bildung des Menschen, im ›Wachstum des inneren Menschen‹ entspricht, dann ist er kein Fortschritt, sondern eine Bedrohung für Mensch und Welt.« Als sich Benedikt im Herbst und Winter 2010 bei den Generalaudienzen mit herausragenden Frauen der Kirchengeschichte beschäftigte, überwogen die Mystikerinnen –...