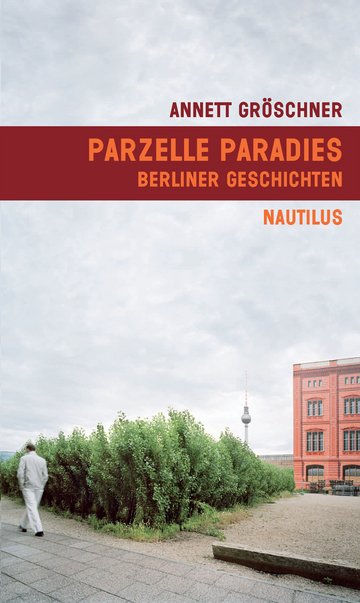Stadtlandschaft. Bruchstücke. Straßenbahnfahrten
»Es ist noch früh am Morgen. Paul krabbelt aus seinem Bettchen, weil er nicht mehr schlafen kann. Es muss wirklich sehr früh sein, denn überall ist es so still.«
Es wird das ganze Buch über still bleiben. Denn Paul bemerkt schnell, dass er ganz allein ist auf der Welt. Keine Mama, kein Papa, keine Milchfrau. Er braucht sich nicht zu waschen und findet es herrlich, allein in der Stadt herumlaufen zu können, er probiert alles aus, fährt Straßenbahn, plündert die Geschäfte. Aber irgendwann wird es langweilig, schließlich unheimlich. Am Ende war alles nur ein Traum.
Das kleine Bändchen Paul allein auf der Welt fand ich als Kind im Glasschrank meiner Großeltern. In der hintersten Ecke neben Karl May und Stalin, die meine Großmutter dorthin verbannt hatte, weil sie in den Sechzigerjahren in der DDR nicht mehr opportun waren und sie aus unerfindlichen Gründen immer Angst vor Hausdurchsuchungen hatte. Paul allein auf der Welt konnte nur aus Versehen nach hinten gerutscht sein. Ich habe das Exlibris meines Onkels durchgestrichen und meinen Namen darübergeschrieben. Den Namen des Autors kann ich mir bis heute nicht merken. Ich muss auf den Einband schauen, um ihn abzuschreiben: Jens Sigsgaard. Viele Bücher habe ich im Laufe meines Lebens verborgt und nicht wiederbekommen oder bei den diversen Umzügen verloren. Meine Kinderbücher stehen im Zimmer meines Sohnes. Paul allein auf der Welt habe ich für mich behalten.
»In diesem Moment hörte ich ihn aus der Richtung des großen Sessels fragen, ob ich auch mein Lieblingskinderbuch in einer solchen Art in Hirn und Herz habe wie er und auch den Wunsch, einmal so einfach und wunderschön schreiben zu können; mein ›Ja‹ kreuzte sein ›Bei mir ist es …‹, so dass wir plötzlich wie aus einem Mund den Titel sagten: Paul allein auf der Welt«, erinnert sich Thomas Brasch an einen in der Dunkelheit sitzenden Heiner Müller. Auch Inge Müller, hatte ich in ihrem Nachlass entdeckt, wollte das Buch fürs Theater bearbeiten. Sie muss, so zeigen die Versuche, daran gescheitert sein. Ich hatte vorher immer geglaubt, ich wäre allein mit Paul allein auf der Welt, das unter Gleichaltrigen niemand kannte. Dass ausgerechnet dieses kleine unscheinbare Bändchen, 1949 im Altberliner Verlag Lucie Groszer erschienen, die mir wichtigen Autoren und mich verband, hätte ich nie zu ahnen vermocht. Vielleicht war es die Verbindung von Einsamkeit und Stadt, die dieses Buch zu meiner ältesten Lieblingslektüre machte.
Erwachsen bin ich geworden, als ich entdecken musste, dass man nicht immer in einem warmen Bett aufwacht, wenn man gegen den Mond stößt.
Ich kann nicht von Vorbildern reden. Vorbilder sind mir schon als Thälmannpionier lästig gewesen, weil sie immer so einen Heiligenschein mit sich herumtrugen und offensichtlich immer nur die anderen die Fehler machten. Es gibt Autoren, die ich schätze. Es gibt Autoren, an denen ich mich abarbeite. Viele von ihnen sind Autorinnen. Was mir auffällt, ist ihr alles in allem tragisches Ende. Sie drehten den Gashahn auf, soffen sich zu Tode oder starben im Exil. Schon deswegen taugen sie nicht als Vorbilder.
Ich habe auf traditionelle Art Germanistik studiert. Am Anfang des Studiums bekamen wir eine Liste der Bücher, die wir im Laufe unseres auf fünf Jahre begrenzten Studiums lesen sollten. Es war die gesamte deutsche Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Alles zu lesen, hätte bedeutet, nur aus zweiter Hand zu leben. Ich lebte zwei Leben. In meinem zweiten strich ich durch die Stadt. Durch die halbe.
»Manchmal in der Dämmerung, im abnehmenden Licht, das jetzt jeden Tag früher von Hausschatten, Nebelnetzen verstellt wurde, wäre sie bedenkenlos mitgegangen, hätte einer sie über die Grenze bringen wollen, einfach aus Überdruss, ohne viel Hoffnung, sich zu verbessern.«
Ich wollte nie eine Autorin sein, die am Schreibtisch sitzt und über eine Frau schreibt, die am Schreibtisch sitzt und darüber schreibt, wie eine Frau am Schreibtisch sitzt. (Es gibt unterhaltsamere Berufe. Berufe, die mehr Anerkennung versprechen. Wo man an der Luft ist. In Mengen von Leuten badet. Den Zuspruch nicht erst bekommt, wenn man längst an anderem sich abarbeitet. Wenn es überhaupt Reaktionen gibt. Und wieder mal weiß ich nicht, wovon wir morgen leben sollen.) Ich könnte nie einsam in einem Haus auf dem Land sitzen und vor mich hinschreiben. Ich brauche die Stadt. Ich muss von einer Sekunde auf die andere den Schreibtisch verlassen und durch die Menge streichen können.
Als ich Anfang der Achtzigerjahre nach Berlin kam, faszinierten mich die Narben der Häuser. Einschüsse, Luftschutzzeichen, Notdächer. Ich sah eine einzige Katastrophe, die Trümmer auf Trümmer gehäuft hatte und die zum Stillstand gekommen war. Wie eingefroren. Die Gedichte Inge Müllers waren die Brücke zwischen meiner Mutter und mir. »Als ich Wasser holte fiel ein Haus auf mich / Wir haben das Haus getragen / Der vergessene Hund und ich. / Fragt mich nicht wie / Ich erinnere mich nicht. / Fragt den Hund wie.« Ich konnte plötzlich nachvollziehen, wie ein Mensch reagiert, der als Kind unter der Last einer Kirche verschüttet war, und für den der Krieg nie wirklich zu Ende ging. Als Kind bin ich an der Hand meiner Mutter über die enttrümmerten Flächen meiner Heimatstadt gelaufen und wusste nicht, dass sie durch unsichtbare Häuser ging. Ihre Angst vor Flugzeugen, Sirenen, Feuer, Enge und ihr Bedürfnis, immer und überall ein Nest mit Vorräten anzulegen, kannte ich. Erst in Berlin und erst in den Texten Inge Müllers ist mir das alles bewusst geworden und Teil meines Schreibens, das auch darin besteht, andere sprechen zu lassen, die meinen, nichts zu sagen zu haben.
»Das Labyrinth ist der richtige Weg für den, der noch immer früh genug am Ziel ankommt. Dieses Ziel ist für den Flaneur der Markt.«
»Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Menschengesichter, Auslagen, Schaufenster, Caféterrassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lauter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben.«
Als ich die Flaneure entdeckte, eignete sich Berlin ganz und gar nicht zum Spazierengehen. Die Stadtlandschaft war unterbrochen von Mondlandschaften, durch die man wie durch eine Wüste ging, im Hintergrund eine Fata Morgana oder das nächste Haus, das Menschen versprach und das Versprechen oft nicht hielt. Erst als ich in Paris lebte, habe ich die Flaneure in ihrem ruhelosen Spaziergang verstanden. Eines Tages stand ich in einer Straße in der Nähe des Jardin du Luxembourg. An einem kleinen unscheinbaren Gebäude hing eine Tafel. Es war das Haus, in dem Joseph Roth gelebt hatte, nachdem er Berlin verlassen musste. Unten immer noch die Kneipe, in der er sich ins Grab gesoffen hatte. Die leer getrunkenen Gläser stapelte er zu Türmen, bis sie umfielen.
In Berlin lässt es sich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln flanieren.
»… im Trab gehalten auf den Kursen von Bussen, Bahnen auf der Straße, unter den Straßen und Häusern, verhielt er sich anfangs wie ein Nichtschwimmer, stieg überhastet aus zu hoffnungslosen Irrwegen, ließ lahm sich abdrängen an den dick umstandenen Bushaltestellen.«
Als ich nach Berlin kam, stieg ich oft in die falsche Straßenbahn. Ich habe es mir schließlich zur Gewohnheit gemacht, auf diese Art die Stadt kennenzulernen. Auch andere Städte. In Westberlin musste ich den Bus nehmen, weil sie die Straßenbahn abgeschafft hatten.
»Ich habe ein Abonnement auf einen Traum, und der geht so: Ich renne mit aller Kraft aus dem Haus. Der Omnibus hält vor meiner Tür. Ich stürze in den Omnibus. Es ist der letzte Omnibus, wie man so sagt, er fährt an – in Richtung Bahnhof Friedrichstraße. Und ich sitz drin und fahre. Allerdings war es kein Omnibus. Es war die Straßenbahn 46, die vor meinem Haus hielt, und ich musste zehn Minuten warten, bis sie kam, denn ich hatte mich, schwitzend und ein wenig zähneklappernd vor Angst und Eile, verfrüht. Aber das ist dem Traum egal und mir auch.«
Die Straßenbahn Nr. 46 quietschte immer in den Kurven, vor allem an der Zionskirche. Mit der 46 fuhr ich zur Uni. Ich ging lange einer Biografie nach und musste schließlich, nach Jahren, erkennen, dass nie das wirkliche Leben dabei herauskommen wird. Es bleiben immer Leerstellen, und je dichter das Netz der Stichpunkte wird, der Chronik, desto unsichtbarer wird die Person, die dahintersteht.
Ich war Literaturhistorikerin und glaubte, wissenschaftlich an die von mir bevorzugten Autorinnen und Autoren herangehen zu müssen. Bei dieser Arbeit kam ich auf die Archäologie und ließ schließlich die Autoren und meinen Beruf an der Oberfläche zurück. Bei der Archäologie bin ich geblieben.
»… die Brandmauer neben den Geleisen und die jedes Mal...