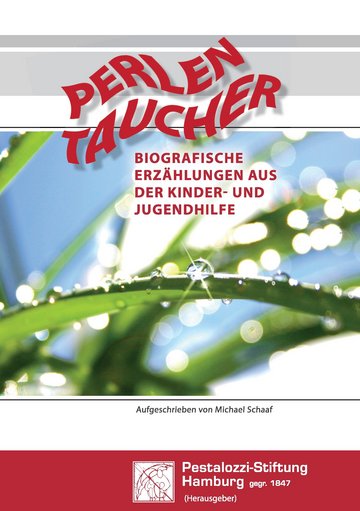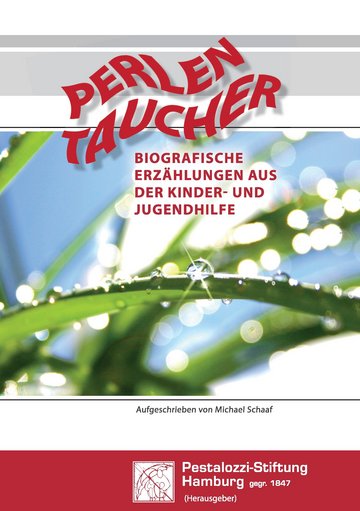Klaus
Im »Wohnhaus Wandsbek« in Eilbek ist es friedlich still. Von den zehn Jugendlichen zwischen vierzehn und einundzwanzig Jahren, die hier eine Vollbetreuung rund um die Uhr erfahren, sind nur zwei anwesend. Die Besichtigung der stationären Wohngruppe offenbart, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner ein Einzelzimmer hat. Die Badezimmer müssen geteilt werden. Es gibt eine riesige Küche und einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Sofas, Fernseher, PC-Platz und einer Sitzecke. Dort findet das Gespräch mit Klaus S. statt. Er steht als Leiter dieser Einrichtung einem Team von neun pädagogischen Mitarbeitenden und einer Hauswirtschafterin vor. Zum Wohnhaus gehören zudem benachbarte Apartments für fünf weitere ältere Jugendliche und Jungerwachsene, die von den Mitarbeitenden auf dem Weg in die Selbständigkeit begleitet werden.
Klaus ist 1955 in Altona geboren und erst mit einundvierzig Jahren von der Pestalozzi-Stiftung Hamburg fest eingestellt worden. Warum erst so spät der Einstieg in die stationäre Jugendhilfe, obwohl er doch die Fachoberschule für Sozialpädagogik in der Uferstraße besucht hatte?
»Danach musste ich erst einmal zum Bund, habe den Wehrdienst aber nach fünf verschenkten Monaten verweigert und bin in den Zivildienst gewechselt, wo ich im Karl-Sonnenschein-Haus der Caritas Obdachlose betreut habe. Im Anschluss habe ich als Angestellter in der Tätigkeit eines Erziehers im Haus der Jugend Alter Teichweg gearbeitet, sechs Semester Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Politik studiert und war zehn Jahre als selbständiger Taxiunternehmer tätig. Ehrenamtlich hatte ich bereits in der Jugendhilfe gearbeitet, als ich über Honorartätigkeiten zur Stiftung kam und 1996 fest angestellt worden bin. Das war eine sehr gute Entscheidung, diese Anstellung anzunehmen, denn diese Form der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wollte ich schon immer machen. Auch wenn die anfänglichen Vierundzwanzig-Stunden-Schichten ziemlich anstrengend gewesen sind. Da meine Frau ebenfalls gearbeitet hat, war es gut, dass unsere Jungs zu der Zeit schon siebzehn und sechzehn Jahre alt und ziemlich selbständig waren. So konnten wir Arbeit und Familie gut vereinbaren.«
Heute wird im Wohnhaus noch immer im Schichtdienst gearbeitet, allerdings in zwei Schichten von zehn bis achtzehn Uhr und von achtzehn bis zehn Uhr. Die Nachtschichten sind wichtig, oft ergeben sich in dieser ruhigen Zeit intensive Gespräche, die am Tag nicht geführt werden können. Es sind jeweils eine Pädagogin oder ein Pädagoge und in den Kernzeiten die Hauswirtschafterin anwesend. Da Teamarbeit demzufolge nicht im gemeinsamen Handeln erfolgen kann, sind Absprachen, Übergaben und der kollegiale Austausch in den wöchentlichen vierstündigen Dienstbesprechungen von besonderer Bedeutung. Gemeinsame Regeln aufzustellen ist wichtig, aber die Mitarbeitenden sind in ihren Schichten auf sich alleine gestellt und müssen der Situation angemessen ihre Entscheidungen treffen. Da bedarf es neben den pädagogischen Fähigkeiten auch einer stabilen Psyche, Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen. Erfahrung hilft. Und davon hat Klaus eine ganze Menge. Manchmal, sagt er, muss man das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Was heißt das?
»Wir haben im Team beschlossen, dem fünfzehnjährigen Felix die Playstation für zwei Tage zu entziehen, weil er nachts nicht davon loskam und die Schule geschwänzt hat. Das Problem war, dass Felix sie so gut versteckt hatte, dass wir sie nicht gefunden haben. Als eine Kollegin ihn tagsüber mit einem Freund in seinem Zimmer beim Spielen erwischt hat, ist sie trotz Absprache nicht sofort dazwischengegangen und hat das Ding einkassiert. Sie wusste, dass Felix sehr aggressiv werden kann. Wenn die Kollegin ihm vor seinem Freund sein Spielzeug weggenommen hätte, wie eine Mutter ihrem kleinen Kind, wäre der Tag gelaufen gewesen. Stattdessen hat sie ihn nach der Verabschiedung seines Freundes angesprochen und ihm erklärt, warum die Schule für ihn wichtiger sein sollte als seine Playstation-Karriere. Die daraufhin erfolgte freiwillige Einschränkung des Spielens aus Einsicht hatte eine wesentlich nachhaltigere Wirkung als ein bestrafendes Verbot. Insofern hat die Kollegin alles richtig gemacht, obwohl sie den Teambeschluss nicht direkt umgesetzt hat. Im Wohnhaus gibt es wenige Regeln, aber viel Verhandlungsmasse.«
Wenn die betreuten Jugendlichen die »Machtfrage« stellen, das heißt, infrage stellen, dass ihre neuen pädagogischen Bezugspersonen im Wohnhaus ihnen etwas zu sagen haben, wird es schwierig. Der kollegiale Austausch im Team, Fallbesprechungen und Supervision helfen, das pädagogische Handeln professionell zu hinterfragen und zu reflektieren, sich über seine eigenen Gefühle und Handlungsoptionen klar zu werden. Klaus versteht die Kinder und Jugendlichen, die nach einer Inobhutnahme durch das Jugendamt in stationären Einrichtungen wie dem Wohnhaus aufgenommen werden.
»Warum sollen sie uns auf Anhieb mögen oder tun, was wir ihnen sagen? Erst einmal müssen wir ihnen zeigen, dass wir sie als Individuen ernst nehmen, mit all ihren Sorgen und Nöten. Es ist doch erstaunlich, dass diese jungen Menschen, die schon so viel durchgemacht haben, so starke Persönlichkeiten sind. Sie haben teilweise sehr großes Leid erfahren. Da muss man Respekt vor ihrer Lebensleistung haben, ehrlich. Und natürlich machen wir im Umgang mit ihnen nicht immer alles auf Anhieb richtig. Wir haben schließlich keinen Zauberstab in der Tasche. Aber wenn wir uns dann entschuldigen und einen Fehler zugeben, wundern sich die Kids. Das kennen sie nicht von anderen Erwachsenen. Da muss man sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein. Ich möchte kein Freund für die uns anvertrauten Menschen sein, sondern ein zuverlässiger Begleiter, auf den Verlass ist und zu dem sie Vertrauen haben können. Das Vertrauen bekommen wir aber nicht geschenkt, das müssen wir uns verdienen.«
Klaus hat in seiner fast zwanzigjährigen Berufslaufbahn an vier verschiedenen Standorten der Wohngruppe Hunderte von Kindern und Jugendlichen begleitet. Er ist sozusagen ein »alter Hase« im Geschäft. Im Folgenden schildert er drei Hilfeverläufe, die ihn aus unterschiedlichen Gründen besonders bewegt haben.
BERND
»Wir haben Bernd mit sechzehn Jahren aufgenommen. Seine Mutter kam überhaupt nicht mit ihm zurecht und war sehr krank. Sie hat sich an das Jugendamt gewandt. Nach einer Elternberatung, erfolglosen ambulanten Hilfemaßnahmen und einem weiteren großen Krach mit seiner Mutter landete er bei uns. Er war ein sehr zorniger junger Mann, hat sich nicht auf eine Beziehungsebene mit den Pädagoginnen und Pädagogen eingelassen, sich allem komplett verweigert, die Schule geschwänzt. Mehrmals standen wir kurz davor, ihn rauszuwerfen, weil wir nicht an ihn rankamen. Verzweifelt haben wir einen Ansatzpunkt gesucht, irgendetwas, wofür er sich interessiert, mit dem wir ihn »kriegen« können. Immer wieder haben wir das Gespräch gesucht, ihn zur Schule begleitet. Eines Tages erzählte Bernd, dass er einmal in der Hamburger Auswahl Basketball gespielt hatte und davon träumte, ein NBA-Star in der amerikanischen Liga zu werden. Sein Problem: Er hatte sich mit seinen Mitspielern verkracht und fand kein neues Team.« Dankbar, dass er über das Thema Sport einen Zugang gefunden hatte, meldete Klaus Bernd kurz entschlossen beim Probetraining im Verein seines Sohnes an. »Bernd überzeugte dort auf Anhieb. Er äußerte einen großen Wunsch: bei einem Sichtungsturnier in Frankfurt mitzuspielen, wo viele Talentsucher zusehen würden. Wir Pestalozzi-Pädagogen und der zuständige Mitarbeitende beim Jugendamt entschieden nach eingehender Beratung, Bernd die Reise und das Startgeld zu finanzieren. Leicht fiel uns dieser Entschluss nicht, denn das Geld in der Jugendhilfe ist knapp. Doch die Investition hat sich gelohnt: Bernd wurde auf seiner Position zum besten Spieler des Turniers gewählt, hat erfolgreich Kontakte geknüpft und bekam später ein Angebot, in der Jugend-Bundesliga zu spielen. Er hat in dem Verein im Internat gewohnt und seinen Hauptschulabschluss gemacht. Heute spielt er als Profi, sein NBA-Traum lebt. Manchmal muss man um die Kids kämpfen, und zwar immer wieder. Der Einsatz lohnt sich.«
LEYLA
»Leyla wurde zu Hause rausgeschmissen, da war sie gerade sechzehn Jahre alt. Sie war eine Schulverweigerin und es gab ständig Zoff mit der Mutter. Mit Leyla war es ähnlich schwierig wie mit Bernd, wir haben keinen Zugang zu ihr gefunden. Sie hat uns Pädagogen beschimpft und ständig mit uns gestritten. Es war unheimlich anstrengend, immer wieder auf sie zuzugehen, immer wieder den ersten Schritt zu machen. Anders als bei Bernd mit dem Sport haben wir bei ihr keinen Ansatzpunkt für eine Eigenmotivation entdeckt, den wir hätten nutzen können. Leyla war in der Schule gemobbt worden und hatte Versagensängste. Wir haben sie überredet, eine Produktionsschule zu besuchen, wo neben einer Produktherstellung in der Fertigung der Hauptschulabschluss gemacht werden kann. Das war die richtige Schulform für sie. Ständig haben wir sie ermutigt, hinzugehen, und gelobt, wenn sie da gewesen ist. Nach...