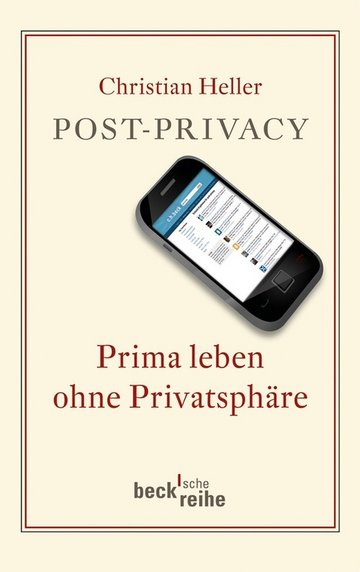2. EINE KLEINE GESCHICHTE DES PRIVATEN
Wenn ich der «Privatsphäre» im einleitenden Kapitel den Untergang prophezeit habe, so habe ich dabei einen sehr eng gefassten Begriff von Privatsphäre vorausgesetzt: das Private als ein Geheimnis, als ein Wissen über mich, das Dritten verschlossen bleibt; die Privatsphäre als Raum meines persönlichen Lebens, der sich geschützt weiß vor der Spionage fremder Blicke.
Dabei hat der Begriff des Privaten selbstverständlich noch eine ganze Reihe anderer Bedeutungen. Der «Privatbesitz», in dem sich ein Grundstück befindet, ist nicht unbedingt ein Geheimnis. Das Wirken der «Privatwirtschaft» ist sogar ausgesprochen sichtbar. Und wenn ich nach der Arbeit ins Lokal gehe und dort ein Bier trinke, dann ist das Teil meines «Privatlebens» – ganz unabhängig davon, wie sichtbar ich das tue.
In diesem Buch will ich nicht das Ende der Freizeit ausrufen oder das Ende des Eigentums. Wenn ich vom Ende der Privatsphäre rede, dann meine ich tatsächlich ein Ende von Geheimhaltungen, von Verborgenheiten. Aber hängen nicht all diese Dinge irgendwie unter dem Begriff des «Privaten» miteinander zusammen? Wenn ja, dann würde das Ende des einen vermutlich auch die anderen in Nöte bringen.
Vielleicht eint diese verschiedenen Begriffe des Privaten der Respekt, den sie in unserer liberalen Gesellschaft gemeinsam genießen. Wenn man davon spricht, dass etwas «privat» sei, dann klingt darin an, es sei frei vom Diktat durch andere. Mit der Ausrufung des Privaten wird hier ein Selbstbestimmungsrecht betont – als Einzelner, als Familie oder als Unternehmen. Aber was heißt das genau, «Selbstbestimmung»? Und wie fällt es in eins damit, nicht gesehen zu werden?
Tatsächlich sind die Annahmen, was «privat» heißt, was unter das Private fällt, welchen Wert es hat und welchen Regeln es folgt, historisch gewachsen. In diesem Buch ist viel vom Privaten und der Privatsphäre die Rede – insofern lohnt sich ein Blick auf die geschichtliche Bandbreite sowohl des Begriffs vom Privaten als auch dessen, was wir heute damit zu meinen pflegen. Der folgende Versuch einer kleinen Geschichte des Privaten ist nicht umfassend und nicht vollständig. Er beschränkt sich auf unseren westlichen Kulturkreis und greift eher Episoden heraus, als eine Gesamtentwicklung nachzuzeichnen. Er ist skizzenhaft und oberflächlich. Aber er soll zumindest deutlich machen, dass sich ein fester Kern des Privaten gar nicht so einfach behaupten lässt; dass sich das Private sowohl förderlich als auch feindselig zu anderen unserer Werte verhalten kann; dass seine Anziehungskraft sehr von den Umständen abhängt; dass angesichts der Vielfalt der Lebensweisen ein verbindlicher Wert des Privaten kaum einzufordern ist.
Loblied auf den öffentlichen Mann
Der Wortstamm des Privaten reicht zurück bis in die Antike. «Privat» ist abgeleitet vom lateinischen Verb privare: «berauben». Das Private ist also zunächst einmal kein eigener Wert. Es ist die Wegnahme von etwas.
Dieses Etwas nannten die Römer res publica, die «öffentliche Sache». Wie schon die negative Bestimmung des Privaten nahelegt: Stolz waren die Römer nicht so sehr aufs Private, sondern eher auf ihre res publica. Sie bezeichnet, was die Gemeinschaft als Ganzes angeht. Grob gesagt (es ist schwer, im Hin und Her vieler Jahrhunderte eine allzu enge Bedeutung festzumachen) sind das der Staat und seine Gesetze, die gemeinschaftlich nutzbare Infrastruktur, die Politik, ihre Streitgespräche und ihre Mitgestaltung durch mündige Bürger.[1]
In dieser Arena bewies sich der Wert eines Mannes: im Dienst an Rom, durch das Bekleiden staatlicher Ämter, bei glanzvollen Reden im Senat. Den eigenen Namen voranzubringen hieß zum Beispiel, öffentliche Bauwerke zu stiften. Sich groß zu machen hieß, möglichst viel vom eigenen Leben, Können, Reichtum in dieses gemeinsame Projekt der res publica zu stecken.[2]
Das Private war das, was ohne diese Ehre auskommen musste, was um sie «beraubt» war, was nicht die öffentliche Sache war. Ein privatus war der Mensch ohne Amt. Privat war, was nicht in der Robe der res publica passiert. Privat war das Haus, das einem Irgendjemand gehörte anstatt der Republik. Das Private war die Nacktheit und Bedeutungslosigkeit, die von einer Person blieb, wenn ihr öffentlicher Wert von ihr abgezogen wurde. Es war das Handeln, das zur res publica nichts unmittelbar beitrug.
Die antike res publica strahlt noch heute – oder vielmehr unsere Vorstellung von ihr. Wir verehren die Antike: Nicht umsonst sind Griechisch und Latein die Sprachen der Demokratie, des Rechts, der klassischen Bildung.
Die Gründerväter der USA, die Köpfe der Französischen Revolution und viele nach ihnen träumten von der Wiedereinführung antiker Formen und Begriffe des Politischen. Vielleicht waren sie bezirzt von der geschliffenen Rhetorik und Intellektualität, die wir öffentlichen Männern Roms wie dem großen Cicero andichten. Hier scheint eine ideale Öffentlichkeit aufzublitzen, in der Gleiche unter Gleichen frei, gebildet und zivilisiert das Gemeinwohl aushandeln.
Nur dürfen wir nicht vergessen, wie diese Öffentlichkeit bei genauerem Hinsehen beschaffen war: als Selbstinszenierung einer kleinen Elite auf dem Rücken einer größtenteils unmündigen Masse. Ein Klub superreicher Familien füllte den Senat und betrieb die res publica als seine Spielstube, in der man große Reden schwang und sich einen Namen machte. Ein Amt innezuhaben bedeutete in Rom: Spiele ausrichten, Bauarbeiten in Auftrag geben – und zwar aus der eigenen Tasche. Nach oben kam man nur mit eigenem Wohlstand. Da erscheint es ganz natürlich, dass die Politik ein Geschäft der Elite war.
Die Römer glaubten an die Tugend völliger Selbstbestimmtheit. Wer sich aber Sorgen machen muss um niedere Fragen wie den Brotverdienst, der ist nicht selbstbestimmt. Wie soll so jemand die Freiheit von niederen (also: privaten) Zwängen aufbringen, um sich tugendhaft für die Republik einzusetzen? Unbestechlich ist nur der Superreiche. Wer von seiner eigenen Arbeit leben muss, kann gar nicht tugendhaft sein.[3]
Der Dienst an der öffentlichen Sache setzte also voraus, im Privaten so gut aufgestellt zu sein, dass das Private einem nicht zur Last fiel, sondern die notwendigen Mittel für das öffentliche Agieren bereitstellte. Der private Wohlstand rechtfertigte, ermöglichte die politische Karriere. Das Private hatte vielleicht nicht die Strahlkraft des Öffentlichen, war aber sein notwendiger Maschinenraum.
Leben im Maschinenraum
Wie aber war das Private im Detail beschaffen, wie lebte es sich darin? Das bedeutet in der Antike, und auch später noch oft, die Frage nach dem Aufbau der Familie, ihres Haushalts und Besitzes.
Die römische familia setzte sich[4] aus einem Haufen Menschen zusammen – Frau, Kinder, Sklaven –, an deren Spitze der Familienvater, der pater familias stand. Alle gehörten sie ihm mit Haut und Haar. Er hatte das Recht, sie zu töten. Er bestimmte über den Familienschatz und damit auch über alles, was seine erwachsenen Söhne nach Hause brachten: Herr ihrer selbst und ihrer Einkünfte wurden sie erst mit seinem Tod. Der Familienbesitz, von Generation zu Generation weitergetragen, gründete sich auf weit verstreuten landwirtschaftlichen Gütern. Nach außen erweitert wurde diese Familie um Klienten: Sie standen dem Vater gegenüber in einem Treueverhältnis gegenseitiger Begünstigung.
Der Vater hatte alle Macht. Aber damit er Zeit für die öffentlichen Dinge fand, delegierte er. Die Ehefrau war zuständig für die Leitung des Haushalts und der Sklaven. Weder zu ihr noch zu den Kindern war eine intime Beziehung notwendig: Die Familie hatte letzten Endes eine öffentliche Aufgabe, keine der Innigkeit. Die Kinder landeten eher in der Obhut von Sklaven und fernen Verwandten, als von den Eltern umsorgt zu werden. Verletzten sie die Familienehre, wurden sie öffentlich bestraft.[5]
Die Häuser wohlhabender römischer Familien waren oft prächtig gebaut – aber das muss nicht als Bekenntnis zum Wert des Privaten gedeutet werden. Je prachtvoller ihre Innenräume ausfielen, desto öffentlicher war auch ihre Funktion: zum Beispiel die Ausrichtung von Banketten mit illustren und wichtigen Gästen; oder der regelmäßige Empfang von Klienten, deren Wünschen nach Versorgung und politischer Einflussnahme es nachzukommen galt. Das Haus einer bedeutenden römischen Familie zeichnete sich aus durch große Innenhofgärten und Eingangshallen und durch die Randständigkeit und Winzigkeit der Räume, in denen man für sich sein konnte. Einige dieser Gebäude orientierten sich so sehr an der Architektur des Offiziellen, dass es Archäologen manchmal schwer fällt, private und öffentliche Häuser auseinander zu halten.[6]
Die niedereren Schichten hingegen scheinen nicht nur beengter, sondern auch sehr viel elender, jedenfalls sicher nicht gemütlicher gehaust zu haben. Wer konnte,...