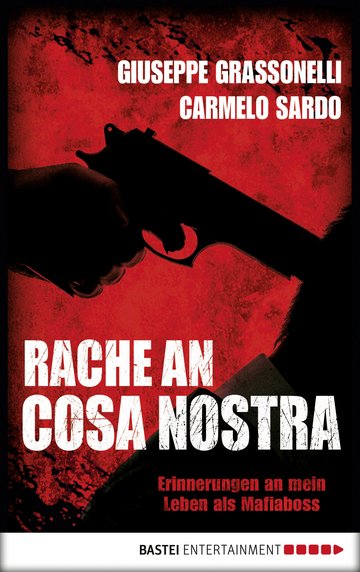In dieser Nacht, die sich ganz allmählich, aber unaufhaltsam auf meine armselige Existenz legt, weckt mich das ferne Kläffen eines Hundes aus dem leichten Schlaf. Ich öffne die Augen. Die Dunkelheit meiner Zelle wird nur durch ein schwaches kegelförmiges Licht erhellt.
Das Heulen dieses Hundes, wahrscheinlich ein Streuner, ist eine nicht enden wollende Klage gegen den Himmel. Vielleicht ist es auch eine Hündin, die verzweifelt nach ihren Jungen sucht?
Plötzlich taucht eine Erinnerung aus meiner Jugend in meinen Gedanken auf und meine Lippen verziehen sich zu einem bitteren Lächeln. Ich schließe die Augen und sehe wieder diese eine spezielle Hündin vor mir, dreißig Jahre, ja ein ganzes Leben liegt diese Szene zurück. Laut bellend streckte sie damals den Kopf aus ihrem Versteck. Dann schnupperte sie und schaute sich um. Sie war nervös, verließ ihre Höhle, kehrte dann wieder zurück, als könne sie sich nicht entscheiden. Schließlich schoss sie nach draußen und rannte davon.
Tino ’u Mancinu, Totò ’a Fimminedda, Nello ’u Grossu und ich hatten seit etwa einer Stunde am Felsen gelehnt und auf diesen Moment gewartet. Ich ging rasch auf die Höhle zu, die anderen folgten, dann schob ich meinen Arm hinein und zog den ersten Welpen heraus, der sofort zu winseln begann. Ich drückte ihn Nello in die Hand, dann zog ich den zweiten Welpen heraus und gab ihn Tino. Der dritte war schlau und hatte sich ganz klein gemacht. Ich konnte ihn zwar fühlen, aber nicht richtig am Fell packen.
»Verdammt, ich muss mich beeilen! Wenn die Hündin zurückkommt, zerfleischt sie uns«, dachte ich.
Ich streckte meinen Kopf in die Höhle und versuchte hineinzuschlüpfen, da hörte ich ’u Grossu hinter mir brüllen: »Heilige Mutter Gottes! Sie kommt …«
Ich schnellte zurück, ließ von dem letzten Welpen ab, riss meinen Freunden die beiden anderen kleinen Hunde aus den Händen und steckte sie zurück in die Höhle. Dann ergriffen wir die Flucht. Es war nicht leicht, den steilen Berg nach oben zu rennen, aber ich hoffte, dass die wütende Hündin uns nicht folgen würde, weil wir immerhin ihren Nachwuchs zurückgelassen hatten.
Es war nicht das erste Mal, dass wir Welpen klauten. Aber dieses Mal war es anders. Die Hündin fletschte wütend die Zähne und ließ uns nicht in Ruhe.
Plötzlich stolperte Totò und rutschte den Hügel hinunter, wobei er mit dem Kopf auf den spitzen Steinen aufschlug.
»Verdammter Mist«, dachte ich, »dieses Mal hat sich diese Memme aber richtig wehgetan.«
Schon als wir bei der Höhle angekommen waren, hatte er gejammert, er wolle nach Hause und er habe Angst davor, dass die Hündin zurückkommen könne. Totò hatte immer vor irgendwas Angst.
Ich machte kehrt, um ihm aufzuhelfen und ihn in Sicherheit zu bringen. Als ich bei ihm war, versuchte ich ihn zu beruhigen, während er vor Schmerzen schrie.
Die Hündin beobachtete die Szene und war stehen geblieben. Ihr Blick schien sagen zu wollen: »Seht euch diese beiden Trottel an!« Dann drehte sie sich um und verschwand. Die Sicherheit ihrer Welpen war wichtiger für sie.
In diesem Augenblick kam ein Freund meines Vaters vorbei, der auf dem Weg zur Arbeit war. Totò blutete an der Stirn, sein Bein war verdreht, eine Hand gebrochen, die Haut am ganzen Körper aufgeschürft. Er trug den Jungen zum Auto und brachte ihn ins Krankenhaus, dabei warf er mir einen vorwurfsvollen Blick zu und sagte: »Du schon wieder, Mal’e …«
Mal’e, Malerba, das war mein Spitzname: Unkraut.
Als ich nach Hause kam, wurde ich erst von meinem Großvater verprügelt, dann von meinem Vater und schließlich von meinen Onkeln. Für sie war ich allein an allem schuld. Es hatte wenig Sinn, ihnen zu versichern, dass es nicht meine Idee gewesen war, sondern die der anderen Jungs. Lediglich meine Mutter glaubte mir, doch sie konnte mich weder vor den Schlägen noch vor der Strafe schützen.
Die Männer meiner Familie verdonnerten mich dazu, immer in Totòs Nähe zu bleiben, um ihn zu beschützen: Er war die Schwachstelle unserer Bande. Normalerweise rannte ich morgens in die Schule, um in Form zu bleiben, aber nach diesem Vorfall musste ich Totò im Bus zur Schule begleiten.
Ich träumte damals davon, Fußballprofi zu werden. Mein Herz gehörte Juventus Turin, und meine Helden waren Romeo Benetti und Pietro Anastasi. Ich schwor mir, eines Tages so gut zu sein wie sie. Aber statt eines Fußballs hatte ich jetzt einen Klotz am Bein: Totò. Wegen ihm hatte ich fast jeden Tag Krach mit den anderen Jungs. Er war blöd genug, sich jedes Mal das Pausenbrot klauen zu lassen, sobald ich nicht in seiner Nähe war. Es gab aber auch eine positive Seite: Totò war ein guter Schüler. Von der Grundschule bis zum Mittelschulabschluss, den ich ohne ihn niemals geschafft hätte, machte er meine Hausaufgaben.
Normalerweise lief es so ab: Ich kam erschöpft und verschwitzt in der Schule an, schlief auf meinem Platz ein, und der Lehrer versuchte mich mit ein paar Ohrfeigen zu wecken. Aber nichts zu machen: Ich nickte sofort wieder ein. Erst als es nach Schulschluss klingelte, wurde ich richtig wach, und erst dann begann mein Tag so richtig.
Wenn mein Vater bei Fiat von zwei bis zehn Uhr die Abendschicht hatte, aßen wir gemeinsam zu Mittag, und bevor er zur Arbeit ging, quälte er mich mit dem Einmaleins. Seinen Ohrfeigen ist es zu verdanken, dass ich das Einmaleins so gut beherrschte, dass selbst mein Lehrer verblüfft war. Eigentlich lernte ich von meinem Vater weit mehr als von meinem Lehrer. Seine Strenge sorgte dafür, dass ich nicht nur in Mathematik, sondern auch in Geografie besser als meine Klassenkameraden war. Im Klassenraum selber war ich allerdings meist geistig abwesend. Ich hasste den Unterricht. Für mich war er reine Zeitverschwendung.
»Ich bin eben Fußballer und kein Bücherwurm«, sagte ich mir immer wieder, um mir Mut zuzusprechen.
In der Schule trieben wir nichts als Unsinn. Wir klauten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Nicht, weil wir es haben wollten, sondern einfach so. Eines Tages beobachteten wir, wie ein Eiswagen vor dem Lebensmittelladen stehen blieb. Der Fahrer stieg aus, öffnete die hintere Tür, nahm zwei Kartons mit Eis heraus und verschwand im Laden. Ein Blick zu Tino genügte, wir sprangen in den Wagen und brausten mitsamt der Ladung davon.
Dann holten wir unsere Freunde ab, fuhren ins Grüne und stopften so viel Eis in uns hinein, bis uns kotzübel wurde. Als wir nicht mehr konnten, fingen wir an, uns gegenseitig mit Eis zu bewerfen. Warum wir diesen Blödsinn eigentlich machten, wussten wir selbst nicht. Auch dass wir es dieses Mal übertrieben hatten, war uns nicht bewusst. Das war schlimmer, als Welpen zu klauen.
Alle Kinder in unserem Viertel wurden von ihren Eltern verhört, um herauszufinden, wer dabei gewesen war. Tino, Nello und ich wurden ordentlich verprügelt, aber wir blieben still, »sangen« also nicht. Aber unser Schweigen half nichts, denn wie immer war das Muttersöhnchen Totò der Verräter, der alles beichtete.
Heiliger Strohsack, was wurde ich an diesem Tag von meinem Vater grün und blau geschlagen! Aber es waren nicht die Prügel, die wehtaten. Unsere Eltern mussten Schulden bei der Bank machen, um den Schaden auszugleichen, den wir angerichtet hatten. Ich wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Nur meine Mutter hatte Mitleid mit mir. Sie nahm mich in den Arm und wiegte mich wie ein kleines Kind. Dabei murmelte sie immer wieder, sie sei sicher, dass wir einen solchen Blödsinn nicht noch mal machen würden.
Meine Mutter! Was für eine wunderbare Frau! Ich erinnere mich nicht, dass sie jemals die Hand gegen mich erhoben hätte. Jeder ihrer Vorwürfe wurde von einem freundlichen Lächeln begleitet. Ich versprach ihr jedes Mal, dass ich mich in Zukunft gut und anständig benehmen würde. Aber nach ein paar Tagen waren alle guten Vorsätze vergessen. Wer weiß, wie oft ich sie enttäuscht habe.
Unsere Bande bestand aus etwa zehn Jungs. Wenn wir nicht im Viertel blieben und in den Hinterhöfen Fußball spielten, machten wir die Stadt unsicher. Uns entkam keiner.
Unsere Feinde waren die »Vicinzillari«. Sie hatten sich nach Vicinzella benannt, dem Stadtviertel, in dem sie wohnten. Wir dagegen waren die »Indianer«, denn unsere Gegend nannte man das »Indianerviertel«.
Eines Tages waren wir gerade auf der Suche nach den Vicinzillari, die unser Bandenmitglied Memè schwer verprügelt hatten, als wir zwei Carabinieri entdeckten, die ihre Motorräder am Straßenrand aufgebockt hatten. Sie wirkten wie Riesen – jedenfalls kamen sie mir in meinen Kinderaugen so vor.
Während wir an ihnen vorbeigingen, musterten sie uns mit prüfenden Blicken, wir dagegen versuchten, besonders unschuldig auszusehen. Plötzlich war ein Mordskrach zu hören. Ich drehte mich um und sah eines der Polizeimotorräder am Boden liegen. Ich blieb stehen, als ein Carabiniere auf mich zugeschossen kam und auf mich einzuprügeln begann. Er hielt mich so fest, dass ich das Gefühl hatte zu ersticken. Danach kam noch sein Kollege dazu. Ich war starr vor Angst und versuchte mich zu befreien. Warum schlugen sie mich? Was war überhaupt passiert? Einer der beiden meinte, er habe mich wiedererkannt, und verlangte meinen Namen. Ich nannte ihm einen Namen – natürlich einen falschen. Der Polizist ging, ohne mich loszulassen, auf sein Motorrad zu. Während er über Funk mit der Zentrale sprach, gelang es mir, mich zu befreien und zu flüchten. Der andere Beamte rannte mir nach, übersah dabei aber ein sich näherndes Auto.
Das Auto erfasste ihn und schleuderte ihn brutal auf die...