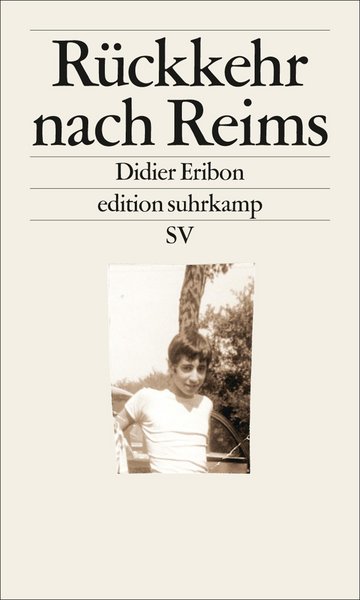1
Lange ist es für mich nur ein Name gewesen. Meine Eltern waren zu einer Zeit in dieses Dorf gezogen, als ich sie nicht mehr besuchte. Hin und wieder schickte ich ihnen eine Postkarte von meinen Auslandsreisen, halbherzig bemüht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, die ich mir so lose wie möglich wünschte. Beim Schreiben der Adresse fragte ich mich, wie der Ort, an dem sie wohnten, wohl aussah. Nie trieb ich die Neugier weiter. Wenn ich sie drei- oder viermal pro Semester, oft auch seltener, am Telefon hatte, fragte mich meine Mutter: »Wann kommst du uns besuchen?« Ich wich aus, gab vor, sehr beschäftigt zu sein, und versprach, bald zu kommen. Aber ich hatte es nicht vor. Ich war vor meiner Familie geflohen und verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen.
Ich habe Muizon also erst vor Kurzem kennengelernt. Es entsprach meiner Vorstellung: eine Karikatur der Zersiedlung, einer dieser semiurbanen, von Feldern gerahmten Räume, von denen man nicht genau weiß, ob sie noch Land oder schon zu dem geworden sind, was man gemeinhin Banlieue nennt. Seitdem habe ich erfahren, dass hier noch zu Beginn der fünfziger Jahre nicht mehr als fünfzig Menschen um eine Kirche siedelten, von der trotz all der Kriege, die den französischen Nordosten in unerbittlichen Wellen verwüstet haben, Teile aus dem 12. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Diese »Region mit Sonderstatus«, wie Claude Simon schreibt, wo Städte- und Dorfnamen nach »Schlachten«, »Schanzen«, »dumpfem Kanonendonner« und »großen Friedhöfen« klingen.1 Heute leben mehr als zweitausend Menschen hier, zwischen der Route du Champagne, die sich ganz in der Nähe durch weinbebaute Hänge schlängelt, und einem trostlosen Industriegebiet in den Vororten von Reims, das man in fünfzehn bis zwanzig Autominuten erreicht. Straßen wurden gebaut, an denen sich uniforme Doppelhäuser aufreihen. Sozialer Wohnungsbau größtenteils, reich sind die Mieter beileibe nicht. Mehr als zwanzig Jahre haben meine Eltern dort gelebt, ohne dass ich mich zu einem Besuch hatte durchringen können. Ich entdeckte diesen Flecken – wie bezeichnet man einen solchen Ort? – und ihr Häuschen erst, als mein Vater dort nicht mehr war, weil meine Mutter ihn in einer Alzheimer-Klinik untergebracht hatte, aus der er nicht wieder herauskommen sollte. Sie hatte diesen Moment so lange wie möglich hinausgezögert, dann aber, erschöpft und von seinen plötzlichen Gewaltausbrüchen erschreckt (einmal war er mit dem Küchenmesser auf sie losgegangen), der Wahrheit ins Auge gesehen: Es gab keine andere Lösung. Sobald er weg war, wurde es mir möglich, diese Reise, oder besser, diesen Prozess der Rückkehr auf mich zu nehmen, zu dem ich mich so lange nicht hatte entschließen können. Die Wiederentdeckung dieser »Gegend meiner selbst«, wie Genet gesagt hätte, von der ich mich so sehr hatte lossagen wollen. Ein sozialer Raum, den ich auf Distanz gebracht hatte, ein geistiger Raum, gegen den ich mich konstruiert hatte, der aber trotz allem einen wesentlichen Teil meines Seins bestimmte. Ich besuchte meine Mutter. Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr. Oder genauer, einer Aussöhnung mit mir selbst, mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verweigert, verworfen, verneint hatte.
Wenn ich sie in den folgenden Monaten ab und an besuchte, erzählte mir meine Mutter viel. Von sich selbst, ihrer Kindheit und Jugend, ihrem Leben als Ehefrau … Sie sprach auch von meinem Vater, von ihrer Begegnung und Beziehung, wie sie ihr Leben geführt, wie schwer sie gearbeitet hatten. Alles wollte sie mir sagen, unermüdlich, ihre Worte überschlugen sich. Als sei ihr daran gelegen, mit einem Mal die verlorene Zeit einzuholen und die Traurigkeit zu vertreiben, die unsere nichtgeführten Gespräche in ihr hinterlassen hatten. Wir saßen uns bei Kaffee gegenüber, ich hörte ihr zu. Aufmerksam, wenn sie von sich selbst berichtete, matt und gelangweilt, wenn sie die Großtaten ihrer Enkelkinder aufzählte, meiner Neffen, die ich nie getroffen hatte und die mich kaum interessierten. Es entstand wieder eine Bindung zwischen uns. Etwas stellte sich wieder her in mir. Ich erkannte, wie schwer es für sie gewesen war, mit meiner Abwendung zu leben. Ich verstand, dass sie darunter gelitten hatte. Aber wie war es für mich gewesen, der ich es doch immer so gewollt hatte? Hatte ich nicht auf andere Weise gelitten, gemäß dem freudschen Schema einer Melancholie, die aus einer nichtverwundenen Trauer über die ausgeschlagenen Möglichkeiten und abgewiesenen Identifikationen entsteht? Sie überleben im Ich als ein konstitutives Element. Das, wovon man losgerissen wurde oder sich losreißen wollte, bleibt ein Bauteil dessen, was man ist. Vielleicht leistet die Soziologie mit ihrem Vokabular eine bessere Beschreibung dessen, was die Psychoanalyse mit den einfachen, aber letztlich irreführenden Metaphern der »Trauer« und »Melancholie« evoziert: Die Spuren dessen, was man in der Kindheit gewesen ist, wie man sozialisiert wurde, wirken im Erwachsenenalter fort, selbst wenn die Lebensumstände nun ganz andere sind und man glaubt, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Deshalb bedeutet die Rückkehr in ein Herkunftsmilieu, aus dem man hervor- und von dem man fortgegangen ist, immer auch eine Umkehr, eine Rückbesinnung, ein Wiedersehen mit einem ebenso konservierten wie negierten Selbst. Es tritt dann etwas ins Bewusstsein, wovon man sich gerne befreit geglaubt hätte, das aber unverkennbar die eigene Persönlichkeit strukturiert: das Unbehagen, zwei verschiedenen Welten anzugehören, die schier unvereinbar weit auseinanderliegen und doch in allem, was man ist, koexistieren. Eine Melancholie, die aus einem »gespaltenen Habitus« erwächst, um diesen schönen und kraftvollen Begriff Bourdieus aufzugreifen. Dieses unterschwellige, diffuse Unbehagen, und mit ihm eine noch stärkere Melancholie, drängt genau dann an die Oberfläche, wenn man glaubt, es hinter sich gelassen oder zumindest neutralisiert zu haben. Diese Gefühle waren nie ganz weg, und man entdeckt dann, oder besser, man entdeckt wieder, wie sie, tief in unserem Selbst verkrochen, in uns arbeiten und auf uns wirken. Kann man ein solches Unbehagen jemals überwinden? Kann man der Melancholie entkommen?
Als ich meine Mutter am 31. Dezember jenes Jahres kurz nach Mitternacht anrief, um ihr ein gutes Jahr zu wünschen, sagte sie: »Die Klinik hat gerade angerufen. Dein Vater ist vor einer Stunde gestorben.« Ich mochte ihn nicht. Ich hatte ihn nie gemocht. Mir war klar gewesen, dass seine Monate, dann auch seine Tage gezählt waren, aber ich hatte nichts unternommen, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Wozu auch, hätten wir uns doch eh nicht erkannt, anerkannt sowieso nicht, seit Ewigkeiten nicht. Die Abgründe, die sich in meiner Jugend zwischen ihm und mir aufgetan hatten, waren mit den Jahren größer, wir füreinander Fremde geworden. Nichts verband uns, nichts hatten wir gemeinsam. Wenigstens glaubte ich das oder hatte es so sehr glauben wollen, weil ich dachte, man könne ein Leben losgelöst von seiner Familie leben und sich neu erfinden, indem man der Vergangenheit und denen, die sie bevölkern, den Rücken zukehrt. Für meine Mutter, dachte ich, musste es eine Erlösung sein. Mein Vater war dem Zustand körperlicher und geistiger Zersetzung jeden Tag ein Stück näher gekommen. Ein unerbittlicher Verfall. Besserung ausgeschlossen. Auf Demenzkrisen, in denen er Krankenschwestern angriff, folgten lange Phasen des Dämmerns, sicherlich bedingt durch die Medikamente, die man ihm nach seinen Anfällen verabreichte. Er schwieg dann, bewegte sich kaum noch und aß nichts mehr. Erinnern konnte er sich sowieso an nichts und niemanden. Besuche bei ihm waren für meine drei Brüder und für seine Schwestern (zwei von ihnen gingen vor lauter Angst nicht wieder hin) eine schwere Prüfung. Meiner Mutter, die jedes Mal zwanzig Kilometer mit dem Auto zurücklegen musste, verlangten sie eine Selbstlosigkeit ab, die mich wirklich erstaunte, waren doch ihre Gefühle für ihn, solange ich mich erinnern konnte, immer feindlich, eine Mischung aus Abscheu und Hass gewesen. Ja, Abscheu und Hass, die Worte sind nicht zu stark. Aber meine Mutter machte sich diese Besuche zur Pflicht. Ihr Selbstbild stand auf dem Spiel: »Ich kann ihn doch nicht hängenlassen«, sagte sie immer wieder, wenn ich fragte, warum sie weiter täglich in die Klinik fuhr, obwohl er sie nicht einmal mehr erkannte. Sie hatte ein Foto von sich und ihm an seine Zimmertür geklebt und fragte ihn regelmäßig: »Weißt du, wer das ist?« »Die Frau, die sich um mich kümmert«, antwortete er.
Zwei oder drei Jahre zuvor hatte mich die Nachricht von seiner Krankheit in tiefe Angst gestürzt. Nicht um ihn – es war zu spät, und ohnehin rief er in mir keinerlei Gefühl, nicht einmal Mitleid hervor –, sondern um mich selbst, egoistischerweise: Ist das erblich? Bin auch ich bald an der Reihe? Ich begann, auswendig gelernte Gedichte oder Tragödienszenen zu rezitieren, um mich zu vergewissern, dass ich sie noch konnte: »Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle« …, »Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches / Et puis voici mon cœur« …, »L’espace à soi pareil, qu’il s’accroise ou se nie / Roule dans cet ennui« …2 Sobald mir ein Vers entfiel, dachte ich: »Es geht los.« Diese Obsession hat mich seither nicht mehr losgelassen. Strauchelt meine Erinnerung an einem Namen, einem Datum, einer Telefonnummer, erwacht sofort eine Unruhe. Überall sehe ich Anzeichen, ich erspähe sie, weil ich sie fürchte. Mein Alltagsleben wird gewissermaßen vom Gespenst des Alzheimer heimgesucht. Ein Gespenst, das aus der Vergangenheit auftaucht, um mich mit der Zukunft...