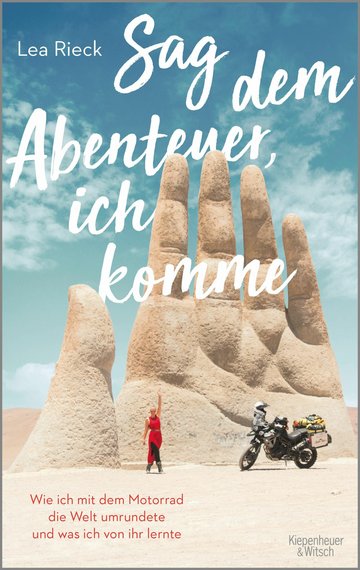Der Schwarm
Russland, Astrachan
Kilometer: 5 907
Auf einer schnurgeraden Straße fahre ich seit Stunden durch die eintönige Steppe Kalmückiens. Wüste, egal wohin ich blicke. In den vergangenen Tagen habe ich Ostanatolien durchquert, bin in Georgien über die Gebirgszüge des großen Kaukasus gefahren und mit Kopftuch durch das streng muslimische Grosny, die tschetschenische Hauptstadt, spaziert. In der Gegenrichtung weisen die Straßenschilder die Distanzen nach Eriwan, Baku und Teheran aus, vor mir nur nach Astrachan, einer russischen Stadt – als wäre Astrachan das Ende der Welt. Dabei ist Astrachan für mich lediglich ein Ort kurz vor der kasachischen Grenze.
Es ist früher Vormittag, die Sonne schraubt sich Richtung Zenit und brennt erbarmungslos auf den sandigen Boden. Ich schmecke salzigen Schweiß, der sich vermischt mit den feinen Staubkörnern, die Cleo und ich aufwirbeln. Außer mir ist hier niemand unterwegs. Mein Blick hängt am Horizont, und plötzlich bemerke ich einen schwarzen Punkt am Straßenrand. Eine Militärkontrolle – schon wieder! Seit ich in Russland bin, werde ich alle dreißig Kilometer angehalten. Ein uniformierter Mann tritt mit zackigen Bewegungen auf die Straße und winkt mich zu sich. Grimmig streckt er mir seine Hand entgegen. Ich lächle und schüttele sie erfreut.
»Pass!«, faucht er.
Sobald er das Dokument hat, lässt er ihn in seiner Jackentasche verschwinden. Dann prasseln harte russische Worte auf mich ein. Ich lächle weiter, um Kooperationsbereitschaft zu signalisieren. Aber mein Gegenüber ist wahrscheinlich mehr an Bestechungsgeldern interessiert. Es dauert ziemlich lange, bis er bemerkt, dass er es bei mir mit einer saublöden Ausländerin zu tun hat: keinen Respekt vor seiner Autorität und die lokalen Sitten der Korruption versteht sie auch nicht. Verdrossen zieht er nach zehn Minuten den Pass wieder hervor. Ich schnappe ihn mir. Er versucht es noch einmal.
»1500 Rubel«, das sind ungefähr zwanzig Euro.
Ich lächle noch immer, schüttele aber den Kopf.
Er schnaubt wütend: »Fünfzig Euro.«
Wieder schüttele ich den Kopf und starre ihm ins Gesicht; mein stoisches Lächeln gleicht inzwischen einem Zähnefletschen. Dann starte ich den Motor. Er versucht, sich mir in den Weg zu stellen, aber ich bin schneller. Mit seinem klapprigen Auto kann er mich sowieso nicht einholen. Kurz denke ich darüber nach, ob er mich anschießen könnte. Aber er sah mir eher nach Schlitzohr als nach Mörder aus. Vielleicht sollte ich mich zu meiner eigenen Sicherheit in Zukunft nicht mehr so stark auf meine Menschenkenntnis verlassen.
Selten verläuft in diesem Teil der Welt ein Tag ohne Überraschungen. Genauso wie Militärkontrollen gehören hier Umwege aufgrund von Straßensperren zum Alltag. Und ein Übel kommt selten allein – kurze Zeit später jagen mich ein paar rote Kreuze und Schilder von der Hauptstraße um das Kaspische Meer, das genau genommen der größte See der Erde ist, auf eine kleine Schotterstraße in Richtung der kalmückischen Steppe. Seit 1992 ist Kalmückien eine autonome russische Republik und die einzige Region in Europa, in der der Buddhismus die vorherrschende Religion ist. Jetzt bin ich wirklich dort angekommen, wo die richtige Reise losgehen soll, wo ich nichts mehr kenne. Seit ein paar Tagen klingen sogar die Ortsnamen nach großer Weite – bekannt, doch fremdartig, Orte, von denen ich gehört habe, aber nie dachte, dass ich sie irgendwann sehen würde.
Ein Schäfer treibt seine etwa fünfzig blökenden Ziegen von einer Straßenseite auf die andere – das einzige Verkehrsaufkommen, dem ich begegne und das alles kurzfristig zum Erliegen bringt. Das Einzige, das hier in der Wüste fließt, ist der Schweiß unter meiner Motorradkleidung. Wegen des großen Flüssigkeitsverlusts muss ich immerhin nicht mehr aufs Klo, obwohl ich täglich inzwischen mehr als fünf Liter trinke. Über vierzig Grad im Schatten – und das, obwohl es hier auf den geraden freien Flächen eigentlich keinen Schatten gibt. Regelmäßig habe ich die immer gleichen Tagträume: eine kalte Flasche Mineralwasser mit Sprudel, nur eine Flasche eiskaltes blaues Adelholzener, Perrier oder von mir aus sogar Gerolsteiner. Ich würde in diesem Moment dafür über Leichen gehen und sogar Nestlé-Sprudelwasser abkaufen. Aber weil es kein Sprudelwasser gibt, versuche ich an frische, klare Bergseen zu denken, an die kühle Luft auf den Gipfeln der Alpen. Ich liebe die Berge, die grünen Hügel, die rauen Felsen. Ich vertraue ihnen. Die steppige Wüste und das Flachland dagegen sind herausfordernd, weil es mir schwerfällt, sie zu verstehen. Wenn man bis zum Horizont blicken kann und alles gleich ist, gibt es keine Referenzpunkte, an denen sich die flatternden Gedanken festklammern können. Dann denke ich, dass dieses Unwohlsein sicher damit zu tun haben muss, wo man aufgewachsen ist und was einem vertraut ist, denn ein Berg, bei dem man nicht weiß, was sich dahinter befindet, ist grundsätzlich nicht viel vertrauenswürdiger als eine weite Ebene, die sich offen vor einem erstreckt.
Plötzlich knallt schmerzvoll etwas wie ein hartes Geschoss an meine Brust und reißt mich aus meinen Tagträumen. Verdutzt schaue ich auf. Vor mir zieht rasend schnell eine Wolke auf, der Himmel wird schwarz – und ich halte mit meinem Motorrad direkt darauf zu. Mit einem Klatschen verteilt sich das Innenleben eines großen Insekts auf meinem Visier. »Igitt!« Ich versuche, die Matsche mit dem Handschuh wegzuwischen, doch ich verteile die Innereien nur großzügig in meinem ganzen Sichtfeld. Ich bin umgeben von der schwarzen Wolke, die um mich fließt. Als ich verstehe, was vor sich geht, wird mir übel. Tausende, ja Millionen von Insektenleibern. Sie fliegen so dicht, dass sie wie schwere Hagelkörner auf mich prasseln, an mir zerplatzen oder abprallen. Heuschrecken. Ein unendlicher Schwarm, der das Licht schluckt und wie ein apokalyptisches Unglück über mich hereinbricht. In seiner Wucht der Millionen Körper nimmt mir der Schwarm die Sicht und umschließt mich wie ein schwarzer Vorhang. Ich erinnere mich daran, einmal gelesen zu haben, dass Heuschreckenschwärme Hunderte bis tausend Kilometer lang werden können und aus vierzig bis achtzig Millionen erwachsenen Tieren bestehen. Wenn sie Lust hätten, könnten sie mich hier und jetzt ohne Weiteres auffressen. Wo ist vorn? Wo hört die Straße auf und fängt die Steppe an?
Und dann, irgendwann, lichtet sich der Schwarm plötzlich. Die Sonne blendet mich, ich bin völlig orientierungslos und halte an. Ich befinde mich noch immer auf einer schlechten Sandstraße, aber mein Navigationsgerät zeigt sie leider nicht mehr an. Die Landschaft hat sich seit Hunderten von Kilometern genauso verändert wie ein versteinertes Fossil: gar nicht. Noch immer Steppe, kniehohe, vertrocknete Büsche und ein heller, sandiger Untergrund. Ich blicke mich um – auf der Suche nach etwas, woran ich mich orientieren kann. Aber das trockene Gestrüpp hängt nur traurig herum und gibt mir keinen Hinweis, ob ich überhaupt noch in die richtige Richtung fahre. Als ich den Ausschnitt, den das Navi anzeigt, vergrößere, stelle ich fest, dass es glücklicherweise nicht mehr weit nach Astrachan ist und ich zumindest grob in Richtung der Hauptstraße fahre, auf der ich mich eigentlich schon lange wieder befinden sollte. Also weiter, nach vorn, auf dieser Piste, die es laut meiner Karte gar nicht geben sollte, denn zurück in den Heuschreckenschwarm bringen mich keine zehn Pferde, keine zwanzig Kamele und erst recht keine fünfzig Ziegen.
Die Sandstraße hat es in sich. Ich versuche, mich an die Offroadtipps zu erinnern, die ich vor meiner Reise gelesen habe: Gas geben, Drehzahl erhöhen. Vor allem aber: keine Zweifel zulassen. Eine relativ einfache Gleichung, die in vielen Lebenslagen funktioniert: Zweifel bedeuten Unsicherheit, Unsicherheit bedeutet Verlust des Fokus und der Konzentration, Verlust der Konzentration bedeutet Sturz. Mein Hinterreifen schlingert, das Vorderrad zieht in eine ganz andere Richtung, als ich will. Mein Herz beginnt wild zu rasen.
»Ruhig bleiben. Ruhig bleiben und Konzentration!« Ich fange mich, das Motorrad läuft wieder stabil. Bis ich uns in die nächste Sandverwehung steuere: Wieder schlingert das Motorrad unkontrolliert, das Vorderrad wird wild hin- und hergeworfen.
»Verdammt, bleib ruhig!« Ich weiß nicht, ob ich mit mir selbst spreche oder mit Cleo. Als würde sie es verstehen, schlagen wir uns die nächsten fünf Kilometer einigermaßen durch. Doch der Sand und meine flatternden Nerven zehren an der Konzentration.
»Was, wenn wir hier, in der absoluten Pampa, stürzen?« Ich schlingere wieder.
»Aber was, wenn dieser Sand nun niemals endet?« Ich gebe Gas, das Motorrad stabilisiert sich.
»Was, wenn die Straße hier ins Nirgendwo führt?« Das Vorderrad bricht aus.
»Verdammt, konzentrier dich!«, versuche ich die Sorgen abzuwürgen, die sich zwischen mich und meinen Fokus drängen. Wieder schlingert Cleo. Wir fangen uns – aber als ich das Motorrad wieder unter Kontrolle habe, rasen wir auf den Pistenrand zu. Ich kann nichts anderes tun, als direkt auf einen Sandberg zu starren, obwohl ich weiß, dass mir der falsche Blick zum Verhängnis werden wird, denn wohin man schaut, dorthin fährt man. Dann geht alles ganz schnell. Das Vorderrad kracht in die aufgeworfene Sanddüne, es reißt mir den Lenker aus den Händen. Ich fliege. Die Millisekunden dehnen sich, und in diesem Zeitvakuum habe ich sogar...