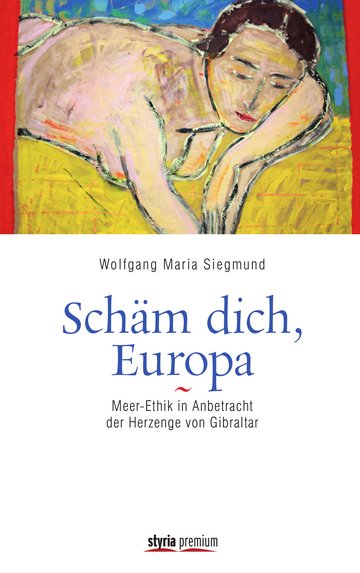2.2 Vom maghrebinischen Derrida, dem ganz Anderen vom gegenüberliegenden Kap
„Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Anti-Humanismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd mit diesem Gespenst verbündet …“12
Dieser nur in zwei Wörtern veränderte erste Satz des Manifests der Kommunistischen Partei aus dem Jahre 1848 könnte den Beginn einer europäischen Geschichte bedeuten, die keine Mutter je ihren Kindern auch nur einmal erzählen möchte. Und dafür gibt es mannigfache Gründe:
Die Gespenstergeschichte handelt von einer nationalstaatlichen Engstirnigkeit, die sich seit Jahren tagtäglich an unseren Grenzen ereignet, sie spricht von einer neu aufkeimenden postkolonialen Schuld, die sich in jeden einschreibt, der als Bürger im Himmelbett von Burg-Europa zufrieden erwacht. Ich meine, Kinderohren wären der falsche Adressat für diesen Stoff, denn es handelt sich dabei um einen, den nur Erwachsene ihren Machthabern zu erzählen haben. Unentwegt, lautstark und fern postsubversiver 68er-Küchen. Vielleicht, das wäre die Hoffnung des Verfassers, risse diese Erzählung Europas Quoten- und Umfragedemokratien, deren Parlamente längst im Senderaum tagen, aus dem hegemonialen Schlaf. Noch ist es nicht so weit …
Worin, könnte man eingangs fragen, liegt das Beunruhigende dieser Gespenster, die der neue Anti-Humanismus millionenfach produziert? Liegt es an der Tatsache, dass sie nicht unserer Fantasie entspringen, an der Tatsache, dass sie nicht aus dem Jenseits nach uns herüberlangen? Von beiden etwas. Diese Gespenster sind erstmals aus echtem Fleisch und Blut und: Sie sind von hier. Oder sagen wir es präziser, nicht ganz von hier, eher Flüchtlinge von drüben, vom anderen Kap, die nur in Fällen erwünschter Dienerschaft auf der westlichen Wohlfühlmeile sich einzufinden haben. Also immer dann, wenn unser Verwöhnungsapparat personelle Engpässe hat.
Im „humansten“ Fall sind sie ein Körper ohne Antlitz, ein Antlitz ohne Gesicht, eine Anschrift ohne Namen. Eine Anwesenheit in Schubhaft, eine Existenz für den Container. Und die EU? Gesetzt den Fall, der Mann im Mond würde mich danach fragen. Mit Trauer müsste man ihm zur Antwort geben, sie sei längst zur Entsorgung Unerwünschter geschrumpft und stehe unter stärkstem Verdacht, fleißig über Gesetzen zu brüten, wie man die Grundrechte eines jeden Menschen ganz legal in den Boden schrammt.
Würde ein weiterer Hinweis zu diesen uns so unheimlichen Gestalten eingefordert werden, dann wäre noch zu erwähnen: Nachdem wir eine große Zahl dieser Gestalten ins Herz der wahren Finsternis, also nach Amerika verschleppten, haben wir den Rest, der nicht mehr auf die Schiffe passte, geopolitisch von uns abgesprengt. Oder wie es der Buchtitel des karibischen Philosophen Stuart Hall so ganz treffend sagt: The West and the Rest.13
Hier an dieser Stelle müsste dieser Kontinent, der stets mit Stolz auf seine Homogenität, auf seine glanzvolle Selbsterfindung aus dem Nichts verweist, noch seine erste von so vielen Verschleppungstaten in Erinnerung haben. Jene Entführung der phönizischen Tochter Europa durch Zeus. Nur Kadmos, ihr Bruder, sucht seine Schwester Europa in diesem Europa bis heute vergeblich. Sollte vielleicht er der Stammvater aller dieser Gespenster sein? Doch viel Zeit hat sich inzwischen angehäuft und so erkennt der Grenzschutz diese Geschwister von Kadmos bereits als Flimmerpunkte in der Ferne, auch wenn diese nur in der Dunkelheit marschieren; er erkennt sie als infrarote Schatten auf lecken Planken, nein, die Küstenwache Spaniens nimmt ihre Nachtsichtgeräte nicht mehr vom Auge, wenn sie längs der neuen europäischen DDR auf Patrouillenfahrt geht. Europa sieht alles. Und übersieht dabei eines: Wer jeder Ankunft misstraut, ist zur Erwartung des Kommenden nicht fähig.
Monate, Jahre, und viele Sehnsüchte davor waren diese von der westlichen Dürre Geplagten aufgebrochen, als gutgekleidete Studenten, als Lehrer, als Gläubige der Religion Europa, vom Geld ihrer Familien finanziert. Auf flach gedrückten Wasserflaschen, mit einem Fetzen über die Sohlen gebunden, landeten sie schließlich beim Versprechen, das die Vereinten Nationen ihrer Würde gaben. Sie landeten in unseren Wüsten. Dafür gaben ihre Eltern ihr ganzes Erspartes her. Irgendwann an einem Morgen erfährt eine Mutter aus Mali, der Körper ihrer Kinder sei von nun an in den Stacheldrähten von Melilla für immer zu Haus …
Verlassen wir diese Traurigkeit, diesen Bruch der Brüche aller Versprechen und drehen wir unseren Blickpunkt um 180 Grad. Ich lade dafür die Software von Google Earth auf meinen Bordcomputer und drücke den Button, mit dem man das Geographische wendet, dreht, bis unser eigenes Kap von der gegenüberliegenden Seite aus erscheint. Jetzt, als fremdes, als unheimliches Gestade, mit einer fernen Stadt namens Marseille weit im Norden, mit einer noch weiteren im Dunst – Paris. Und während wir uns näher ans fremde, ans maghrebinische Ufer zoomen, an den grobkörnigen Strand, an die immer deutlicher werdende Bucht, die sich wie ein ins Meer gestürzter Sichelmond unter uns zeigt, fahren wir die Jahre zählend retour: 1980, 70, 60, irgendwann in einem Herbst von 1949 machen wir halt. Unter uns erstreckt sich der mächtige Hafen von Algier mit all seinen Schiffen und Booten. Unser Blick retuschiert noch rasch die Geschäftigkeit von heute und lässt die schläfrig maritime Stille von damals zu.
Gerade noch hat eine Mutter, nennen wir sie Georgette, ihren Jungen zum Abschied so herzhaft gedrückt, als ob sie diesen schmächtigen Rücken nie mehr hergeben wollte. Gerade noch … Doch nun ist der noch nicht Zwanzigjährige mit den dichten Brauen und jener Frisur, wie sie italienische Schlagersänger zu ihren silbernen Mofas tragen, seit Stunden auf See. An die Lektüre von Nietzsche, Bergson und Camus, die seekrank aus seinem Mantelsack ragt, ist bei diesem Seegang nicht zu denken, auf diesem Passagierschiff mit Kurs auf Marseille. Aber lassen wir diesen Jungen namens Jacques selber erzählen:
„(…) anderseits gab es das Meer, ein symbolisch unendlicher Raum, ein Schlund für alle Schüler der französischen Schulen in Algerien, ein Abgrund. Ich habe ihn erst mit neunzehn Jahren zum ersten Mal mit Leib und Seele überquert (aber habe ich ihn jemals überwunden?) und zwar durch eine Schiffspassage auf der Ville d’Alger. Es war die erste Reise, das erste Übersetzen meines Lebens, vierundzwanzig Stunden Seekrankheit und Brechen.“14
Jahrzehnte vergehen … Aus Jacques, der wie Camus am liebsten nur Profifußballer in Algier geworden wäre, unter Blicken von Mädchen, die nur die eine Gewohnheit pflegen, nackt zu baden am Strand von Tipasa, aus diesem Jacques, der seine Prüfungen nur mit dem Aufwand aller Kräfte, Nervenkrisen, Aufputschmittel eingeschlossen, im großen elitären Paris doch irgendwann schaffte, ist nach Jahrzehnten ein Jahrhundertphilosoph geworden.
Schnitt. Zurück in die 1980er-Jahre. Eleganter Zweireiher mit gestreiftem Hemd, Stecktuch, dazu passend das weiße Haar. Und statt von zwei armseligen Koffern eingekeilt zu werden, übernehmen nun die Mikrofone der Weltöffentlichkeit diese Funktion. Er wird bis heute der einzige Mann bleiben, den die Postfeministinnen differenzlos lieben. Phallo-Logo-Phono-Eurozentrismus, und je mehr er das Denken Europas von sich weist, kreist der Kontinent um ihn. Unzählige Hochhäuser entstehen rein nach dem Bauplan seiner Sätze, seiner Dekonstruktion. Und ist es ein Wunder? Der Aufschub zwischen schwebender Säule und Boden hält. Wer, wenn nicht er, scheint im Westen, am anderen Kap, erfolgreich gelandet zu sein. Mitten in unserer dichotomischen Eintönigkeit. Könnte man meinen. Doch auf der Rückseite dieses Bildes, am leeren Foto …
Da erkennt man leicht den ganz anderen Derrida, den von diesem rissigen Kap fast seelisch zerfetzten Jungen, der an dieser Küste angekommen war, die ihn nichts als verletzte. Blenden wir zurück: Zu Zeiten des Vichy-Frankreich, das stark mit Hitler kokettierte, wird diesem kleinen jüdischen Jungen die französische Staatsbürgerschaft aberkannt, er darf nicht mehr zur Schule. Er wird gehänselt, verspottet, er ist unter den gebürtigen Franzosen ein Niemand und unter den französisch gemachten Algeriern ein Wurm. Das jüdische Denken ist ihm so fremd wie die Beschneidung. Er sitzt und läuft und atmet in einem Dazwischen, das immer gefährlicher zu werden droht. Er spricht keine dieser Sprachen, kein Jiddisch, kein Arabisch, keinen Dialekt der Berber. Die Stadtviertel, in denen er sich noch aufzuhalten hat, werden immer enger. Bleibt nur die Sprache jener, die ihm und seiner Familie das Menschsein weggenommen hatten. Verbittert schreibt er:
Algerien ist bestzt worden. Ich will sagen, dass es, wenn es je besetzt war, dann gewiss nicht durch deutsche Besatzer. Der Entzug der französischen...