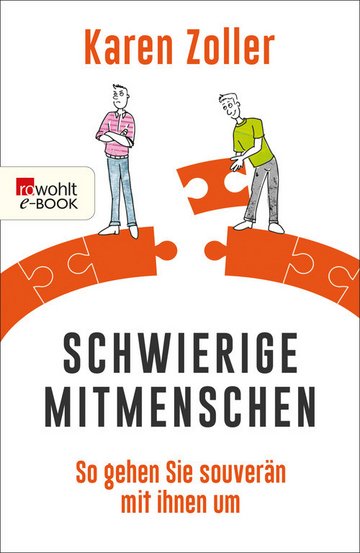1.1 Alles eine Frage der Perspektive
Wenn wir uns mit dem Menschlichen und Zwischenmenschlichen beschäftigen, verlassen wir den Bereich der objektiven Wahrheit und Eindeutigkeit, und wir betreten die bisweilen verwirrende Welt der Subjektivität und Wechselwirkungen. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt und nimmt diese auf eine einzigartige Weise wahr. Aus seinem persönlichen Erleben heraus handelt er für sich selbst logisch und sinnvoll. Das bedeutet aber nicht, dass andere Menschen das ebenfalls so sehen, und es heißt erst recht nicht, dass sie dafür Verständnis haben. Beispiel: Als Personalreferentin ist Frau Mey seit vielen Jahren federführend für die Organisation und Durchführung einer internen Schulung zum Thema Stressmanagement verantwortlich. Ihr Herz schlägt in besonderer Weise für dieses Thema. Entsprechend trifft es sie sehr, als ihr Chef ihr im Rahmen einer Neustrukturierung der Aufgabenbereiche diesen Auftrag entzieht und eine junge Kollegin damit betraut. Frau Mey erwartet, dass die Kollegin sie aufgrund ihrer Erfahrung wenigstens um Rat fragen würde, schließlich hat sie das Thema über Jahre betreut und ist die Expertin! Die junge Kollegin tut jedoch nichts dergleichen. Sie ändert sogar das altbewährte Konzept der Veranstaltung, schließlich möchte sie dem Seminar ihre persönliche Note geben und sich bewähren. Frau Mey ist empört, gekränkt und verärgert. Als sie schließlich von Mitarbeitern angesprochen wird, warum die Einladungen für die nächste Stressmanagement-Veranstaltung noch nicht verschickt worden seien, läuft das Fass über. Frau Mey schreibt der Kollegin eine geharnischte E-Mail, in der sie die organisatorischen Versäumnisse kritisiert und abschließend darauf hinweist, dass sie, Frau Mey, kurz entschlossen das Versenden der Einladungen übernommen habe, um so das Schlimmste abzuwenden.
Während Frau Mey für sich davon ausgeht, die Kollegin müsse dankbar über ihre «rettende» Initiative sein, reagiert diese auf das aus ihrer Sicht eigenmächtige Einschreiten fuchsteufelswild. Sie fühlt sich übergangen, entmündigt und ist tief empört. Es kommt zwischen den beiden Frauen zu einem Streit, in dessen Folge sie wochenlang nicht miteinander, dafür aber umso mehr übereinander reden. Wer von beiden ist in dieser Situation die schwierige Person? Durch das Aufeinanderprallen gegensätzlicher Vorstellungen über korrektes Verhalten sind beide füreinander schwierig geworden.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie viele Faktoren an der Entstehung von Spannungen beteiligt sein können: Der Chef hätte die Umverteilung des Themas besser vorbereiten, begründen und anbahnen können, um so aufkommende Gefühle des Gekränktseins zu vermeiden. Frau Mey hätte gut daran getan, ihre Aktivitäten als Angebot an die eigentlich zuständige junge Kollegin zu adressieren, statt ungefragt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die nicht mehr in ihren Aufgabenbereich fallen. Die neue Kollegin schließlich hätte ihrerseits mit einer diplomatischeren Reaktion gegenüber Frau Mey einigen Ärger abwenden können: «Ich weiß, dass Sie das Thema Stressmanagement in der Organisation und Durchführung bislang erfolgreich betreut haben. Da ich das Thema ja nun übernehmen soll, würde ich sehr gerne Ihr Konzept kennenlernen und hören, welche Erfahrungen Sie bislang mit der Veranstaltung gemacht haben. Ich werde meinen eigenen Stil finden müssen, und der ist sicherlich erst einmal ungewohnt für die Mitarbeiter. Ich würde deshalb gerne mit Ihnen überlegen, wie wir bei Unklarheiten verfahren, zum Beispiel, wenn Mitarbeiter sich bei Fragen zur Veranstaltung an Sie statt an mich wenden. Könnten wir das bei einer Tasse Kaffee mal besprechen?»
Nicht genug damit, dass wir eine Situation wie in diesem Beispiel ganz verschieden erleben, wir sind am Verhalten unserer Mitmenschen nicht selten auch auslösend beteiligt! In emotional brisanten Situationen steht schnell die Frage im Raum, wer von beiden angefangen hat. Meist bezichtigen sich die Beteiligten wechselseitig der Verantwortung: «Ich habe ja nur …, weil du …!» Während das eigene Verhalten lediglich als Reaktion auf das Verhalten des anderen und damit als extern motiviert angesehen wird, wird dem anderen unterstellt, dass er aus Motiven handelt, die in seiner Persönlichkeit begründet liegen: zum Beispiel weil er selbstsüchtig, niederträchtig, kleinlich oder gnadenlos ist.
Beispiel: Eine Abteilungsleiterin erlebt das Verhalten ihrer Mitarbeiterin seit geraumer Zeit als patzig und unangemessen im Tonfall. Sie bittet sie deshalb zum Gespräch, in dem dann bei der Mitarbeiterin eine Menge angestauter Frust an die Oberfläche kommt. Die Chefin sei Strenge und Perfektion in Person, an allem habe sie etwas auszusetzen, nie sei die geleistete Arbeit gut genug. Das reibe sie alles viel zu sehr auf, und damit sei jetzt Schluss! Wenn wir davon ausgehen, dass in den gegenseitigen Vorwürfen jeweils ein Körnchen Wahrheit steckt, scheint es so, als ob beide Frauen aneinander wechselseitig Verhaltensweisen zum Vorschein bringen, die für sich genommen die Bezeichnung «schwierig» verdienen, aber erst im Zusammenspiel der beiden zum Ausdruck kommen und verständlich werden.
Dabei ist die zwischenmenschliche Dynamik längst nicht immer durchschaubar wie hier, sondern häufig viel subtiler. Davon zeugt das folgende Beispiel: In meinen Seminaren bitte ich die Teilnehmer zu Beginn, ein bis zwei schwierige Personen aus dem beruflichen oder privaten Bereich auszuwählen, um sie im Anschluss kurz vorzustellen. Ein Teilnehmer, von Beruf Pharmareferent, berichtete von einer Ärztin, die sich weigerte, ein neues, hochwirksames Krebsmedikament einzusetzen. Er klagte, dass die Ärztin noch nicht einmal ansatzweise bereit gewesen sei, sich mit dem Medikament auseinanderzusetzen. Er habe alles Erdenkliche versucht, sie würde ihn jedoch «kalt abblitzen» lassen. Angesichts der zunächst nicht verständlichen Weigerung der Ärztin bat ich den Teilnehmer, in einem Rollenspiel zu demonstrieren, wie eine Begegnung mit ihr ablief. Nach einer kurzen Begrüßung begann der Pharmareferent in einer wahren Argumentationssalve, die Vorzüge des neuen Medikaments darzustellen. Die Ärztin, gespielt von einer Teilnehmerin, unternahm mehrere Versuche, zu Wort zu kommen, fand jedoch kein Gehör bei ihm. Der Enthusiasmus und die Eindringlichkeit, mit denen der Pharmareferent für sein Produkt warb, hatten etwas Erschlagendes. Die zunächst unverständliche Reaktion der Ärztin erschien nun in einem anderen Licht und wurde angesichts der Vehemenz des Pharmareferenten nachvollziehbar. In der anschließenden Auswertung der Spielszene fragte ich den Teilnehmer, ob er eine Idee habe, weshalb er in seinem Auftreten so energisch werde. Er meinte, der Vertrieb von Krebsmedikamenten sei nicht nur eine berufliche Tätigkeit für ihn, sondern eine persönliche Mission: Er habe seine Mutter im Alter von acht Jahren an den Krebs verloren und wolle heute dazu beitragen, dass Kindern dieses Schicksal erspart bleibe. Seine Erklärung machte nicht nur sein vehementes Verhalten nachvollziehbar, sondern ermöglichte auch die gemeinsame Überlegung, mit welchem Vorgehen und welcher Ansprache er seine Chancen erhöhen könnte, sein Anliegen bei der Ärztin erfolgreicher zu platzieren.
In den genannten Beispielen wird deutlich, dass bei der Betrachtung des Themas «schwierige Menschen» folgende Aspekte eine Rolle spielen:
Wie wir das Verhalten des anderen erleben und etikettieren, hat mit unserer subjektiven Wahrnehmung und mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun. Max Frisch beschreibt diesen Umstand in seinem ersten Tagebuch (1946–1949) mit den Worten: «In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die anderen in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! Auch wir sind die Verfasser der andern; wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich nicht für die Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage.» (1987; S. 27)
Menschen beeinflussen sich in ihren Reaktionen wechselseitig, nicht immer lassen sich Aktion und Reaktion jedoch klar zuordnen. Dies kann dazu führen, dass wir bei Spannungen unser Gegenüber verzerrt wahrnehmen und unser eigenes Verhalten als angemessen, gerecht oder redlich erachten. Als Folge dieser Wahrnehmungsverzerrung erscheint uns unser eigenes Verhalten eindeutig richtig und das des anderen eindeutig falsch. So werden wir unter Umständen selbst zum schwierigen Mitmenschen.
Es gibt Menschen, deren Verhalten von überdurchschnittlich vielen anderen Personen als auffällig oder störend beschrieben wird. Reagiert ein Mensch nicht nur unpassend, sondern häufig auffallend unangemessen, dann liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein stabiles Verhaltensmuster handelt, welches mit seiner grundlegenden Befindlichkeit zu tun hat. Fatal ist es, dann zu glauben: «Wenn ich es nur richtig anstelle, komme ich mit dem anderen zurecht», oder sich selbstzweifelnd zu fragen: «Was habe ich bloß falsch gemacht?» Der Betreffende hat vielleicht gar nichts falsch gemacht, sondern war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort!
Die Frage, wie man mit dem cholerischen Kollegen oder der zickigen Cousine umgehen soll, lässt keine schematischen Antworten zu. Um zu passenden Antworten und passenden Verhaltensweisen zu finden, braucht es Selbstreflexion, Ansätze zur Beziehungsklärung und praktisches Handwerkszeug für die Bewältigung schwieriger Begegnungen. Die Grundfrage lautet: Wer hat in einer Situation mit wem aus welchem Grund welche Art von...