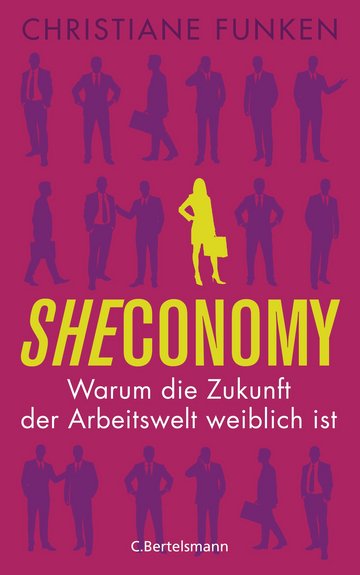Kapitel 2
Mythen erkennen!
»Ich gehörte zu jenen fünfzehn, die ein P mit Stern [Bestnote] bekommen haben. Und deswegen habe ich mich gewundert, weshalb man mir trotzdem nicht die versprochene Führung des Departments gegeben hat. Das hat mich schon sehr geärgert.«
(Maria J., 52)
Die junge Werbetexterin schluckt ihre Selbstzweifel hinunter und sieht konzentriert, vielleicht ein wenig angestrengt in die Runde. Ihr gegenüber sitzen drei Männer um die fünfzig, Repräsentanten eines potenziellen Kunden: des großen amerikanischen Lebensmittelkonzerns Heinz. In der Arena des Büros sind sie gleichzeitig das Publikum und die Punktrichter der bevorstehenden Bewährungsprobe. Für die aufstrebende Texterin ist die Präsentation ihrer Kampagne von immenser Bedeutung; sie entscheidet darüber, ob die Werbeagentur, für die sie arbeitet, den Zuschlag als Werbepartner für die schwächelnde Produktlinie »Heinz Baked Beans« erhält.
Im Laufe ihrer Berufstätigkeit hat sie als Frau gelernt, sich allein unter Männern auf dem schmalen Grat zwischen übertriebenem Ehrgeiz und authentischem Engagement, zwischen Durchsetzungsstärke und Teamgeist zu bewegen. Sie will die Tatsache, dass sie eine Frau ist, nicht verbergen, schreckt aber davor zurück, das ihr fremde Gehabe und oftmals sexistische Verhalten der Kollegen und Chefs offen zu kritisieren. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten erlaubt sie sich nicht, Businesslunches bis in den Nachmittag hinein auszudehnen, um 16 Uhr den ersten Drink zu nehmen oder ihre Arbeitszeit mit Prestige- und Machtkämpfen zu vergeuden. Ihrem beruflichen Erfolg hat sie vieles geopfert, nicht zuletzt ihr Privatleben, und sie will nur durch eines überzeugen: Leistung.
Lange hat sie an ihrer Präsentation gefeilt und an diesem Tag auch ihr Outfit, ein schwarz-weißes, betont modisches, aber hochgeschlossenes Kleid, mit Bedacht gewählt. Nichts will sie dem Zufall überlassen.
Doch kaum hat sie die ersten Worte gesprochen, da ist der Widerwille bei den anwesenden Männern bereits zu spüren. Ein leichtes Stirnrunzeln, aufeinandergepresste Lippen, ein kurzer Austausch der Blicke genügen den Managern von Heinz, um sich gegenseitig ihr Befremden mitzuteilen. Nicht Zorn oder Missbilligung steht in ihren Gesichtern, eher eine herablassende Verwunderung, die sich aus dem tiefsten Inneren ihres beruflichen, »männlichen« Selbstverständnisses speist.
Im Zentrum des neuen Werbekonzepts steht ein TV-Spot, der zeigt, wie heitere Heinz-Bohnen in Zeitlupe eine Art Tanz aufführen, der zu allem Überfluss auch noch Ballett genannt wird.
Der Heinz-Manager macht aus seinem Unbehagen keinen Hehl. »Haben Sie schon mal Bohnen von nahem gesehen?«, fragt er die junge Frau in einem Ton, als spräche er mit einem kleinen Mädchen, das von der realen, unerbittlichen Welt keine Ahnung hat. Im nächsten Satz assoziiert er Bohnen mit blutigen Nieren und dem Koreakrieg, mit Welten also, die ihr unzugänglich sind. Anders gesagt: Anstatt inhaltlich auf ihre Präsentation einzugehen, konfrontiert er sie indirekt mit ihrem Geschlecht.
Als die junge Frau ihre Idee energisch und selbstbewusst verteidigt, anstatt sich eingeschüchtert in der Ecke zu verkriechen, wird das Klima im Raum frostig. Ihr bleibt schließlich nur, durch ein Nicken ihren männlichen Vorgesetzten, der die Szene hinter einer gläsernen Wand beobachtet, um Hilfe zu bitten.
Sobald der Creative Director den Raum betritt, hellen sich die Mienen der Heinz-Manager auf. Sie scheinen erleichtert über die Intervention eines männlichen Wesens, mit dem sie reden können. Der Creative Director versucht gar nicht erst, seine Mitarbeiterin in Schutz zu nehmen und den Managern das Bohnenballett schmackhaft zu machen, sondern äußert Verständnis für ihr Befremden. Statt sich hinter seine Texterin zu stellen, lässt er sie auflaufen und vertröstet die Männer von Heinz in jovialaufgeräumter Manier auf das nächste Meeting, bei dem neue Vorschläge geliefert werden sollen.
Diese Szene spielt in den Sechzigerjahren, in der fünften Staffel der erfolgreichen TV-Serie Mad Men, wie die Werber aus der Madison Avenue im New York jener Jahre genannt wurden. Die Serie ist nicht zuletzt deswegen interessant, weil genau diese amerikanischen Werbeleute als Vorreiter der Wissensökonomie angesehen werden können und jene Entgrenzung und Immaterialisierung von Arbeit vorwegnahmen, die wir heute als selbstverständlich empfinden. In der Serie kämpfen die junge Texterin Peggy Olson, die als Sekretärin beginnt, und Don Draper, der charismatische, manchmal mehr, manchmal weniger alkoholisierte Creative Director, aber auch mit den starren Geschlechterrollen jener Zeit. Denn so fortschrittlich ihr Blick auf die Arbeitswelt ist, so unmodern und stereotyp ist ihr Umgang mit den geschlechtlichen Rollenbildern. Genau diese Parallelität von »alt« und »neu« begleitet uns bis heute.
In den Sechzigerjahren war eine Zurückweisung, wie sie Peggy Olson erlebte, nichts Ungewöhnliches für ambitionierte und junge Berufsfrauen. In Wahrheit galt die Ablehnung nicht ihren Leistungen, sondern ihrem Geschlecht. Insofern – so sollte man meinen – bildet Mad Men eine vergangene, aus heutiger Sicht überholte Zeit ab, in der Emanzipation und Feminismus noch zu den Kampfzonen einiger Exotinnen zählten. In der Serie können wir zudem mit wehmütigem oder mitleidigem Blick das Aufkommen der ersten, im Gegensatz zu heute lächerlich leistungsarmen und zugleich sperrigen Kopierer verfolgen, die alten Autos bestaunen und die nostalgisch anmutenden Haushaltsgeräte.
Autos, Haushaltsgeräte oder Kopierer haben sich dank des technologischen Fortschritts in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Es ist jedoch schwer, einen vergleichbaren Fortschritt in Bezug auf die geschlechtlichen Klischees und Rollenerwartungen in der Arbeitswelt zu konstatieren. Und die Serie Mad Men wäre heute wohl nicht so erfolgreich, würde sie nicht auch Realitäten abbilden, die sich keineswegs so grundlegend verändert haben wie die Computertechnologie oder das Automobil.
Die überwiegende Mehrheit der Frauen in den großen Unternehmen macht, wie meine Studien belegen, Erfahrungen, die jenen von Peggy Olson erstaunlich ähnlich sind.
Hartnäckige Vorurteile
Besonders deutlich zeigt sich dies in meinen Befragungen von Managerinnen der heutigen Generation 50 plus aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben im Laufe ihrer beruflichen Karriere die Wirkmächtigkeit der »gläsernen Decke« in erschreckender Konsequenz erlebt. Die gläserne Decke ist – wie die Metapher hinreichend deutlich macht – unsichtbar und gerade deshalb sehr effizient. Häufig können diese Frauen keinen konkreten Grund benennen, warum ihnen der nächste und im Prinzip letzte, entscheidende Schritt auf der Karriereleiter verwehrt bleibt. Sie beobachten lediglich, dass männliche Kollegen auf dem Weg nach oben beziehungsweise in die Chefetagen erfolgreicher waren, allerdings ohne bessere Leistungen oder mehr Engagement vorzuweisen.
»Es hat nicht alles mit mir zu tun; es hat viel damit zu tun, wie Organisationen strukturiert sind, wie männliche Hierarchien funktionieren. Ich empfand es als sehr entlastend zu merken, nicht ich bin an allem schuld. Ich kann zwar mein Verhalten ändern, damit ändere ich aber bestimmte Rahmenbedingungen noch nicht. Wenn ich heute merke, hier geht es einfach nicht weiter, unabhängig von meiner Person, und ich kann es alleine nicht stemmen, dann weiß ich, dass es nicht an mir, sondern an der gläsernen Decke liegt.« (Maria J., 52)
»Wie wird eine Frau hier in Deutschland denn gesehen? Wird sie überhaupt ernst genommen? Kann sie einfach die ganze geschäftliche Runde einladen, erst Essen, und anschließend besuchen wir noch ein paar Etablissements? Kann sie die Scherze ab, die da in der Männerwelt nach wie vor umhergeistern?« (Petra E., 56)
Aber auch Frauen, die heute Mitte dreißig sind und sich in der Rushhour des Lebens befinden, wenn die Karriere entweder an Fahrt aufnimmt oder versandet, kennen die Probleme, mit denen Peggy Olson seinerzeit zu kämpfen hatte. Sie erleben eine männlichdominierte Kultur, ein Klima, das durchtränkt ist mit Vorurteilen und veralteten Geschlechterstereotypen. Nicht nur weil die Firmenleitungen beziehungsweise hochrangigen männlichen Vorgesetzten oft selbst aus der Generation 50 plus stammen, sondern auch, weil jüngere männliche Kollegen die weibliche Konkurrenz als Einschränkung ihrer eigenen Aufstiegsmöglichkeiten fürchten. Die wenigen Managerinnen wiederum, die es bis in die Vorstandsetagen geschafft haben und als Vorbild für die jüngeren Frauen gelten könnten, sind – so besagt ein weiteres Ergebnis der Studie 50 plus – in vielen Fällen wieder ausgestiegen, da sie ihre Ansprüche und Vorstellungen nicht verwirklichen konnten.
Leider hat dieser Ausstieg von Vorstands- und Führungsfrauen in mittleren und großen Unternehmen nicht zu einem Umdenken oder einer kritischen Bestandsaufnahme der unternehmerischen Kultur geführt, sondern diese im Gegenteil weiter zementiert. Frauen, so eine verbreitete Annahme, sind den Anforderungen im Topmanagement, das heißt in den Machtzentralen des Unternehmens, einfach nicht gewachsen.
Die Situation ist paradox: Einerseits erscheinen uns Aussagen wie »Eine Frau gehört nicht in den Vorstand« oder »Führung ist Männersache« als hoffnungslos rückständig, andererseits ist die Lage für Frauen im (Top-)Management keine grundlegend andere als vor fünfzig Jahren: Sie sind eine Ausnahme, eine Normabweichung, der, wenn...