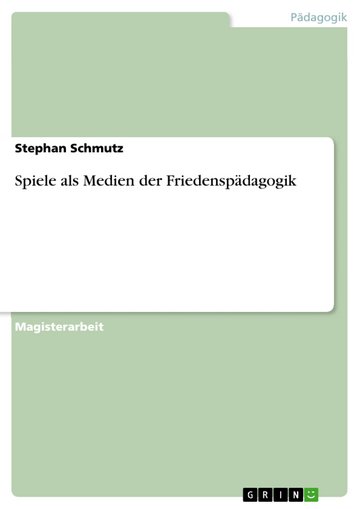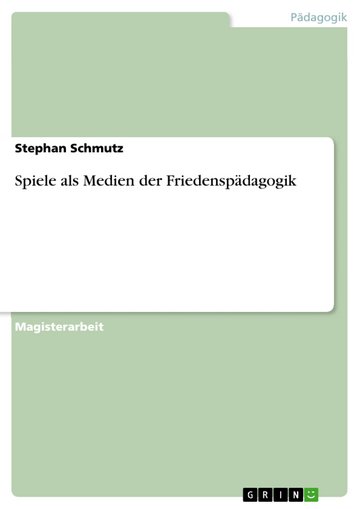Die Bedeutung des Wortes „Frieden“ lässt sich im Deutschen etymologisch von „versöhnen“, ursprünglich „das Beieinandersein“ im Sinne von „das gegenseitige Behandeln wie innerhalb der Sippe“, herleiten. Ausgehend vom tu-Abstraktum zu der in „frei“ vorliegenden Grundlage des indogermanischen pri- mit der Bedeutung „nahe, bei“ entwickelte sich das althochdeutsche Substantiv fridu, das im Mittelhochdeutschen zu vride und später zum heutigen Frieden wurde.[78] Wenn man die Betrachtung auf weitere Kulturkreise ausdehnt, stellt sich bezogen auf das semantische Feld „Frieden“ die griechische eirene als statischer Zustand der Ruhe und Ordnung dar, das hebräische Shalom hat im Tanach die Bedeutung des „unversehrt sein“ oder „freundlich miteinander sein“, das östliche chi wiederum lässt sich als „in seiner Energie sein“ beschreiben. Lexikalisch wird „der Friede“ definiert als
Zustand ungebrochener Rechtsordnung, Zustand der Gewaltlosigkeit; der innerhalb einer Gemeinschaft von Rechtssubjekten wie auch zwischen solchen Gemeinschaften bestehende Zustand eines geordneten Miteinanders, in dem beim Ausgleich bestehender Interessengegensätze auf Gewaltanwendung verzichtet wird.[79]
Den zitierten enzyklopädischen Ausführungen im Weiteren folgend ist Frieden völkerrechtlich negativ definiert als Abwesenheit von Krieg, ein Definitionsansatz, der beim Blick in die griechische Antike überdeutlich wird, in der Friede lediglich eine Unterbrechung des Normalzustandes des gottgegebenen Krieges darstellte. Auch die römische Pax ist zunächst ein Vertragsverhältnis, welches den Krieg beendet, die Pax Romana dementsprechend ein rechtlicher Ordnungsbegriff des römischen Imperiums. Bei der Analyse des biblischen Begriffs stellt sich der Frieden im Alten Testament als besonderes, auf Gerechtigkeit und Vertrauen basierendes Rechtsverhältnis zwischen Gott und seinem Volk dar, Unfrieden entsprechend als die vom Menschen verschuldete Störung dieses Verhältnisses. Die Erlösungstat Jesu am Kreuz begründet als Zeichen der Versöhnung das Selbstverständnis des Neuen Testaments als Evangelium des Friedens. Mit dem Aufkommen souveräner Einzelstaaten und dem Rückgang der christlich-einheitlichen Friedenserwartung verlagert sich die Aufgabe der Friedenssicherung auf die Staaten.
In der Renaissance und während der Reformation werden die christlichen Friedensideale um humanistische Ideen ergänzt. Weitere wesentliche Beiträge zur Friedensidee bilden die Utopien: erstmals entworfen in Thomas Morus’ “Utopia“ (1516) finden sie ihren Höhepunkt in den Werken von Leibnitz, Voltaire, Rousseau und schließlich Kant, der mit seinen Ausführungen „Zum ewigen Frieden“ (1795) die Rechtfertigung des Krieges als ultima ratio verneint. In den Zeiten der Restauration gewinnt das Konzept der balance of power an Einfluss, ab dem 19. Jahrhundert beginnt sich die Friedensbewegung auf die verschiedenen Friedensideen rückzubesinnen. Später werden Erkenntnisse zum Frieden in der Friedensforschung verwissenschaftlicht; der Krieg gewinnt insbesondere durch atomare, biologische und chemische Massenvernichtungswaffen eine neue fürchterliche Dimension.[80]
Wilfried Gerhard ordnet Friedensbegriffe übersichtlich in vier Kategorien. Er unterscheidet die bis heute bedeutsame theologische Kategorie im Sinne eines eschatologischen Friedens, eine etatistische Kategorie des Friedens – gegründet auf eine gesellschaftliche und politische Friedensordnung – drittens die anthropologische Kategorie im Sinne eines Friedens aufgrund anthropologisch unvermeidbarer Dispositionen und schließlich die topologische Kategorie, die den Frieden einem jeweils spezifischen personellen, örtlichen oder sachlichen Rechtsbereich zuordnet.[81]
Neben der anfangs erläuterten lexikalischen Definition und einer Vielzahl weiterer Definitionsmöglichkeiten erscheint für die Betrachtung der pädagogischen Praxis besonders auch der positive Friedensbegriff des norwegischen Friedensforschers und Trägers des alternativen Nobelpreises Johan Galtung geeignet. Dieser geht zunächst von drei Grundsätzen aus. So soll der Begriff „Frieden“ zum Ersten für soziale Ziele verwendet werden, die von einer Mehrheit verbal anerkannt werden, zum Zweiten sollen diese Ziele erreichbar sein, wenn sie auch komplex und schwierig zu erreichen sind, und zum Dritten soll die Definition des Friedens als Abwesenheit von Gewalt erhalten bleiben.[82]
Um dies zu gewährleisten, erweitert Galtung das Postulat der Abwesenheit von Gewalt um den Doppelaspekt der personalen und strukturellen Gewalt. Während der Gesichtspunkt der Abwesenheit direkter personaler Gewaltanwendung den bereits erläuterten und etablierten negativen Friedensbegriff begründet, eröffnet die Abwesenheit struktureller, indirekter Gewalt neue Dimensionen einer Friedensdefinition. Gewalt kann also auch latent oder direkt im strukturellen Bereich vorliegen, z.B. in Form von sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit, Egoismus, mangelnder Solidarität und Kooperation oder nach außen gerichtetem kulturellen, wirtschaftlichen oder machtpolitischen Imperialismus. Ein um diesen Aspekt ergänzter Friedensbegriff fordert zu einer erweiterten Wahrnehmung und zu aktivem Handeln zur Etablierung eines positiven Friedenszustands auf und begründet damit auch neue Felder innerhalb der Friedensforschung, Friedenspädagogik und letztendlich Friedenserziehung. Interessanterweise schlägt Galtung dabei auch, ganz dem Thema der vorliegenden Arbeit entsprechend, das Erfinden von Friedensspielen vor, welche beispielsweise Elemente von Geschicklichkeitsspielen, strategischen Spielen und Glücksspielen vereinen und die bekannten Kriegsspiele ersetzen sollen.[83]
Wenngleich schon Kant und andere vorschlugen, den Frieden zum Thema wissenschaftlicher Betrachtung zu machen, fand eine konkrete institutionelle Begründung dieser Idee erst im Rahmen der Kriegsschuldfragediskussion nach dem Ersten Weltkrieg statt. Ausschlaggebend waren dabei die britischen und amerikanischen Vorschläge auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919 zur Gründung wissenschaftlicher Institute zur Erforschung internationaler Beziehungen. Deutschland brachte sich in diesem Zusammenhang zunächst 1920 mit der Gründung des Instituts für Auswärtige Politik und der Hochschule für Politik sowie darauf folgend 1930 mit der Gründung der Stresemann-Stiftung ein.[84] Nach der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg fand die Institutionalisierung der Friedensforschung erst wieder ab 1955 ihre Fortsetzung, ausgehend von den USA, dann in Kanada sowie schließlich in den Ländern Europas – in Deutschland war dies jedoch erst im Jahre 1969 mit der durch öffentliche Mittel unterstützten Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung der Fall. Im Zentrum des Interesses stand dabei zunächst im Zeichen des Kalten Krieges und der nuklearen Aufrüstung die militärstrategisch orientierte Konfliktforschung. Später kamen, vor allem unter dem Einfluss der außerparlamentarischen Bewegung seit den siebziger Jahren sowie mit der zweiten Friedensbewegung der achtziger Jahre, vermehrt auch alternative Ansätze zum Tragen. Parallel dazu ist ein Trend weg von der klassischen Institutionalisierung und hin zu lockeren Netzwerken zu verzeichnen.[85]
So bedarf es z.B. auch Hermann Röhrs zufolge zur dauerhaften Friedenssicherung zunächst der wissenschaftlichen Erforschung sowohl der dafür notwendigen Voraussetzungen als auch der Gründe für die Entstehung von Krieg. Dementsprechend führt er aus:
Die grundlegende Aufgabe der Friedensforschung als des wissenschaftlich begründeten Versuchs zur Verhinderung von Kriegen ist daher die Erhellung der primären Ursachen für die Entstehung von Kriegen.[86]
Unmittelbar damit verbunden sieht er jedoch auch die Friedenspädagogik und Erziehung zum Frieden als zentrale Aufgabe der Friedensforschung. Dabei betont Röhrs die Ansatzpunkte für eine Friedenspädagogik auf einer persönlichen Ebene, denn diese
bestehen in der Aufklärung über die Möglichkeiten der Friedenssicherung und der Festigung einer Friedensgesinnung – insbesondere durch die Bildungsarbeit.[87]
Erst diese und ähnliche Ergänzungen der Forschungsfelder einer Friedenswissenschaft eröffneten einen erweiterten Wirkungskreis für die adressatenbezogene Praxis einer differenzierten Friedenserziehung.
Die Begriffe Friedenspädagogik und Friedenserziehung werden weder im alltäglichen Sprachgebrauch noch in der Fachliteratur einheitlich verwendet. Praktikabel erscheint der Versuch einer Einordnung der genannten Begriffe von Susanne Lin, die dazu Folgendes ausführt:
Die Friedenspädagogik als Vermittlungsorgan zwischen Theorie (Friedens- und Konfliktforschung) und adressatenbezogener Praxis (Friedenserziehung) leistet durch eigene Theoriebildung und die Entwicklung von Lernmodellen ihren Beitrag...