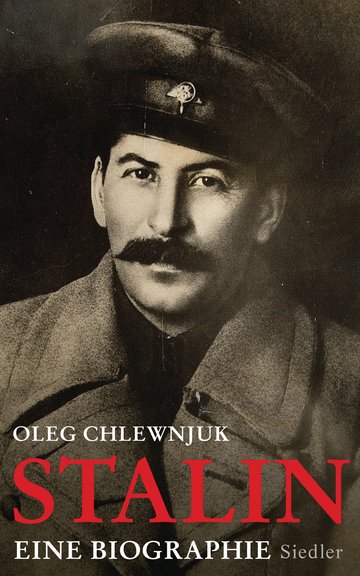Vorwort
Seit mehr als zwei Jahrzehnten studiere ich diesen Mann, die Gründe für seine Taten und die Logik, die ihnen zugrunde liegt – Taten, die Millionen und Abermillionen von Menschenleben kosteten oder sie komplett zerstörten. Diese Arbeit ist zwar aufreibend und emotional belastend, doch ich habe sie selbst gewählt. Zudem verleihen die paradoxen Wendungen der jüngsten russischen Geschichte meinem Forschungsgegenstand eine mehr als nur akademische Relevanz. Wir erleben eine Zeit, in der der Verstand vernebelt wird von Mythen eines »alternativen« Stalin, dessen effiziente Führung als nachahmenswertes Vorbild gepriesen wird.
Die Literatur über Stalin und seine Ära ist unglaublich umfangreich. Selbst Stalinismusforscher geben offen zu, dass sie sie kaum mehr überblicken können. Es finden sich seriöse, sorgfältig recherchierte Forschungsarbeiten neben billigen Machwerken, die nach Belieben Anekdoten, Gerüchte und Lügengeschichten zusammenführen. Beide Lager, seriöse Historiker wie Schwadroneure, die meist Stalin-Apologeten sind, kommen kaum noch miteinander in Berührung und haben jeden Gedanken an eine Versöhnung längst aufgegeben.
Die wissenschaftlichen Stalinbiographien haben dieselben Stadien durchlaufen wie die Geschichtsschreibung über die sowjetische Periode insgesamt. Ich habe große Achtung vor einigen Klassikern, die geschrieben wurden, als die sowjetischen Archive noch völlig unzugänglich waren; zu den herausragenden Autoren zählen etwa Adam Ulam und Robert Tucker.1 Damals, in den Siebzigerjahren, glichen jene auf die Stalinära spezialisierten Historiker Experten für Alte Geschichte: Sie kannten die wenigen verfügbaren Dokumente und Memoiren in- und auswendig und konnten deren Zahl praktisch nicht vergrößern, weshalb sie die verfügbaren Quellen besonders sorgfältig studierten und aufmerksam interpretierten. All dies änderte sich radikal, als in den frühen Neunzigerjahren die Archive geöffnet wurden, und es dauerte einige Zeit, bis die Historiker angesichts der Informationsflut den Kopf wieder über Wasser hielten. Dass gestützt auf das nun zugängliche Material schließlich neue Werke erschienen, und zwar sowohl wissenschaftliche Stalinbiographien als auch andere Studien über die Figur Stalin und das politische System, beweist, dass die Historikerzunft allmählich mit jener Informationsflut zurechtkommt.2
Nach der Öffnung der Archive entstand ein neues Genre von Stalinbiographien, das man als archivgestützten Sensationsjournalismus bezeichnen könnte. Dmitri Wolkogonow, ein ehemals loyales Mitglied der KPdSU, der zu einer treibenden Kraft der Perestroika werden sollte, war einer der Pioniere dieses Genres, ebenso wie der russische Theaterautor Edward Radsinski.3 Ein Merkmal ihrer Arbeiten ist die Verwendung eines breiten Quellenspektrums, das nicht nur Archivmaterial, sondern auch eine Vielzahl von Memoiren umfasst. Diese Autoren neigen dazu, persönliche Berichte »trockenen« Statistiken oder amtlichen Unterlagen vorzuziehen. Die extensive Verwendung von Memoiren, auch von Berichten aus dritter Hand, mag ihre Werke zwar um hübsche Anekdoten bereichern, doch manche der Quellen sind von fragwürdiger Authentizität. Außerdem kann die manchmal nur oberflächliche Sichtung von Originaldokumenten dazu führen, dass der historische Kontext zu kurz kommt. Dennoch: Der »Sensationsjournalismus« hat zweifellos das Stalinbild vieler Leser geprägt. Eine Art dritten Weg beschritt der britische Schriftsteller Simon Sebag Montefiore.4 Er versuchte, die zuweilen trockene Archivforschung leserfreundlicher aufzubereiten, dabei jedoch die Exzesse des »Sensationsjournalismus« zu vermeiden.
Im heutigen Russland ist das Stalinbild in erster Linie durch pseudowissenschaftliche Rechtfertigungsschriften bestimmt. Eine kunterbunte Schar von Autoren trägt mit ganz unterschiedlichen Motiven dazu bei, dass der Stalinismus zu einem Mythos stilisiert wird. Bei den meisten dieser Autoren paart sich ein Mangel an elementarstem Wissen mit der Bereitschaft, kühne Behauptungen aufzustellen. Typischerweise werden Zitate erfunden oder tatsächliche Quellen schamlos verdreht. Die Wirkung dieses machtvollen ideologischen Angriffs auf den Verstand der Leser wird durch die Verhältnisse im heutigen Russland – grassierende Korruption, empörende soziale Ungleichheit – noch verstärkt. Wer die Gegenwart ablehnt, neigt oft dazu, die Vergangenheit zu idealisieren.
Stalins Apologeten versuchen heute nicht mehr wie einst, die Verbrechen seines Regimes zu leugnen; sie schreiben die Geschichte auf subtilere Art um. In ihrer Version der Ereignisse waren Regierungsbeamte unterer Ebenen, Führer der Geheimpolizei oder Sekretäre regionaler Parteikomitees, verantwortlich für die Massenrepression und verbargen ihr Handeln vor Stalin. Der Zynismus einiger gipfelt gar in der Auffassung, der Terror sei berechtigt gewesen, da es sich bei den auf Stalins Befehl vernichteten Millionen Menschen tatsächlich um »Volksfeinde« gehandelt habe.
Viele russische Stalinisten von heute finden es bequem, sich auf Theorien zu stützen, die von einer Gruppe westlicher Historiker, den sogenannten Revisionisten, in den Achtzigerjahren entwickelt wurden: Der Terror sei spontan und von unten entstanden, Stalin habe nur wenig mit ihm zu tun gehabt, und er sei als politischer Führer viel »normaler« gewesen, als üblicherweise angenommen. Es ist nicht meine Absicht, den Kollegen aus dem Westen vorzuwerfen, sie förderten die »Restalinisierung«. Sie sind ohne Zweifel genauso wenig schuld an den politischen Kämpfen im heutigen Russland wie Marx an der bolschewistischen Revolution. Dennoch sollten wir uns bewusst sein, dass unsere Worte ein bizarres Echo haben können.
Eine in der Politik und Öffentlichkeit Russlands weit verbreitete Apologetik ist der Gedanke eines »modernisierenden Stalinismus«. Die Vertreter dieser Ideologie erkennen zwar formell an, dass der Terror zahllose Opfer forderte und für den »Großen Sprung« von der Agrar- zur Industriegesellschaft ein hoher Preis bezahlt wurde, doch sie erklären den Stalinismus zur natürlichen Voraussetzung für die nötige Modernisierung der Sowjetunion und die Kriegsvorbereitung. Ihre Postulate lassen Vorurteile erkennen, die im Bewusstsein der russischen Gesellschaft tief verwurzelt sind: dass die Interessen des Staates absolute Priorität hätten, das Schicksal des Einzelnen bedeutungslos sei und der Lauf der Geschichte von Gesetzen höherer Ordnung bestimmt werde. In diesem Paradigma ist Stalin Ausdruck einer objektiven historischen Notwendigkeit. Seine Methoden seien zwar bedauerlich, aber notwendig und effektiv gewesen, und außerdem sei es unvermeidlich, dass das Rad der Geschichte mit Blut befleckt sei.
Es wäre falsch zu bestreiten, dass die »langen Wellen« der russischen Geschichte den Bolschewismus und den Stalinismus möglich gemacht haben. Ein starker Staat mit autoritären Traditionen, wenig Privateigentum und schwachen zivilgesellschaftlichen Institutionen sowie die gewaltige Ausdehnung einer Kolonialmacht, die unter anderem den Aufbau des Archipel Gulag ermöglichte – all dies ebnete dem stalinistischen System den Weg. Wer diese Faktoren jedoch zu einer Art »russischem Schicksal« überhöht, landet in einer Sackgasse, der Theorie des »unvermeidlichen Stalinismus«. Die Anhänger dieser Theorie haben kaum Interesse an konkreten Fakten und ziehen es vor, stalinistische Interpretationen der russischen Geschichte wiederaufzubereiten, manchmal mit einer überraschenden Wendung, meistens jedoch nicht. Sie vermeiden konsequent jede Frage nach dem Preis der Transformationsprozesse und militärischen Siege, nach alternativen Entwicklungspfaden und nach der Rolle des Diktators. Sie verschließen die Augen vor der Tatsache, dass sogar Stalin selbst zuweilen gezwungen war, seine Politik zu mäßigen, wenn sie eine allzu zerstörerische Krise verursacht hatte – eine Mäßigung, die beweist, dass sogar im Stalinismus verschiedene Wege der Industrialisierung möglich waren. Sie unternehmen nicht einmal den Versuch zu erklären, wie die von Stalin befohlene Hinrichtung von 700000 Menschen allein in den Jahren 1937 und 1938 die »Modernisierung« gefördert haben soll. Insgesamt sieht die Theorie des »modernisierenden Stalinismus« davon ab, die Effizienz des stalinistischen Systems zu prüfen oder Stalins persönliche Rolle bei der Entwicklung der Sowjetunion von den Zwanziger- bis zu den frühen Fünfzigerjahren zu beurteilen.
Die Reduktion der Geschichte auf den historischen Imperativ ist die am wenigsten kreative Art, die Vergangenheit darzustellen. Doch die Geschichtswissenschaft ist dazu verpflichtet, sich nicht mit einfachen Modellen und politischen Vermutungen zu begnügen, sondern sich mit konkreten Tatsachen auseinanderzusetzen. Wer mit Dokumenten arbeitet, kann gar nicht anders, als die komplizierten Wechselwirkungen zwischen strukturellen und persönlichen Faktoren, zwischen bedingten und zufälligen Ereignissen wahrzunehmen. In einer Diktatur haben die persönlichen Vorlieben, Vorurteile und Obsessionen des herrschenden Despoten naturgemäß ein viel größeres Gewicht als in anderen Herrschaftssystemen. Welches Medium könnte besser geeignet sein als die Biographie, um dieses komplexe Geflecht zu entwirren?
Die Biographie ist ein einzigartiges Genre der historischen Forschung, das allerdings stets Gefahr läuft, entweder den historischen Kontext allzu detailversessen zu fokussieren oder aufgebläht zu sein mit romanhaften Details menschlichen Verhaltens. Kontext ohne Seele oder Seele ohne Kontext, das sind die leidigsten Fallen, die der Biograph vermeiden muss. Auch für mich war dies...