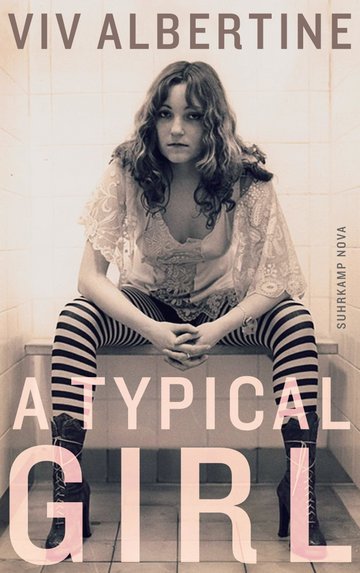12 ZU COOL FÜR DIE SCHULE
1969-1971
Der Musikuntericht an meiner Gesamtschule ist so langweilig, dass wir es extra drauf anlegen, die Lehrerin heulend aus dem Klassenzimmer zu treiben. Wir klappern mit den Deckplatten unserer Schreibpulte und singen: »Raus raus raus.« Funktioniert jedes Mal. Es gibt auch Einzelunterricht, wir haben die Wahl zwischen Kinderliedern auf der Blockflöte oder klassischer Musik auf der Geige. Aber nur uncoole Kinder spielen ein Instrument. Ich habe kein Interesse. Für mich besteht kein Zusammenhang zwischen der Musik, die ich höre, und dem Musikunterricht an der Schule, dazwischen liegen Welten.
Der einzige Lehrer, der Musik interessant vermittelt, ist der Religionslehrer, mit seinem dichten roten Haar, der schwarzen Hornbrille und dem Rollkragenpullover sieht er aus wie einer von Peter and Gordon. Vermittelt durch Musik will er unser Interesse für moralische Fragen wecken. Manchmal dürfen wir eine Platte mitbringen, dann nehmen wir im Unterricht den Text auseinander. Die anderen bringen alles Mögliche mit: King Crimson, Motown, »She's Leaving Home« von den Beatles, Anti-Vietnamkriegs-Songs von Country Joe and the Fish, Hendrix und die Byrds.
Musiker sind unsere wahren Lehrer. Sie öffnen uns – politisch mit ihren Texten und kreativ mit experimenteller, psychedelischer Musik. Sie teilen ihre Entdeckungen und Erkundungen mit uns. Wir reisen nicht so weit wie sie, niemand in meinem Bekanntenkreis hat je in einem Flugzeug gesessen. Wir können dem Maharishi nicht begegnen, aber dank der Musik erfahren wir sehr viel über ihn. Wir hören indische Klänge durch George Harrisons Sitars, entdecken Timothy Leary, R. D. Laing, Arthur Janov und Der Urschrei, LSD, Kalifornien, Woodstock, Unruhen ... was immer sie erleben, wir erleben es durch ihre Songs mit ihnen. Das ist die wahre Volksmusik.
Das Beste an der Schule sind meine Freundinnen. Wir sind ein wild durcheinandergewürfelter Haufen von Mädchen aus meinem Jahrgang, plus dem über und dem unter mir. Wir sind eine Gang. Wir ziehen gemeinsam durch die Straßen oder besuchen uns gegenseitig daheim. Da sind Paula, Sallie, Kester, Sue, Martha, Angela, Judie, Hilary, Myra und manchmal auch noch zwei Jungs, Toby und Matthew. Die meisten kommen aus ärmlichen Familien, haben zu Hause unlackierte Kiefernmöbel und Che-Guevara-Poster an der Wand. Die Eltern sind Kommunisten, Künstler und Intellektuelle. Wir sind immer bei einer von uns – nur nicht bei mir, mein Zuhause passt nicht zu den anderen, hat nicht die richtige Atmosphäre –, wir hängen im Zimmer rum, liegen ausgestreckt auf dem Bett oder sitzen im Schneidersitz auf dem Fußboden, rauchen ein bisschen Haschisch, das wir einem älteren Bruder oder den Eltern geklaut haben. Wir hören Platten, reden über die Schule, Jungs und Musik.
Wenn die Eltern weg sind, gehen wir runter und machen uns ein Omelette, manchmal gehen wir auch ins Kino, aber meistens wandern wir über Hampstead Heath, das kostet nichts.
Wir tragen sehr kurze Röcke, fünfzehn Zentimeter lang, oder Jeans und ein T-shirt. Keine von uns hat viele Klamotten. Wir haben alle lange Haare, in der Mitte gescheitelt, und wir schminken uns nicht: Es gibt keine Frisiersitzungen, kein Fingernagellackieren, keine Haarfärbepartys, nichts davon. Unsere Füße sind schwarz und hart, weil wir barfuß durch Muswell Hill laufen, die Fingernägel kurz und praktisch.
Die Gang: (vorne) Judie, Sue, Angela, Sallie; (hinten) ich, Paula, Kester. Man beachte die psychedelischen Sommeruniformen. 1969 (4)
In meinem vierten Jahr auf der weiterführenden Schule darf ich mittags raus und gehe jeden Tag zu meiner Freundin Judie nach Hause. Reuben, ihr älterer Bruder, hat einen Freund namens Mark Irvin. Mark und ich verlieben uns. Ich bin fünfzehn, er ist siebzehn, mein erster fester Freund. Wir küssen und kuscheln auf Judies Bett und hören ständig Musik: Syd Barrett, Motown, King Crimson, Pink Floyd. Am Wochenende besuchen wir Pubs, sehen uns Konzerte an, streunen über Hampstead Heath und nehmen LSD und Mandrax (»Randy Mandies«). In der Schule wissen alle, dass wir ein Paar sind, wir gehen überall zusammen hin. Eines Tages gehe ich zu einer ungewohnten Zeit zur Schule, weil ich eine Prüfung habe, und sehe Mark Hand in Hand mit meiner Freundin Cathy. Es ist noch so früh, sie müssen die Nacht miteinander verbracht haben. Mir ist, als hätte mir jemand mit einer Eisenstange auf die Brust geschlagen. Ich ringe nach Luft, kann nicht atmen. Das darf nicht wahr sein. Ich mache kehrt und renne. Renne immer weiter. Bis zum anderen Eingang der Schule, ungefähr eine halbe Meile weit entfernt. Zur Prüfung komme ich zu spät, versuche trotzdem, mich zu konzentrieren. Darf mir von den beiden nicht die Zukunft versauen lassen.
Mark (Magnus) (5)
Zwei Tage lang gelingt es mir, Cathy und Mark aus dem Weg zu gehen. Ich bin am Boden zerstört – er ist der erste Junge, den ich geliebt habe, dem ich vertraut habe. Und er hat mich betrogen. In der Sporthalle kommt Cathy zu mir: »Tut mir leid, war ein schrecklicher Fehler. Er liebt dich, nicht mich, er redet die ganze Zeit nur von dir. Es ist aus.« Mark und ich sind wieder zusammen. Wir hatten noch keinen Sex, deshalb fällt es mir leichter, ihm zu verzeihen.
Wir bleiben jahrelang zusammen, wir besuchen Jugendherbergen und Cathy in Wales (wo sie inzwischen mit ihrem neuen Freund hingezogen ist). Auf Gower nehmen wir LSD; als die Droge gerade zu wirken beginnt, läuft »Here Comes the Sun« von den Beatles und ich singe mit. Mark meint: »Du hast eine schöne Stimme.« Das ist das erste Mal, dass jemand etwas Nettes über meine Stimme sagt. Ich werde es nie vergessen, auch wenn ich nicht weiß, ob es überhaupt zählt, weil Mark zu dem Zeitpunkt auf Acid ist. Er entjungfert mich, ich blute ein kleines bisschen. Aber es kommt mir richtig vor, dass er es ist. Er bringt mich auch durch die O-Level-Prüfung in Kunst, macht alle Zeichnungen für mich. Hinterher habe ich ein leicht schlechtes Gewissen, weil ich eine Eins bekomme und besser abschneide als er selbst. Das ist Liebe.
Im fünften Jahr ereilt mich die schreckliche Erkenntnis, dass ich zu lange gewartet habe, um noch gute Noten zu bekommen. Ich war faul, habe geschwänzt und über so viele Jahre keine Hausaufgaben gemacht, dass mich die Lehrer zu manchen Prüfungen gar nicht mehr zulassen wollen. Die Jungs, die mir gefallen, sind schlau und gehören zu den Besten, nur ich bin zu nichts zu gebrauchen. Nachts werde ich von ständig wiederkehrenden Angstträumen verfolgt, ich wandere durch die Gänge unserer Schule, weiß nicht, in welchen Räumen der Unterricht stattfindet; oder ich komme im Schlafanzug am Schultor an, wenn alle anderen schon gehen: Ich bin eine Außenseiterin, eine Versagerin, schwimme immer gegen den Strom.
Schließlich fliege ich von der Schule. Einem neugierigen Lehrer gegenüber gebe ich zu, schon einmal Dope geraucht zu haben – in Wirklichkeit natürlich öfter, immerhin bin ich nicht total bescheuert. Meine Mutter geht in die Schule und besteht darauf, dass ihr der Direktor schriftlich bescheinigt, dass ich nur ein einziges Mal Haschisch geraucht habe und er mich deshalb der Anstalt verweist. Das will er nicht, also darf ich bleiben.
Eines Morgens kommt ein Junge aus der sechsten Klasse während des Englischunterrichts ins Klassenzimmer. Ich bin sechzehn und soll bald meine O-Levels machen. Ich liebe Englisch, Mr Hazdell ist ein toller Lehrer, mit seinem riesigen Schnauzbart sieht er aus wie Biggles und begeistert sich für Shakespeare – er interpretiert die Stücke, haucht ihnen Leben ein, weckt in mir die Liebe zur Sprache. Der aus der Sechsten sagt etwas zu Mr Hazdell, dieser sieht mich an: »Viviane, der Direktor möchte dich in seinem Büro sprechen.« Alle drehen sich zu mir um. Ich habe Angst. Ist jemand gestorben? Als ich zur Tür gehe, komme ich mir wichtig vor. Nicht Mum. Gott würde mir Mum nicht nehmen. Das wäre zu viel.
Ich gehe ins Büro. Meine Schwester wartet dort, wir klopfen. »Herein.« Mr Lowe sieht uns freundlich an, eigentlich ist er ganz nett. »Euer Vater ist hier. Er ist im Zimmer nebenan und möchte euch besuchen.«
Ich bin geschockt. Wir haben Dad seit Jahren nicht mehr gesehen, denken kaum noch an ihn – in den letzten Jahren hat er ein oder zwei langatmige, gefühlige Briefe geschrieben –, was will er denn jetzt hier in der Schule? Wir wollen ihn nicht sehen; wir würden Mum hintergehen, ganz besonders hier, ohne ihre Erlaubnis und ohne vorher mit ihr geredet zu haben. Nicht dass es für mich etwas zu reden gäbe, ich weiß, wie Mum in dieser Hinsicht denkt. Wir bilden zu dritt eine Einheit, schlagen uns gemeinsam ohne Geld durchs Leben, und er hat keinerlei Anteil daran. Wir wollen ihn auf keinen Fall sehen. Ich frage meine Schwester gar nicht, spreche gleich auch in ihrem Namen: Wir wollen unseren Vater nicht sehen. Mr Lowe versucht uns zu überreden. »Euer Vater ist sehr traurig, er will euch nur ein paar Minuten lang sprechen, er meint, eure Mutter will das nicht.« Ich sage ihm, dass es nicht an unserer Mutter liegt, wir wollen ihn nicht sehen. Mr Lowe hat keine Ahnung, was sie durchgemacht hat, welche Opfer sie bringt, indem sie uns alleine großzieht. Ich werde niemandem erlauben, schlecht über meine Mum zu sprechen, ihr Vorwürfe zu machen.
Mr Lowe verlässt den Raum. Meine Schwester und ich bleiben schweigend sitzen, es gibt nichts zu sagen. Ich ärgere mich, dass Dad sich in meine Gefilde wagt, mich im Unterricht stört, ich wegen ihm herausgegriffen werde. Das ist zu viel für mich, so peinlich, dieser...