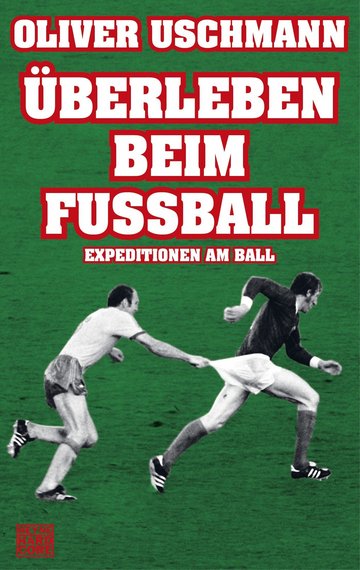Der 10er
Der Regen prasselt auf die Altglascontainer unter der Kiefer mit den langen Nadeln, die auf der grünen Insel vor den Parkbuchten steht. Zwischen den Tropfen glitzert die Neonreklame über dem Eingang des Rasthofs. Drinnen, an den Pissoirs des Wellnessklos Sanifair, lassen die Männer es laufen, starren dabei auf die Werbetafeln auf Augenhöhe und sind mit jeder Sekunde der Erleichterung mehr davon überzeugt, dass sie in Zukunft ihr Auto nur noch zu Euromaster bringen. In den Lastern schlafen die Fernfahrer hinter zugezogenen Vorhängen. Ich sitze in meinem Mietwagen auf Lesetournee, Kartons voller Bücher im Kofferraum, trinke einen Kaffee aus dem Pappbecher und höre Fußball im Radio. Ein Pick-up rollt neben mir auf den Parkplatz, ein altes Modell, mit hohem Radstand und einer Ladefläche, auf die sie in Norwegen erlegte Elche verladen. Ich werfe einen Blick auf den Mann, der aus dem 20-Liter-Koloss steigt und denke mir sofort: Da ist eine 2.
In meiner Fantasie verwandelt sich sein kariertes Holzfällerhemd in ein Fußballtrikot mit eben dieser Rückennummer drauf. Der 2 in ihrer ursprünglichen Bedeutung als Zahl für einen harten, kräftigen, unnachgiebigen Außenverteidiger. Das ist so ein Hobby von mir, wenn ich reise oder durch Bahnhöfe, Fußgängerzonen und über Volksfeste laufe. Ich beobachte die Leute und ordne ihnen Rückennummern zu; streife ihnen in Gedanken ein Trikot über, das zu ihrer Ausstrahlung passt.
Die Zahl, die bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren hat, ist die 10. Früher trug sie fast ausschließlich der zentrale Spielmacher. Heute vergibt man sie auch an eine Sturmspitze wie Zlatan Ibrahimovic oder einen Linksaußen wie Lukas Podolski. Es ist die begehrteste Rückennummer im Fußballsport. Wer die 10 trägt, muss nicht mehr in der Mitte spielen, gilt aber trotzdem als zentraler Charakter in einer Mannschaft, als herausragende Kraft. Die Nummer 10 ist Ehrensache und Verantwortung. Die Nummer 10 ist ein Ritterschlag.
Der Pick-up-Fahrer mit der gedachten Rückennummer 2 spart sich die 70 Cent für die Erlebnistoilette, stapft vor meiner Windschutzscheibe in den Wald, schiebt mit seinen haarigen Armen ein paar kleine Fichten beiseite, baut sich breitbeinig auf und entleert seine Blase in die Pampa. Der Strahl, der goldgelb dampfend zwischen seinen Beinen erscheint, ist so heftig wie eine Sturzflut und so breit wie ein Abschleppseil. Zischend zersetzen sich die Brennnesseln und kleinen Büsche, auf die er trifft, als bestünde er aus reiner Salzsäure. Ich kann den Blick erst abwenden, als der 2er-Koloss sich umdreht, die Hose zuzieht und direkt in Richtung meiner Windschutzscheibe guckt. Ruckartig reiße ich den Kopf nach unten und tue so, als ob ich auf dem Boden des Wagens dringend nach einem Erbschein suchen muss. Der Mann steigt wieder in seinen Wagen, lässt den Motor an, löst dadurch ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richterskala aus und fährt davon.
Zwei Stunden später erreiche ich mein Etappenziel. Den Ort, an dem ich morgen früh in der Schule auftrete. Das abgewohnte, spießbürgerliche Hotel sieht schon von außen aus wie die Mordkulisse aus einem alten »Tatort«. Ich bin nicht Stephen King oder Frank Schätzing, und so kommt es vor, dass die Veranstalter, die meine Lesung bezahlen, mir nicht selbstverständlich ein Vier- oder Fünf-Sterne-Haus buchen. Müssen sie auch gar nicht. Jahr für Jahr erkläre ich dem Verlag, er solle den Veranstaltern sagen, dass ich für kleines Geld lieber in einem anonymen, aber sauberen Ableger einer Hotelkette logiere. Ein Motel One, ein Ibis oder meinetwegen auch ein B&B. Selbst ein Ibis Budget, früher Etap, mit seinen aus einem Stück Hartplastik gegossenem UFO-Bad wäre mir noch lieber als diese gruseligen Gasthäuser zum röhrenden Hirsch, in denen der Teppich im Treppenhaus heute noch die Umrisse von Kotzlachen zeigt, die entstanden sind, als Elvis Presley seine erste Single herausbrachte. Aber die Veranstalter verstehen es nicht. Sie denken, »kalte« Hotelketten wären böse und kapitalistisch und würden mich in meiner Haltung kränken. Sie denken, wer früher in einer Punkband sang und heute noch über Fußball und Festivals schreibt, der findet finstere Gasthäuser und stinkende Spelunken irgendwie »kultig«, so auf ironische Art. Sie denken, ich sei bescheiden und rustikal, hartgesotten wie der Pick-up-Fahrer, anspruchslos und ausdauernd. Kurz: eine echte Rückennummer 2.
Ich schalte den Wagen aus, lehne den Kopf an und stelle mir vor, wie die Fußballstars mit der Rückennummer 10 sich verwöhnen lassen. Sie kommen nach dem Spiel in Hotels, die teurer sind als ganz Guatemala und größer als Liechtenstein. Gebäude mit plätschernden Wasserläufen auf sieben gläsernen Ebenen, lautlosen Aufzügen und warmen Whirlpools auf dem Zimmer, an deren Enden bereits sinnlich lächelnde Masseusen warten, um sich den verspannten Muskeln an Nacken und Füßen anzunehmen. Die 10er bekommen alles, was sie verlangen, weil sie wichtig sind und gut und weil sie einfach davon ausgehen, dass sie es verdient haben. Ich hingegen schimpfe nicht mal, wenn sich abends beim Fernsehen auf dem Zimmer wegen Pilz in der Wand plötzlich die Tapete ablöst und wie ein gigantisches Stück alte Haut langsam auf meinen Körper hinabsinkt.
Aber heute, denke ich mir im Mietwagen auf dem Parkplatz vor dem Gasthof, heute wird das anders. Ich kann zwar nicht mehr das Hotel wechseln, aber ich kann endlich mal Würde zeigen. Die Würde eines Mannes, der sich selbst das Beste wert ist und der sich wenigstens beschwert, wenn er es nicht bekommt. Die Würde eines 10ers. Ich schließe die Augen und stelle sie mir vor, die 10er der Gegenwart, die sich schlechte Zimmer nicht gefallen lassen würden. Arjen Robben. Zlatan Ibrahimovic. Mesut Özil. Nein, der Mesut ist zu schüchtern, der ist eine Ausnahme. Aber Arjen? Oder gar Zlatan? Was würde Zlatan tun, wenn ihm etwas nicht passt? Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf, steige aus dem Wagen und stelle mir ganz fest vor, ich trüge ein Trikot mit der Rückennummer 10. Dann gehe ich hinein.
Die gedachte Nummer auf dem Rücken hilft.
Als ich das Zimmer betrete – laut selbstsicher grinsendem Wirt »das beste des Hauses, sozusagen unsere Suite, das einzige mit Wanne!« –, finde ich im Bad nicht nur keine Masseusen vor, sondern starre ungläubig auf das Bündel alter Haare im Abfluss, das sich stramm und fest um die Löcher gewickelt hat. Im Krümmer des weißen Klos herrscht die Grundfarbe Kackbraun. Unter dem Bett liegt ein kleines, totes Tier. Obwohl, so klein ist es gar nicht. Eigentlich ist es sogar ziemlich groß. Der Wald grenzt an das Gasthaus. Es könnte ein Waschbär sein. Oder ein Dachs.
Normalerweise würde ich jetzt – mit dem Bewusstsein einer Rückennummer 2 und dem schlechten Gewissen, dass ich über gar nichts meckern darf, solange in Afrika Kinder sterben – beschließen, mich erst im nächsten Ort wieder zu waschen, die Socken die ganze Zeit anbehalten, mir ein Badetuch nehmen und den stinkenden Dachs kommentarlos an der Rezeption vorbei raus in den Wald tragen. Dabei würde ich den Kadaver noch vor den Blicken des Wirts verbergen, ganz so, als müsse mir diese Aktion peinlich sein.
Aber heute nicht!
Heute bin ich ein 10er!
Ich stapfe die alten Dielen hinab und gehe an die Rezeption, die lediglich der Tresen der Wirtschaft ist. Der Wirt quasselt mit Stammgästen aus dem Dorf, alten Jägern, die nach billigem Rasierwasser riechen.
Ich baue mich vor der Theke auf, statt schüchtern abzuwarten, breite Brust, Becken nach vorne geschoben, Kiefer gespannt. Eine 10. Der Wirt schaut mich an. Ich sage, so langsam und betont wie ein überlegener, erhabener Steilpass von Zidane: »Kommen Sie mit!«
Der Wirt zuckt gegenüber seinen Jägern mit den Schultern, stapft hinter mir die Treppe hinauf und folgt mir ins Zimmer. Ich zeige ihm die krustige Scheiße, die Haare im Siphon, den toten Dachs.
»Es ist Ihr einziges Bad mit Wanne«, sage ich, »und Sie können nicht mal die Haare entfernen?«
Der Wirt will etwas erwidern. Ich kenne das. Höre es schon an der Art, wie er Luft holt. Er will mich nun totquasseln mit Erklärungen, die er so laut und so kantig wie möglich vorträgt, bis ich müde bin und aufgebe. So machen das alte Kerle mit groben Poren immer. Ich hebe die Hand, und er verstummt, bevor er überhaupt beginnen kann. Weil er mir ansieht, dass ich nicht mit mir reden lasse. Dass ich nicht über etwas diskutiere, was indiskutabel ist. Er spürt es, weil ich innerlich immer noch die 10 trage.
»Was tun wir jetzt?«, frage ich.
Der Wirt sagt, so langsam und betont wie ein Kollege, der nach langer Zeit mal wieder einem Fachmann begegnet ist, den man respektieren muss: »Kommen Sie mit!«
Wir gehen in die Wirtschaft.
Ich darf mir aufs Haus ein Gericht von der Karte aussuchen und Freibier bestellen. Während ich das erste kühle Pils trinke und auf meine Käsespätzle warte, telefoniert der Wirt sehr laut und lässt dabei die Worte »Haare«, »Rohr« und »Iltis« fallen. Es war wohl doch kein Dachs.
Eine Viertelstunde später betreten eine schimpfende Frau sowie ein Mann in grüner Arbeitskleidung mit Mundschutz und gelben Handschuhen das Haus. Sie debattieren noch einen Moment mit dem Wirt und...