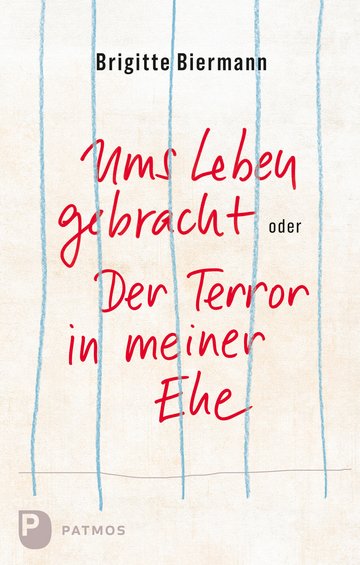Samstagabend, Anfang März 2007
Die Zeit verging wie im Flug, meine liebe kleine Julia. Die paar Tage allein in einer Zelle fand ich gar nicht so schlecht. Ständige Gesellschaft von Menschen ist nicht mein Ding, noch dazu, wenn ich mir die Leute nicht aussuchen kann. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Nach der Erfahrung mit der Irren wünsche ich mir nur, dass sie einigermaßen normal sind.
Seit zwei Tagen wohne ich mit drei anderen Frauen zusammen. Die Zelle ist etwa so groß wie unsere Küche zu Hause. Rechts neben der Tür, hinter einer dünnen Wand, sind Toilette und Waschbecken. Aus dem Hahn kommt nur kaltes Wasser, man soll schließlich morgens wach werden. Darüber ist eine Ablage für die Zahnputzbecher. In der ersten Zeit hab ich auf der Toilette überhaupt nichts hingekriegt, man hört nebenan jeden Pups. Jetzt mache ich morgens im Bett Bauchgymnastik, nun geht es besser. An den beiden Längswänden steht ein Spind, für jede von uns eine Hälfte, dahinter jeweils ein Doppelstockbett. Neben den unteren sind winzige Ablagen angebracht, wer oben schläft, kann ein paar Sachen auf ein Brett an der Wand stellen. Unter dem Fenster ist ein Tisch mit vier Stühlen.
Mir blieb ein unteres Bett. Ich hasse es zwar, in so einer Art Höhle zu schlafen. Aber wer hier wählerisch ist, hat ein Problem. Und ich brauche nicht noch ein Problem. Das Kopfkissen ist eine Art Keilkissen, die Matratze ebenfalls hart. Zwei Wolldecken werden in einen blau-weiß-karierten Bezug gezogen. Kuschlig fühlt sich anders an, aber alles ist sauberer und gepflegter als in den Aufnahmezellen.
Die anderen Frauen haben Fotos neben und über ihren Betten, von Kindern, von Männern, von Eltern und Freundinnen. Ich habe nicht mal ein Foto von dir, Julia. Ich trage die Bilder in mir, sie gehen niemanden etwas an. Das ist die einzige Form von Privatheit, die ich mir hier leisten kann.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ein Stück Mauer von der Kirche und durch das Gitter geviertelten Himmel. Keinen Baum. Wie hab ich in jedem Frühjahr auf das erste Grün an den Bäumen, auf das erste Amselgezwitscher gewartet! Aber auch daran darf ich nicht denken, ich schiebe solche Gedanken ganz schnell beiseite, wenn sie angeflogen kommen. Wenn wir das Fenster öffnen, hören wir morgens und am späten Nachmittag Krähengekreisch. Die haben wohl in der Nähe ihren Versammlungsbaum. Ob die eine innere Uhr haben? Pünktlich 17 Uhr kommen sie von überallher angerauscht, hocken im Baum und krakeelen.
Ich habe wieder angefangen zu rauchen, was ich in der U-Haft problemlos lassen konnte. Weil meine drei Mitbewohnerinnen rauchen, würde ich ohnehin zugeräuchert werden. Ist nur schade ums Geld. Die Beamtin, die mich eingewiesen hat, meinte, Langstraflerinnen leben in einer Wohngruppe, da sind nur jeweils eine oder zwei Frauen in einer Hütte, so nennt man die Zellen hier. Sobald ich umziehen darf, will ich mir das Rauchen wieder abgewöhnen.
In der Untersuchungshaft ging es lockerer zu, die Bediensteten begegneten uns fast freundschaftlich. Aber da waren wir auch viel weniger Frauen. Hatte man irgendein Anliegen, ging man direkt ins Büro. Hier muss man für jeden Quark einen schriftlichen Antrag stellen. Und in der U-Haft konnten wir die eigenen Klamotten anziehen, auch eigene Bettwäsche benutzen. Sandra war so lieb und hat meine schmutzigen Sachen an der Pforte abgeholt, gewaschen und die sauberen gebracht. Was sie schon alles für mich getan hat, könnte ich nicht mit Gold aufwiegen!
Als ich hierherkam, wurde ich zur Effekte gebracht, das ist der Raum, in dem unser privater Kram, der hier Habe heißt, in Tüten verplombt, lagert. Ich musste mich vor einer Beamtin splitterfasernackt ausziehen. Das ist schon ziemlich demütigend. Dann bekam ich Anstaltssachen: Bettwäsche, Geschirr (Plastik), Besteck (Alu), Anziehsachen. Die Jeans, T-Shirts und das Sweatshirt sind okay, auch mit den Plastiklatschen komme ich klar. Aber du solltest diese Arbeitsschuhe sehen: Hartes, schwarzes Leder, derbe Sohlen, starr wie ein Brett, schiefgelaufene Absätze, der Schnürsenkel des linken einmal geknotet, am rechten kleinen Zeh ein Lederflicken. Außerdem scheuern sie an den Hacken.
»Nehmen Sie die erst mal, Frau Schwarz, sicher finden wir später passende«, hat die Beamtin gesagt.
»Soll ich im Steinbruch arbeiten?«, hab ich gefragt. »Die Schuhe wären gut dafür!«
»Natürlich nicht. Vielleicht erst mal als Hausmädchen.«
Hausmädchen hört sich vornehm an. Ist aber so vornehm wie diese Schuhe, erfuhr ich: Flure und Treppen reinigen und bei der Essenausgabe helfen, je nachdem, wo Not am Mann ist. Beziehungsweise an der Frau.
Hauptsache, ich muss nicht den ganzen Tag tatenlos rumsitzen.
Noch ekliger als die Schuhe ist die Unterwäsche. Buchsen hätte meine Mutter diese Unterhosen genannt; Achselhemden, BH, alles aus kochfester Baumwolle. In die Wäsche hatte ich Namensschilder zu nähen, denn gewaschen wird der Kram aller Frauen in Riesenwaschmaschinen, sagte die Beamtin. Oh nee, das darf ich mir nicht ausmalen. Andererseits will ich nie mehr sogenannte Dessous anziehen. String-Tangas, die in der Pofalte klemmen. Spitzen, die bei jeder Bewegung pieken und jucken. Aber das ist Vergangenheit.
Da fällt mir das erste Weihnachtsfest nach unserer Hochzeit ein, als ich Jochen einen dunkelblauen Kaschmirpullover schenkte. Jede von uns Verkäuferinnen durfte sich ein Stück aussuchen und zu einem dicken Mitarbeiterrabatt kaufen. Die Chefin war erstaunt, dass ich etwas für meinen Mann ausgesucht hatte und nichts für mich. »Nehmen Sie doch die Jacke, Andrea«, hat sie gesagt, »dieses Rot würde an Ihnen toll aussehen! Oder diesen Oversize-Pullover, den Sie zu Leggins oder zu einem engen Rock anziehen können!«
Aber nein, ich wollte Jochen eine Freude machen. Was gründlich schiefging.
Glücklicherweise haben meine Eltern nicht miterlebt, wie Jochen getobt hat: So ein teures Geschenk, zieht er sowieso nie an, braucht nicht solchen Kram, er braucht eine Frau, die ihn anmacht, für das Geld hätte ich mir supertolle Dessous kaufen können, da gäbe es doch jetzt so geile Spitzenbodys, ich solle das gleich nach Weihnachten umtauschen und nicht wagen, für so einen Kram jemals wieder Geld auszugeben …
Ich habe den Pullover wirklich umgetauscht. Ich lief wohl dunkelrot an vor Scham, als meine Chefin das mitbekam. Sie hat mich ganz eigenartig angesehen, aber taktvoll geschwiegen.
Ach, Julia, ich hätte deinen Vater nie heiraten dürfen. Aber welche Tochter hört schon auf die Ratschläge der Mutter? Wirst du eines Tages auf Tante Sandras oder gar mein Urteil achten? Meine Mama hatte nichts verurteilt, nur immer gefragt: »Bist du sicher, dass er der Richtige für dich ist? Liebst du ihn ehrlich? Möchtest du mit ihm alt werden?«
»Nein, nein, nein!!!«, hätte ich am liebsten geantwortet. Hab stattdessen genickt und den Mund gehalten, wie so oft.
Es hat lange gedauert, bis ich mir eingestanden habe, dass Jochens Bemühungen um mich mir lediglich geschmeichelt haben. Seit der Pubertät, als die Mädchen in meiner Klasse anfingen, sich zu schminken und aufzubrezeln, habe ich mich klein und hässlich gefühlt – Busen und Hüften zu dick, die straßenköterblonden Haare zu dünn, schiefe, vorstehende Zähne und ein Segelohr. Und dann, ich war gerade siebzehn geworden, erschien Jochen auf der Bildfläche: zwei Jahre älter als ich und einen Kopf größer, ein Kerl wie ein Schrank, dichtes, schwarzes Haar. Er nahm mich mit auf den Fußballplatz und ins Kino, ging mit mir in die Disco, immer liefen wir Hand in Hand, er tat, als müsse oder wolle er mich beschützen. Aber wovor nur? Blicke ich heute zurück, sehe ich mich als sein Spielzeug, nicht als seine gleichberechtigte Freundin. Andererseits imponierte er mir. Er arbeitete als Schlosser in einer Autowerkstatt, fuhr einen roten Golf, und seine Küsse zeugten von mehr Übung als Jürgens unbeholfene Zärtlichkeiten.
Jürgen war mein erster Freund gewesen. Da war ich 16, und es dauerte nur einen Sommer. Jürgen brachte mir auf der Betonpiste hinter dem Sportplatz das Skaten bei, wir hockten stundenlang vor Opas ehemaligem Schafstall, tranken Cola, erzählten uns Geschichten, knutschten und fummelten ein bisschen rum, mehr kam uns beiden nicht in den Sinn, mir zumindest nicht. Diese erste Liebe endete, als seine Familie wegzog. Ich glaubte damals, die Welt geht unter, so hab ich gelitten. Aber dann tauchte Jochen auf. Er war lustig und lieb, drängte mich erst mal zu nichts, wollte ständig mit mir zusammen sein. Ich dachte, ich sei in ihn verliebt. Dabei gab es Zeichen, die mich hätten stutzig machen sollen.
Einmal wartete Jochen vor dem Geschäft auf mich, als ich mit einem Kunden aus dem Laden trat. Der Kunde hatte mir irgendwas Lustiges erzählt, ich weiß nicht mehr, was, ich musste jedenfalls herzhaft lachen. Kaum saß ich neben Jochen im Auto, hat er mir eine geklatscht und mich angeherrscht, ich solle gefälligst nicht mit anderen Kerlen rummachen, ein für alle Mal solle ich mir das merken, das könne er nämlich überhaupt nicht vertragen.
»Ich habe nicht rumgemacht, und so lasse ich nicht mit mir umgehen, das kenne ich nicht von zu Hause, und das will ich nicht, ich will dich nie mehr wiedersehen!«, hab ich ihn angeschrien, bin ausgestiegen und nach Hause gerannt.
Ein paar Tage gelang es mir, ihm aus dem Weg zu gehen, dann hat er mir aufgelauert und sich entschuldigt und versprochen, nie wieder würde das vorkommen, ich solle nur bitte wieder zu ihm zurückkehren, er würde mich doch so sehr lieben. Und ich dumme Kuh bin drauf reingefallen, und es musste sehr viel geschehen, bis ich...