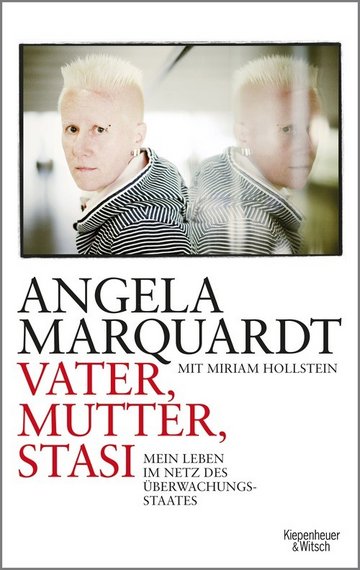2 Wie die Stasi in mein Leben kam
Wenn heute von der »Stasi« die Rede ist, dann stellen sich viele darunter furchteinflößende Männer vor, die mit stundenlangen Verhören ihre Opfer zu Geständnissen zwingen. Gestalten in Grau, die man sofort am finsteren Blick erkennt. In meiner Kindheit und Jugend kam die Abkürzung »Stasi« nicht vor. Bewusst wahrgenommen habe ich diesen Begriff erst, als ich im Fernsehen kurz vorm Mauerfall Berichte über die Montagsdemos in Leipzig sah. Da hielt jemand ein Plakat mit der Aufschrift »Stasi in die Produktion« hoch.
Was ich kannte, war das Ministerium für Staatssicherheit, auch kurz MfS genannt. Als ich in die dritte, eine sogenannte R-Klasse mit erweitertem Russischunterricht, kam, traf ich dort einige Kinder, deren Eltern für das Ministerium arbeiteten. Das war relativ normal. Wenn die Lehrerin zu Beginn des Schuljahres die Berufe der Eltern abfragte, dann sagten diese Kinder: »Mein Vater arbeitet für das Ministerium des Innern.« So wurde es auch ins Klassenbuch eingetragen, oder als Abkürzung »MdI«. Das war die offizielle Umschreibung dafür, dass jemand für die Staatssicherheit arbeitete.
Erst später begriff ich, dass in dieser Klasse fast ausschließlich Kinder aus privilegierten Familien oder, wie man zu DDR-Zeiten sagte, »aus der Nomenklatura« waren. Mit neun hat man für so etwas noch keinen Blick. Ich war hier gelandet, weil ich in der ersten und zweiten Klasse zu den Besten gehörte, so dachte ich jedenfalls. Auch die Herkunft spielte eine Rolle. Schüler aus staatsfernen Familien hätten wohl auch mit guten Leistungen kaum Chancen gehabt, in die R-Klasse aufgenommen zu werden.
Klar war, dass der Schulbesuch nicht nur den Weg zum Abitur erleichterte, sondern auch bei der späteren Berufswahl ungemein hilfreich sein konnte. Permanent wurde uns eingebläut, dass wir die zukünftige Elite seien. Beim Fahnenappell und zu russischen Feiertagen mussten wir im Sinne der deutsch-sowjetischen Freundschaft zum Beispiel russische Lieder singen und ein Programm gestalten. Außerdem machten wir eine Klassenfahrt nach Moskau. Besonders vom Besuch beim einbalsamierten Lenin, der im Mausoleum unter Panzerglas aufgebahrt ist, war ich tief beeindruckt.
Meine besten Schulfreunde waren zwei Jungen, Mikhael und Frank. Schon als Kind habe ich lieber mit Jungen gespielt. In meinen Zeugnissen stand dreimal: »Durch ihr burschikoses Verhalten fördert sie den Zusammenhalt zwischen Jungen und Mädchen.« Bei den Lehrern bekam ich deshalb den Spitznamen »Engel mit B.« in Anspielung auf meinen Namen.
Meine Mutter hatte ursprünglich mit einem Andreas gerechnet. Als ich mich nach 30 Stunden Wehen endlich auf die Welt getraut hatte, musste sie feststellen, dass sie sich einen anderen Namen suchen musste. Zufällig stieß sie noch im Krankenhaus im SED-Organ Neues Deutschland auf einen Artikel über die amerikanische Kommunistin Angela Davis, die damals in den USA zu Unrecht des Mordes angeklagt war und in der DDR sehr verehrt wurde. Nach der Lektüre des Artikels war die Entscheidung gefallen.
Anders als bei Kindern, deren Eltern als hauptamtliche Mitarbeiter für die Staatssicherheit arbeiteten, war die Stasi nicht von Anfang an in meinem Leben gewesen. Sie tauchte darin erst auf, zunächst unsichtbar, als ich etwa neun Jahre alt war. Mit Michael, dem neuen Lebensgefährten meiner Mutter. So hat sie es jedenfalls später erzählt.
Bis zu meinem 7. oder 8. Lebensjahr hatte meine Mutter mit meinem leiblichen Vater zusammengelebt. Während meiner ersten Lebensjahre studierten meine Eltern noch an getrennten Orten. Mein Vater lebte in Dresden, und meine Mutter war zum Studium in Zwickau. Ich wuchs allein bei meiner Mutter auf. Das heißt: Ganz am Anfang war ich in einer Wochenkrippe, in die mich meine Mutter montags brachte und aus der sie mich freitags wieder abholte. Eines Tages wurde die Krippe überraschend geschlossen. Meiner Mutter wurde gesagt, dass dort Kinder misshandelt worden waren. Von diesem Zeitpunkt an blieb ich bei meiner Mutter im Studentenwohnheim.
Nach ihrem Pädagogikstudium fand meine Mutter eine Stelle in Greifswald. Kurz danach zog auch mein Vater zu uns, der als Ingenieur im Kernkraftwerk Lubmin anfing. Die Jahre des Zusammenlebens mit ihm waren meist eine Tortur. Denn mein Vater war ein Sadist. Einmal verbrannte er mir meine Hand auf der Waschmaschine, weil ich ihn gefragt hatte, ob diese heiß sei. Er nahm daraufhin meine Hand, presste sie auf den Metalldeckel der laufenden Maschine und sagte: »Jetzt weißt du, ob es heiß ist.« Es war eine Kochwäsche, die darin lief.
Ein anderes Mal packte er mich bei einem Besuch der Marienkirche in Greifswald, als wir oben auf dem Turm standen, und hielt mich mit einer Hand kopfüber über die Balustrade. Ich hatte Todesangst. An mein »Vergehen« erinnere ich mich nicht mehr, aber eigentlich war für meinen Vater schon jegliche Form von nicht funktionieren ein Vergehen.
Meine Eltern stritten viel, auch vor meinen Augen. Einmal warf mein Vater eine Bierflasche nach meiner Mutter, die gerade hinter mir saß, verfehlte uns aber. 1979 ließen sich meine Eltern scheiden. Einige Zeit später war Michael da. Michael war Chortenor am Theater Greifswald. Und er war, laut den Erzählungen meiner Mutter, schon damals Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Für die Stasi begann er angeblich zu arbeiten, nachdem eines Tages im Theater Nazischmierereien entdeckt worden waren. In der Version, die er erzählte, hatte ihn der Vorfall so sehr erschüttert, dass er die Staatssicherheit bei ihrer Arbeit unterstützen wollte. Meine Mutter wiederum erzählte, sie habe die Stasi kennengelernt, weil Michael unsere Wohnung als konspirativen Treff mit Mitarbeitern des MfS nutzte. Dadurch sei auch sie in die Mitarbeit »hineingerutscht«. Aber all diese Geschichten erfuhr ich erst später, teilweise viel später.
Während meine Mutter als Lehrerin einem »normalen« Beruf nachging, brachte Michael einen eher unkonventionellen Lebensstil in die Familie. Er umgab sich gern mit Künstlern. Das gefiel meiner Mutter. Sie wurde in ihrer Freizeit ehrenamtliche Pressedramaturgin am Theater Greifswald. Auch zu Hause hatten wir oft Besuch von Freunden aus dem Theater. Es wurde viel gefeiert.
Mich faszinierte dieses neue Leben. Dank der Vermittlung meines Stiefvaters durfte ich im Theater auftreten. In »Hänsel und Gretel« war ich der erste Pfefferkuchen von links, der half, die Hexe in den Ofen zu schieben. Im »Kirschgarten« von Tschechow durfte ich in meiner Rolle sogar singen. Ich trug auf der Bühne ein T-Shirt mit Amerikaflagge und schob einen Puppenwagen. Auch sonst war ich öfters im Theater mit dabei. Das war schon etwas Besonders im sonst eher stark reglementierten DDR-Alltag, und ich war sehr stolz darauf.
Anfangs blühte meine Mutter mit Michael regelrecht auf. Aber allmählich kippte das Familienleben. Es fing damit an, dass ich mich nicht nur oft allein für die Schule fertig machen, sondern auch um meinen jüngeren Bruder (der ebenfalls aus der Ehe meiner Mutter mit meinem leiblichen Vater stammte) kümmern musste. Meine Verantwortung wuchs, nachdem meine Schwester auf die Welt gekommen war. Ich war damals zehn und wurde in meinem Empfinden schon bald zu einer Art Mutterersatz für sie. Als meine Schwester in den Kindergarten kam, war ich meist diejenige, die sie hinbrachte. Auch das Abholen war in der Regel meine Aufgabe. Ich bekam mit, dass die Erzieherinnen über diese Situation tuschelten. Laut gesagt hat aber keine von ihnen etwas. Mir war das sehr unangenehm.
Einmal, als ich meine Schwester aus dem Kindergarten abholte, schimpfte eine der Erzieherinnen mit mir, weil sie erneut kein Essensgeld mitgebracht hatte. Ich war oft genervt, wenn ich mir diese Vorwürfe anhören musste – ich konnte ja nichts dafür. Dass es in anderen Familien anders zuging, wurde mir schlagartig auf einer Klassenfahrt bewusst. Mit meinen Mitschülern saß ich im Zug, und wir sprachen darüber, wie denn so unser Tag begann. Die anderen erzählten davon, wie sie mit ihren Eltern beim Frühstück zusammensaßen und hinterher noch die Stullen gestrichen bekamen. »Und du, Angela?«, fragten sie. Da erzählte ich, dass ich bei uns diejenige war, die die Brote für die Geschwister schmierte.
Meine Flucht war der Sport. Mit sieben Jahren hatte ich mit dem Judo begonnen. Schon früh waren Sportfunktionäre beim Kindersport auf mich aufmerksam geworden. Meine Körpermaße und meine Leistungen schienen sich gut für eine potenzielle Karriere als Leistungssportlerin im Bodenturnen zu eignen. Ich hatte aber keine Lust auf Bodenturnen. Dankbar nahm ich daher das Angebot einer Freundin an, sie zum Judo zu begleiten. Und dabei blieb es.
Judo hat viele Vorteile. Meine schmächtige Körpergröße, sonst oft von Nachteil, war bei dieser Sportart ideal. Die Grundlage ist wie bei allen asiatischen Kampfsportarten der Respekt für den Gegner. Vor allem hatte ich beim Judo Zeit für mich. Zeit, die mir niemand nehmen konnte.
Irgendwann lernte ich einen neuen »Freund« meiner Eltern kennen. Er hieß Thomas M., war sehr jung, vielleicht Anfang zwanzig, und wirkte sehr modern. Was ich nicht wusste: Er war der Führungsoffizier meiner Eltern.
Ich bin bei der Vorbereitung des Buches gefragt worden, warum ich seinen und die Namen der anderen Stasi-Mitarbeiter nicht ausschreibe. Einige kann man auch in den öffentlichen Listen der Stasi-Opferverbände nachlesen. Die Antwort ist: Weil ich nicht möchte, dass die Kinder dieser Menschen, die nichts für ihre Eltern können, das durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe.
Oft musste ich die Wohnung...