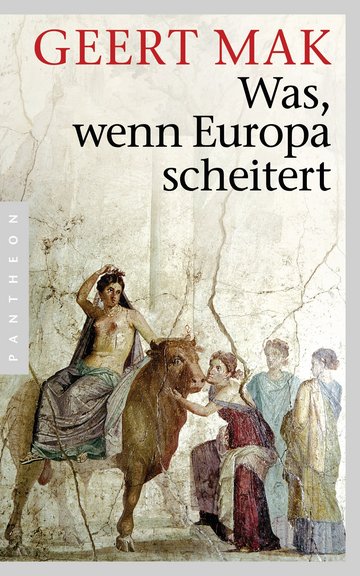1
Es war im Winter 1999. Das ehemalige Jugoslawien lag hoffnungslos in Trümmern. Die freundliche Donaustadt Novi Sad war immer wieder von den Alliierten bombardiert worden, die Brücken hingen zerstört im Fluss. Die Bewohner der Stadt standen an den schneebedeckten Ufern, voller Bestürzung. Über den Krieg, über ihre verwüstete Welt, über das Unvorstellbare, das sie sich selbst angetan hatten. Ich besuchte den alten Aleksandar Tišma, einen der bedeutendsten jugoslawischen Autoren. Er wohnte gleich um die Ecke, er ist 2003 gestorben.
Als ich ihn fragte, wie er sich fühle in diesem verlorenen Land, da erzählte er mir eine Geschichte über seinen Hund Jackie. Eines Tages im Winter war das Tier weggelaufen, die Donau entlang, und irgendwie war es auf eine Eisscholle geraten. Kinder aus der Nachbarschaft waren gekommen, um ihn zu holen. »Herr Tišma, Ihr Hund ertrinkt!« Er rannte hin, rief den Hund immer wieder bei seinem Namen, aber das Tier blieb auf der Scholle hocken, wie erstarrt. Jackie befand sich in einem Schockzustand. Schließlich gelang es einem der Kinder, ihn beim Nackenfell zu packen, und die Geschichte nahm ein glückliches Ende.
»So ergeht es zur Zeit auch uns«, sagte Tišma. »Wir hocken wie erstarrt auf einer Eisscholle, wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen, und gleichzeitig treiben wir den Strom hinab.«
In diesen Monaten muss ich oft an Tišmas Hund auf seiner Eisscholle denken. Historische Ereignisse werden von denen, die dabei sind, selten als historisch erlebt. Und das ist auch gut so, denn ohne die Ruhe unserer alltäglichen Beschäftigungen würden wir vor lauter Sorgen und Nervosität wahnsinnig werden. Unser ganz normales Leben ist von einer gewaltigen Kraft; es lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen, auch nicht wider besseres Wissen. Doch dieser Hang zur Beständigkeit in turbulenten Zeiten hat auch eine Kehrseite: Je tiefgreifender die Konsequenzen neuer Entwicklungen für unser alltägliches Leben sind, umso stärker neigen wir dazu, den Blick abzuwenden. Wir ziehen es vor, einfach immer weiterzugehen, wie ein kopfloses Huhn, auf unseren ausgetretenen Pfaden.
Vor Jahren verbrachte ich einmal anderthalb Tage in den Kellern der Wiener Hofburg, in der warmen Geschlossenheit der Nationalbibliothek, um nachzuvollziehen, wie der durchschnittliche Wiener im Sommer des Jahres 1914 hinter seiner Zeitung oder beim Kaffee die heraufziehende Katastrophe des Ersten Weltkriegs erlebte. Ich tat dies mithilfe des gebundenen Jahrgangs der Stadtausgabe der Neuen Freien Presse und machte eine verblüffende Entdeckung: Auch damals ging alles noch wochenlang seinen üblichen Gang. Die Titelseiten waren beherrscht von der Frage, wer zur Beerdigung des ermordeten Thronfolgers und seiner Frau eingeladen war und wer nicht, an der Börse machte sich eine schläfrige Sommerstimmung breit, Fürsten und wichtige Staatsleute fuhren in die Sommerfrische.
Erst einen Monat später erreichte die Unruhe die Zeitungsseiten mit aller Macht. Aber durch die Katastrophenmeldungen hindurch war immer noch der eiserne Rhythmus der alltäglichen Anzeigen zu vernehmen, in denen zum Beispiel die figurverschönernde Wirkung von Feschoform Büstenbalsam angepriesen wurde. Es bleibt mir unvergesslich: die Zeitung vom Montag, dem 3. August 1914, Deutschland erklärt Russland den Krieg, aber die Feschoform-Werbung geht einfach weiter.
Das damalige Wien war eine Welt voller Sicherheiten, schrieb Stefan Zweig in seinen Erinnerungen, eine Welt, die immer so weiterzugehen schien, und dennoch war plötzlich alles vorbei, endgültig, »eine tragische Folge jenes inneren Dynamismus, der sich in diesen vierzig Jahren Frieden aufgehäuft hatte«.
Die Gefahr ist groß, dass uns dasselbe widerfährt. Dass uns das gesamte europäische Projekt, dieses kostbare Erbe früherer Generationen von Europäern, unbemerkt aus den Händen gleitet. Und dass dadurch, so wie Zweig es beschreibt, auch unsere Welt aus selbstverständlichen Sicherheiten in Scherben zerbricht.
Ich beginne mit diesen Notizen in Berlin. Es ist Ende November 2011. Ich sitze an einem Fenstertisch im alten Hotel Savoy in der Fasanenstraße, hypermodern im Jahr 1930 und sich seitdem immer treu geblieben, als sei in den Jahren danach nichts passiert. Henry Miller und Thomas Mann haben hier gewohnt, die Russen kämpften in den Straßen, die Briten hatten hier ihr Hauptquartier, und immer waren die Tische blütenweiß, die Servietten spitz gefaltet und die Schürzen der Zimmermädchen steif vor Stärke. So auch heute. Im Foyer sitzt Herr Wulfert wie ein Felsen hinter seinem Tresen, und er wird auch weiterhin all seine Gäste erkennen und begrüßen, bis in alle Ewigkeit.
Das ist die sichere Welt, in der ich schreibe, die Welt des Savoy im Jahr 2011. Lange lebten wir in dem Glauben, dies sei unsere wirkliche Welt. Doch aus diesem Traum wurden wir gewaltsam geweckt – die Schlagzeilen der Berliner Zeitung und des Tagesspiegel machen keinen Hehl daraus, Tag für Tag. In Europa war es Dutzende von Jahren ziemlich ruhig, und so entstand die Vorstellung, dass unser europäisches Gesellschaftssystem und unsere westliche Weltordnung in höchstem Maße stabil sind. Das ist ein großer Irrtum. Denn schließlich hat die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts wiederholt gezeigt, dass das Unvorstellbare von einem Moment auf den anderen unausweichlich werden kann. Und dass die Umwälzungen dann in erstaunlich großer Geschwindigkeit einsetzen. Das gilt auch für die Gegenwart.
Was wir gerade erleben, ist keine gewöhnliche Krise. Es ist ein Übergang, ein Übergang in eine andere historische Phase, eine Krise, die die Grundlagen unserer westlichen Gesellschaften berührt. Die amerikanische Hegemonie zerbröckelt, und vermutlich wird China in zehn, zwölf Jahren die Rolle der größten Wirtschaftsmacht übernommen haben. In der arabischen Welt sind Volksbewegungen entstanden, die – bei allem Unterschied – an die europäischen Revolutionen der Jahre 1848, 1918 und 1989 erinnerten, und haben einen politischen Wandel erzwungen, von dem wir noch nicht wissen, wohin er führen wird. Was immer aus diesen demokratischen Umwälzungen hervorgehen wird, sie stellen die größte Herausforderung für die europäische Außenpolitik seit dem Fall des Eisernen Vorhangs dar.
Gleichzeitig sieht Europa sich mit einem zutiefst maroden Bankensektor, mit sich rasch verschlechternden Wirtschaftsprognosen, zunehmenden Spannungen zwischen Nord und Süd, skeptischen Bürgern und einem Mangel an Führungswillen konfrontiert. Diese Mischung explodiert nun im Euroraum, dessen Einheitswährung ohne die notwendige Spannkraft geschaffen wurde, welche es ihr ermöglichen würde, schwere Zeiten zu überstehen, und der nicht über die Strukturen für eine schnelle Entscheidungsfindung verfügt. Ulrike Guérot, die Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations vergleicht die Europäische Union mit der ehemaligen Sowjetunion: Auch das europäische Projekt als Ganzes kann schnell untergehen, wenn der Euro scheitert. Währenddessen spielt auf dem Promenadendeck das europäische Schiffsorchester weiter, als sei alles in bester Ordnung. In diesem Moment steht Griechenland von den 126 Staaten, die von den Ratingagenturen bewertet werden, auf Platz 126 und ist damit das am wenigsten kreditwürdige Land der Welt. Dennoch weigern sich die Wortführer und Politiker in Brüssel noch immer, öffentlich über einen Bankrott Griechenlands zu sprechen, und nur wenige wagen es, über einen Austritt des Landes aus der Eurozone zu spekulieren. Auch in Spanien wackeln die Banken. Alles unter Kontrolle, ruft die Regierung, doch niemand fügt hinzu, dass man nichts oder nur wenig über das Tun und Lassen der regionalen Verwaltungen und die unsicheren Kredite der zahllosen lokalen Banken weiß. Das Vertrauen in Italien ist ebenfalls stark geschrumpft; die Zinsen für Staatsobligationen steigen rasant in unbezahlbare Höhe. Portugal und Irland stehen bereits unter strenger Aufsicht. Und auch was Frankreich angeht, kommen allmählich Zweifel auf.
Hinter verschlossenen Türen wird die Stimmung von Tag zu Tag erbitterter. Banken und große Konzerne arbeiten heimlich an Szenarien für einen möglichen Zerfall der Eurozone. Doch nach außen wird jeder Strohhalm als Durchbruch präsentiert. Panik muss um jeden Preis verhindert werden.
Aus den Kabinen unter Deck, aus dem Europa der ganz normalen Leute, ertönen inzwischen immer lautere Alarmsignale. Ein Freund schreibt mir aus Südspanien, er könne die Bibliothek kaum noch nutzen, weil der Strom abgeschaltet worden sei. Die Gemeinde sei pleite. Die Beamten hätten seit Juli kein Geld mehr bekommen. Bekannte aus Griechenland berichten von alten Menschen, die nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen. Um von den alltäglichen Problemen infolge von Stromsperren – auch dort –, Treibstoffmangel und rasch wachsender Armut gar nicht erst zu reden. Überall werden Leute entlassen, Menschen werden aus ihren Wohnungen geworfen, neue Arbeit ist nirgendwo zu finden.
In Irland erhalten Krankenschwestern, Lehrer, Müllmänner und andere Angestellte des öffentlichen Dienstes ein Fünftel weniger Gehalt. Das wirtschaftliche Wachstum hat sich erneut halbiert. Die strengen Maßnahmen, die Deutschland, die Niederlande und die Europäische Zentralbank (EZB) dem Land auferlegt haben, nahmen allen Verbesserungsmöglichkeiten die Luft, meldet das Economic and Social Research Institute aus Dublin: »Die aktuelle Situation enthält Elemente, die an die Politik...