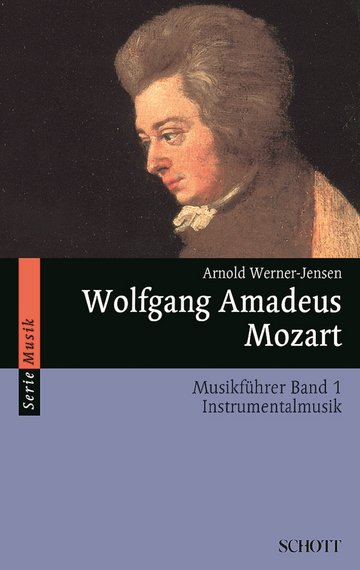Mozarts Leben
Eine Einführung
Wolfgang Amadeus Mozart (geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg, gestorben am 5. Dezember 1791 in Wien) ist unter allen klassischen Komponisten sicher eine der faszinierendsten und geheimnisvollsten Persönlichkeiten – geheimnisvoll, obwohl er zugleich einer der am besten dokumentierten Künstler ist. Seine Briefe und die seiner Familie füllen in der Neuen Mozart-Gesamtausgabe samt Kommentaren sieben dickleibige Bücher, die durch zwei weitere Bände mit zeitgenössischen Bild- und Textdokumenten ergänzt werden. Und seit seinem frühen Tod ist die Folge von Lebensdarstellungen und -deutungen bis heute nicht abgerissen, schwankend zwischen romantischer Verklärung und wissenschaftlicher Nüchternheit.
Dennoch blieb bis in unsere Tage ein genügend großer Spielraum zum Spekulieren und Phantasieren, sei es nun über die mehr oder weniger große Leichtigkeit oder auch Mühe des Kompositionsvorganges, über die (vermuteten) Licht- und Schattenseiten seines Charakters oder über die Umstände seines Todes, den mancher Deuter seiner Vita allzu gern Mord nennen würde, gäbe es denn Beweise dafür.
Wunderkinder gleichen in der Regel Meteoren, die für kurze Zeit hell aufleuchten und dann still und endgültig verlöschen. Vielleicht ist es das größte Wunder in Mozarts Leben, daß er – als Ausnahme und ohne erkennbare Gefährdung und größere Krisen – vom Wunderkind zum Meister heranreifen konnte. Ein nicht unwesentlicher Teil dieses Wunders hat allerdings eine ganz greifbare Erklärung: Es ist, trotz aller möglichen Einwände, das unbestreitbare und bleibende Verdienst Leopold Mozarts, des Vaters, den Keim des Genies so früh wie nur möglich erkannt und mit liebevoller Geduld gepflegt zu haben. Man kann den Anteil des Vaters am Werden und Wirken des Sohnes gar nicht hoch genug einschätzen, und es ist deshalb notwendig, sich bei allen seinen im einzelnen manchmal anfechtbaren erzieherischen Maßnahmen die Zeitumstände bewußt zu machen, die allesamt den Mozarts eher Widerstände entgegensetzten als Nutzen brachten.
Leopold Mozart (geboren am 14. November 1719 in Augsburg, gestorben am 28. Mai 1787 in Salzburg) stammte aus einer Familie von Handwerkern und Künstlern und erhielt eine gründliche humanistische Bildung. Nach Universitätsstudien in Salzburg wandte er sich ganz der Musik zu und erwarb sich einen respektablen Ruf als Geiger und Komponist, mit Anstellung als »Hof- und Kammer-Komponist« (1757) und als Vizekapellmeister der Salzburger Hofkapelle. Sein Hauptwerk aber wurde seine Violinschule, die er im Geburtsjahr seines Sohnes veröffentlichte und die – als erstes grundlegendes Werk seiner Art – in mehreren Sprachen über ganz Europa verbreitet wurde. Danach füllte ihn die Betreuung und Erziehung seiner beiden Kinder Maria Anna (»Nannerl«) und Wolfgang weitgehend aus, obwohl er weiterhin in Salzburger Diensten stand.
Leopold Mozart. Stich von Jakob Andreas Fridrich, Frontispiz der 1756 in Augsburg erschienenen Violinschule von Leopold Mozart
Immer wieder ist Leopold postum der Vorwurf gemacht worden, er habe die Begabung des Sohnes in dessen frühester Jugend rücksichtslos ausgebeutet und ihm bei den vielen Reisen unzumutbare Strapazen auferlegt. Sie hätten schon damals die Gesundheit des Knaben so angegriffen, daß man in ihnen die Wurzeln für spätere Krankheit und frühen Tod sehen müsse, und der Vater trage die Schuld daran. Wahr mag sein, daß Leopold Mozart, der sich selber nicht zu schonen gewohnt war, seinen Sohn immer wieder bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit belastet hat. Bewunderungswürdig sind aber zugleich Umsicht und Weitblick, mit denen er die künstlerische Bildung des Wunderkindes lenkte, sorgsam Stein um Stein zum Mosaik einer wahrhaft universellen Ausbildung fügte und hierfür weder Zeit noch Kosten oder Widrigkeiten beruflicher Art scheute. Kaum ein anderer Musiker der Zeit dürfte so umfassend und sorgfältig ausgebildet worden sein wie Wolfgang Amadeus Mozart; seine nahezu lückenlose Kenntnis aller aktuellen europäischen Stilrichtungen und bedeutenden Musikerpersönlichkeiten bildeten die tragfähige Brücke vom glanzvollen Auftreten des umjubelten Wunderkindes zum staunenswerten Können des jungen Meisters.
Die ersten Spuren des Musikunterrichts durch den Vater haben sich in einigen Notenheften erhalten, die Leopold Mozart für seine Kinder anlegte. Die frühesten überlieferten Klavierstückchen des Knaben bedurften mit Sicherheit noch der lenkenden und glättenden Feder des Vaters (KV 1–5, 1761/62). Neben der Musik erlernte Wolfgang ebenfalls früh mehrere Sprachen, unerläßlich für die Reisen durch Europa. Außer lateinischen, englischen und französischen Grundkenntnissen wurde vor allem das Italienische gepflegt, das als musikalische Modesprache zum unentbehrlichen Rüstzeug des kommenden Opernkomponisten werden sollte. Eine erste dreiwöchige Reise, gleichsam als Generalprobe, unternahm der Vater mit seinen beiden Wunderkindern bereits im Januar 1762 nach München. Ihr folgte im Spätsommer des gleichen Jahres die zweite mit dem Hauptziel Wien und seiner kaiserlichen Residenz; die Auftritte vor der Kaiserin Maria Theresia haben manche ausschmückende Anekdote ausgelöst. Die Erfolge dieser beiden Unternehmungen, vor allem beim Adel, ermunterten die Mozarts, am 9. Juni 1763 zu einer ausgedehnten Reise aufzubrechen, die den Vater mit seinen beiden Kindern in mehr als drei Jahren kreuz und quer durch Europa führte. Die Reiseumstände dürften mehr als abenteuerlich gewesen sein: per Postkutsche über holprige und schlammige Wege, gehemmt durch zahllose Grenzen und Zollformalitäten, Wind und Wetter trotzend.
Wichtige Stationen waren zunächst im deutschsprachigen Raum München, Augsburg, Ludwigsburg und Schwetzingen. Von dort aus führten Abstecher nach Mainz, Heidelberg und Frankfurt, wo es zu jener denkwürdigen Begegnung zweier Knaben kam, die als Erwachsene ihr Jahrhundert prägen sollten: der 14jährige Goethe traf den 7jährigen Mozart. Weiter ging es über Köln und Brüssel nach Paris – neben London und den großen italienischen Städten eine der musikalischen Metropolen des damaligen Europa. Ein mehrwöchiger Aufenthalt am Hof von Versailles um die Jahreswende 1763/64 wurde zum prächtigen Höhepunkt.
Via Calais erreichte man im April 1764 dann London, und hier traf Wolfgang jenen Mann, der sicher neben Haydn den nachhaltigsten künstlerischen Einfluß auf seine Musik gewinnen sollte, auf Johann Christian Bach, den jüngsten der Bach-Söhne. Noch in England komponierte Mozart daraufhin seine ersten beiden kleinen Sinfonien (KV 16 und 19).
Am 24. Juli 1765 traten die Mozarts ohne Hast die Rückreise an. Über Den Haag, wo die Kinder ernsthaft erkrankten, Antwerpen und Amsterdam erreichten sie am 10. Mai 1766 zunächst wieder Paris und wandten sich dann am 9. Juli endgültig in Richtung Heimat, wo sie erst Ende November 1766 – über eine Reihe schweizerischer und deutscher Städte – eintrafen. Man darf annehmen, daß die Kinder das folgende dreiviertel Jahr in Salzburg mehr als nötig hatten, um die überquellende Fülle der Eindrücke, die im Laufe der drei Jahre auf sie eingestürmt waren, besonders der künstlerischen, zu bewältigen. Und es blieb nun Muße zum Studieren, Komponieren und Üben, sorgfältig organisiert und überwacht durch Vater Leopold.
Die nächste Reise, nach Wien (11. September 1767 bis 5. Januar 1769), stand zunächst programmwidrig unter dem Unstern einer großen Blatternepidemie, der die Kinder trotz der Flucht bis Olmütz nicht entgingen. Wieder genesen, traten sie erfolgreich vor dem Kaiserpaar in Wien auf, und Wolfgang komponierte seine beiden ersten Opern: »La finta semplice«, deren Uraufführung durch Intrigen jedoch nicht hier zustande kam, sondern erst 1769 in Salzburg, und außerdem »Bastien und Bastienne« für den Arzt Franz Anton Mesmer, der mit seinen Magnetismus-Behandlungen (»Mesmerismus«) zweifelhafte Berühmtheit erlangte. (Einige Jahre später, 1790, parodierten Mozart und sein Textdichter da Ponte in einer Szene von »Cosi fan tutte« diese Modeerscheinung.)
Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von sieben Jahren. Pietro Antonio Lorenzoni zugeschriebenes Gemälde. 1763. Salzburg, Mozart-Museum in der Getreidegasse
Sigismund Graf Sehrattenbach, 1753–1771 Fürsterzbischof von Salzburg. Stich von Joseph und Johann Klauber
Wieder bildete ein knappes Studienjahr in Salzburg die nötige Zäsur. Eine Vielzahl unterschiedlichster Kompositionen, vor allem auch erste Cassationen und Divertimenti, legen Zeugnis davon ab, daß das Wunderkind auf dem Weg zur eigenständigen schöpferischen Persönlichkeit war, im Laufe seiner Lehr- und Wanderjahre unbeirrt und wie ein Schwamm...