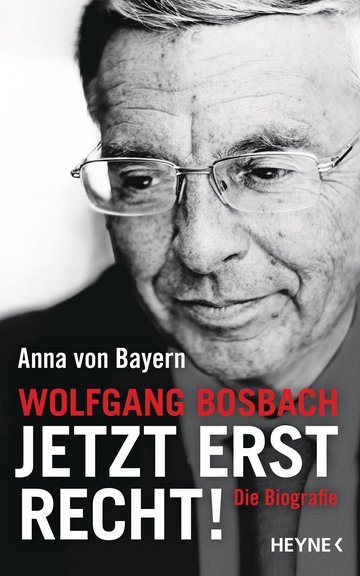AUFSTAND MIT ANSAGE
Weil er mit Hiobsbotschaften keine Zeit verschwendet, fasst Wolfgang Bosbach sich kurz. In einem Satz sagt er seinen drei Töchtern Caroline, Natalie und Viktoria, dass er todkrank ist. So sei es, so gehe es jetzt weiter, und mehr gebe es dazu bis zu einem neuen Befund nicht zu sagen. »Und jetzt nicht den Papa mit traurigen Augen anschauen, armer Papa, das will ich nicht, da kriege ich die Krise.« Danach möchte er zu Hause nicht mehr über den Krebs sprechen. Auch wenn man sich auf eine solch niederschmetternde Diagnose nicht vorbereiten kann, hat Wolfgang Bosbach sie doch in den vergangenen Monaten angesichts des steigenden PSA-Wertes zumindest in Betracht ziehen können. Für seine Töchter hingegen sitzt der Schock tief. Dennoch akzeptieren sie, dass ihr Vater mit ihnen darüber nicht mehr reden will. Nur dass er es andererseits so bereitwillig in der Öffentlichkeit tut, das ist schwierig für die Familie. Mit dem Stern spricht er wenig später über die Angst vor dem Tod (»Keine, wenn der kommt, bin ich ja weg«), über Inkontinenz und Erektionsstörungen (»Damit hatte ich nur ein paar Tage zu tun, dann war das Thema durch«). Dem Spiegel erzählt er, dass er gerne zu Hause sterben würde (»Ich möchte meinen Lieben dann alles sagen können, was für mich noch wichtig ist und was ich ihnen schon immer sagen wollte«) und wie er sich sein Begräbnis vorstellt (»Nicht nur Kirchenlieder und keine langen Reden, die Leute wollen was zu essen haben«). In Bild lässt er sich lachend mit seinem ebenfalls krebskranken Freund, dem Bestatter Fritz Roth, ablichten (»Wir haben beide Krebs! Wir lachen trotzdem!«), und Bunte erzählt er, dass er mit Gott gehadert habe (»mit dem Krebs nicht«). Er spricht in Talkshows über Krebs, über Vorsorge, über den Tod und über seinen christlichen Glauben an ein Leben danach.
Als seine Frau Sabine eines Morgens in der Zeitung lesen muss, dass ihr Mann »dem Tod ins Auge sieht«, platzt ihr der Kragen. Ob denn das alles sein müsse? Irgendwann würden die Leute sagen: Der Bosbach, ist der immer noch nicht tot? Von Freunden und Bekannten genauso wie von Wildfremden werden sie und die Töchter unentwegt auf die Krankheit ihres Mannes angesprochen. Ständig ruft jemand an, der eine Therapieempfehlung aussprechen möchte. Weil Sabine Bosbach weiß, dass die Anrufer es nur gut meinen, möchte sie sie nicht einfach abwürgen. Manchmal klingelt sie dann mit dem Hörer in der Hand an ihrer eigenen Haustür, Besuch sei da, sie müsse leider auflegen. Einmal steht ein fremdes älteres Ehepaar vor der Tür. Die Frau packt ihren Mann am Schlafittchen und hält ihn der erstaunten Frau Bosbach entgegen. »Das ist mein Mann! Sehen sie den? Der müsste schon zwei Jahre tot sein!«, ruft sie. Die Dame möchte Herrn Bosbach ein Vitaminpräparat empfehlen, von dem sie überzeugt ist, dass es ihren Mann geheilt hat. Frau Bosbach bedankt sich für die Mühe, das Präparat hat sie bereits. So wohlmeinend die Menschen auch sind, so sehr belastet es sie, permanent mit der Krankheit ihres Mannes konfrontiert zu werden. Sie merkt, dass die Kinder darunter leiden. Sie will den Fernseher schon nicht mehr anmachen und die Zeitung morgens nicht aufschlagen. Sie will das alles nicht mehr, sagt sie ihrem Mann und bittet ihn um Verständnis.
Doch für Wolfgang Bosbach ist der Gang in die Öffentlichkeit so etwas wie die Flucht nach vorn. So lange er konnte, hat er seine Krankheiten geheim gehalten. Die Herzmuskelerkrankung in seinem ersten Wahlkampf durfte auf keinen Fall herauskommen, deshalb nahm er sich nicht die Zeit, sie auszukurieren. Er fürchtete, die Leute würden sich fragen, ob er im Vollbesitz seiner Kräfte sei, ob er das Pensum wirklich bewältigen könne, ob er sich auch nicht übernehme.3 Auch über die erste Krebsdiagnose spricht er nicht. Er lässt sich in Hamburg operieren, wo er nicht befürchten muss, Menschen zu begegnen, die er kennt. Doch als die Strahlentherapie beginnt, weiß er, dass er in die Offensive gehen muss. Im Wartezimmer in seiner Heimat kennen ihn zwei Drittel der Leute. Dann wird sich schnell herumsprechen, dass Bosbach zum Onkologen muss. Und bevor er für halb tot erklärt wird, sagt er lieber selber, wie es um ihn steht. Allerdings sagt er es eben nicht nur einmal, sondern wiederholt es jedem, der es hören will. Vielleicht ist die öffentliche Beschäftigung mit dem Thema für ihn auch therapeutisch. Die Reaktionen auf seine Verletzlichkeit, das Mitgefühl und der Zuspruch, rühren ihn. Vielleicht tut es gut, über so schwere Dinge wie den eigenen Tod mit Menschen zu reden, die davon emotional nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit Journalisten kann Bosbach ganz sachlich über seine Unheilbarkeit sprechen und dabei immer wieder sagen, dass er nicht mit Dingen hadert, die er nicht ändern kann. Vielleicht muss er es so oft sagen, weil er hofft, es irgendwann selbst zu glauben.
Ich bin mit Wolfgang Bosbach auf der Lieblingsinsel der Deutschen verabredet, um über das zu sprechen, was ihm wichtig ist. Eigene Memoiren hat er nie schreiben wollen, weil er sich nicht wichtiger nehme, als er ist, sagt er. Das spare der Partei außerdem viel Geld, denn dann müsste sie seine Bücher nicht kaufen, um sie bei Jubilarenehrungen zu verschenken.4 Doch meinen Vorschlag, über ihn zu schreiben, nimmt er an. Wolfgang Bosbach, muss man wissen, kann nicht Nein sagen. Wir kennen einander, weil ich mich als Redakteurin der Bild am Sonntag immer mal wieder an ihn wandte. Brauchte man am Samstagabend noch eine Einschätzung oder ein Zitat zu einem innenpolitischen Thema, war Bosbach stets eine sichere Bank: immer zu erreichen, unkompliziert, seine Worte präzise, sachdienlich und wenn nötig zugespitzt. Mit dieser extrem seltenen Kombination ist Bosbach für jeden politischen Journalisten sein Gewicht in Gold wert. Auf Mallorca macht er mit seiner 21-jährigen Tochter Natalie vier Tage Urlaub. Anlass ist die jährliche Reise seiner Fußballfreunde, der Sponsoren des SV Bergisch Gladbach, dessen Präsident Bosbach lange war. Die alljährliche Zusammenkunft möchte er nicht verpassen, allerdings wohnen die beiden nicht bei der Reisegruppe, sondern in einem Hotel in Sa Coma, etwa hundert Meter vom Strand entfernt. Im Pool inmitten des parkähnlichen Gartens tummeln sich vorwiegend deutsche Rentner. Bosbach hat Halbpension gebucht: Das Buffet sei gut. Er hat dieses Hotel gewählt, weil gleich gegenüber eine Tennisakademie liegt, in der er täglich trainiert. Die Tochter des Besitzers war mal auf der Weltrangliste platziert. Bosbach spielt mit ihrem Bruder, der sei auch nicht schlecht. »Tagsüber schnarch und Sport, abends können wir reden«, hatte Bosbach mir geschrieben, aber weil es ein kühler Tag ist, hat er nun doch schon am Vormittag Zeit. »In fünf Minuten?«, frage ich per SMS. »Sitze schon und warte. Kenne ich vom Schuhkauf mit meinen Damen«, antwortet Bosbach.
Die Hotellobby ist leer, eine Traumschiffversion von Moonlight Shadow läuft nicht leise genug. Bosbach sitzt hinten am Fenster zum Garten auf einem rosa Sofa. Er trägt ein modisch gebleichtes, gestreiftes Jeanshemd, eine helle Hose, weiße Turnschuhe und ist braun gebrannt wie immer. Er sieht fit aus. Einen Kaffee möchte er nicht. »Ich muss morgens immer so viel laufen«, sagt er und meint: auf das Klo, deshalb versuche er, möglichst wenig zu trinken. Jeden Morgen muss er Entwässerungstabletten nehmen. »Dann laufe ich eigentlich alle zwanzig Minuten.« Mühsam sei das bei morgendlichen Sitzungen. Da habe er schon mal versucht, die Tabletten erst später zu nehmen, aber das wurde irgendwann zu verlockend, er verlor den Überblick, ob er sie an diesem Tag bereits eingenommen hatte oder nicht. »Also zwinge ich mich jetzt dazu, sie immer gleich morgens zu nehmen.« Wirklich störend sei das im Flieger, wenn er zum dritten Mal in einer Stunde über den Nachbarn hinweg zum Gang klettern müsse. »Aber am Kölner Flughafen wissen die schon, wenn ich morgens komme, dass ich einen Gangplatz brauche.« Bosbach lacht: Sonst könne er mit den Nebenwirkungen seiner Medikamente ganz gut leben. Nur furchtbar müde mache ihn die Hormonentzugstherapie, sagt er. Seine langen Tage wirken auf mich nicht wie die eines müden Mannes. »Gegen die Müdigkeit muss ich immer auf den Beinen bleiben«, sagt er. »Es darf keinen Stillstand geben, sonst schlafe ich sofort ein.« Eines müsse er aber sagen, wechselt er plötzlich das Thema und zeigt auf meine rosa Strickjacke: »Ihr Pullover passt prima zum Sofa.«
Bosbach spricht das Rheinisch seiner Heimat Bergisch Gladbach, verschluckt keine Silbe; er spricht es strukturiert und druckreif. Keine Füllwörter, kein Ähs und Öhs. Er betont oft den zweiten Vokal und spricht die Konsonanten scharf aus, deutliches R, sodass seine Sprache einen Rhythmus hat, dem man gerne zuhört. Jedenfalls scheint das eine ältere Dame im bunten Sommerkleid so zu empfinden, die sich vor Bosbach aufgebaut hat.
»Jetzt ist mir alles klar. Ich kenne Ihre...