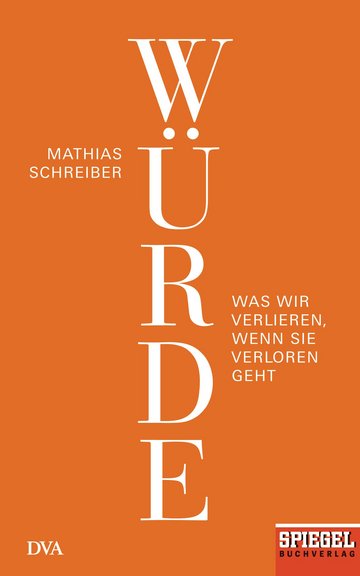Der Begriff der Würde
Definitorisches
Wenn wir einem Menschen, einer Aktion, einer Haltung oder einer Sache das Prädikat »würdig« (oder »unwürdig«) zusprechen, dann handelt es sich um ein Werturteil. Dieses Urteil schwebt eigentümlich zwischen Subjektivität und Objektivität, Ästhetik und Moral. Der Wert, den es zuteilt, lässt sich nicht so eindeutig umreißen wie der Wert des Guten, der im moralischen Urteil einem Menschen oder einer Handlung eingeräumt oder genommen wird. Für das Gute gibt es deutliche Kriterien wie die Zehn Gebote, den moderneren Sündenkatalog des Vatikans, an dem sich der katholische Beichtvater orientiert, allgemein anerkannte Fairness-Regeln, Kants Kategorischen Imperativ oder das Strafrecht. Für das Schöne sind bestimmte Ideale und beispielhafte Werke maßgebend, die in bestimmten Epochen hochgehalten, aber im Lauf der Zeit immer wieder in Frage gestellt werden. Das klassische Ideal des harmonischen Zusammenspiels einer Idee mit der sinnlichen Vielfalt ihrer Darstellung hat seit dem Ausgang des Mittelalters über Jahrhunderte Geltung, wird aber im späten 19. und erst recht im 20. Jahrhundert von einer zum Teil krassen Ausdrucks-Kunst überboten, die auch den Mut zur Hässlichkeit, zur aggressiven Disharmonie, ja zur sogenannten Anti-Kunst einschließt. Zwischen diesen beiden Urteilsformen steht das Urteil über Würde seltsam da: Der Wert, auf den es sich beruft, scheint verbindlicher und klarer zu sein als der Wert des Schönen oder Unschönen, erreicht jedoch nicht die begriffliche Eindeutigkeit des moralisch Guten. Derjenige, der über Würde urteilt, ist sozusagen ein Moral-Richter mit einem Ästhetik-Beisitzer. Nur ihr gemeinsames Urteil zählt.
Wahr ist zunächst einmal: Der Mensch hat eine angeborene Würde und eine Würde, die sich aus einer bestimmten Gestaltung seines Lebens ergibt – bedingt durch Zufall oder Tüchtigkeit. Beide Formen der Würde hängen zusammen, obwohl in der Moderne die Tendenz vorherrscht, sie voneinander zu trennen und lediglich die dynamische, notfalls auch zufällig begünstigte Gestaltungswürde anzuerkennen. Der Maßstab der Gestaltungswürde ist indes nicht zuletzt die natürlich vorgegebene Würde. Wie ich mein Leben einrichte, ist mehr oder weniger würdig – nach geltendem Würde-Kodex, aber auch je nachdem, in welchem Maß es meiner von Geburt aus möglichen Würde entspricht. Was die genetische Natur mir gestattet, ist zugleich Chance, Herausforderung und Grenze. Meine natürlichen Gaben (und Handicaps) liefern den ersten Maßstab für das Gelingen meiner Anstrengung, diesen Möglichkeiten gerecht zu werden, mich dieser Möglichkeiten als würdig zu erweisen.
Menschen von zwergenhafter Statur, Menschen mit geistigen Behinderungen, Menschen aus desaströsem Milieu haben es schwerer, gemäß einem gewissen Würde-Ideal zu leben und aufzutreten, und doch haben auch sie ihre eigene Würde, die mehr ist als ihr Stolz oder irgendeine unbestimmte Trotzhaltung. Die humane Würde einer Gesellschaft erweist sich gerade auch dadurch, wie sie benachteiligten Menschen begegnet. Die französische Filmkomödie »Ziemlich beste Freunde« (2011), die 2012 auch in deutschen Kinos Furore machte, zeigt anhand der ungewöhnlichen Verbindung zwischen einem reichen Querschnittsgelähmten im Rollstuhl und seinem mittellosen Pfleger, einem Ex-Häftling, dass der würdige Umgang mit Behinderten mehr braucht als die Perspektive des total fürsorglichen barmherzigen Samariters: Der Behinderte in diesem Film ist glücklich, dass sein Pfleger ihm schon bei der ersten Begegnung nicht mit von oben herab triefendem Mitleid den Rollstuhl schiebt, sondern etwas frech ist und auf gleicher Augenhöhe mit ihm kommuniziert, sogar Scherze über die grotesken Aspekte seiner Behinderung riskiert.
Aber was bedeutet eigentlich dieses Wort »Würde«, dieses Banner-Wort des deutschen Grundgesetzes, dieses uralte sprachliche Feldzeichen der Edelmenschen und aufrechten Kämpfer, dieses wortgewordene Brokat einer inneren Hoheit und Unnahbarkeit, das oft mit rein äußerlichem Oberschicht- Gebaren verwechselt wird?
Sprachgeschichtlich wurzelt das Wort »Würde« im althochdeutschen wirdi und dann im mittelhochdeutschen wirde (auch als wierde oder werde bekannt); und es bedeutet »Wert, wertvolle Beschaffenheit, Ansehen, Herrlichkeit, Ehre«. Der Sprach-Brockhaus von 1935 erläutert: Würde sei »die einem Menschen kraft seines inneren Wertes zukommende Bedeutung; Achtung fordernde Haltung: die Würde des Alters; etwas mit Würde tragen, ohne zu klagen oder sich etwas zu vergeben. Ansehen bei den Leuten. Rangstufe, Ehrenstelle, Amt: die Würde eines Geheimrats, die Doktorwürde; dazu Titel wie: Ehrwürden, Hochwürden; der Würdenträger. Ich würdere, schätze ab.«
Im großen Duden von 2011 folgt an zweiter Stelle, nach »die menschliche, persönliche Würde«, die Redewendung »die Würde einer Patientin, eines Sterbenden achten; jemandes Wert verletzen, antasten, angreifen; einen Menschen in seiner Würde verletzen«, sodann: »Bewusstsein des eigenen Wertes (und dadurch bestimmte Haltung); eine steife, eine natürliche Würde; Würde ausstrahlen; die Würde wahren …unter aller Würde: nicht zumutbar … hohe Achtung gebietende Erhabenheit einer Sache, besonders einer Institution: die nationale Würde eines Staates; die Würde des Alters, des Gerichts … mit bestimmten Ehren verbundenes Amt, verbundener Rang …«
Bezeichnend für den Wandel des Zeitgeistes: 1935 steht weit vorn das Sprachbeispiel »Würde eines Geheimrats«, 2011 aber die »Würde einer Patientin«. Wenn 1935 die »Würde des Alters« erwähnt wird, dann gilt ihr noch die Assoziation von Autorität, Respektsperson; 76 Jahre später rangiert vor ihr die »Würde eines Sterbenden«; immerhin wird die »Würde des Alters« direkt neben der des Gerichts aufgeführt.
Der innere Wert, der nach außen strahlt und ein gewisses Ansehen begründet, dem im Idealfall auch ein gehobenes Amt oder ein ehrenvoller Titel korrespondiert – so weit, so klar. Indes fragen wir uns, was denn dieser innere Wert genau sein kann und wie die Würde, die sich einer erarbeitet, daraus entsteht und, indem sie den inneren Wert bereichert, sich bewährt.
Aus alldem ergeben sich, auch im Blick auf die Historie, drei Grundformen der Würde: die Würde, die der Mensch von Geburt an hat, weil er beseelt oder vernunftbegabt ist; die Würde, die er erwirbt, weil er sich vorbildlich verhält und einem meist von Geburt an für ihn als »standesgemäß« geltenden Kanon gerecht wird; schließlich die Würde, die sich auf fast natürliche Weise als Gesamteindruck eines Individuums einstellt, das sich taktvoll benimmt.
Aristoteles, Cicero: würdevolle Gesten, Gewänder, Köpfe
Der würdige Bürger der Antike – vergessen wir einmal die Sklaven – benimmt sich weder herablassend noch anbiedernd, weder dummstolz noch unterwürfig, er zeigt sich gelassen angesichts von Ehrungen oder Kränkungen, diskret im Persönlichen, aufrichtig und weltoffen, maßvoll in seinen Bewegungen und Neigungen, kontrolliert und ausgeglichen in der Art zu reden sowie von angenehm mittlerer Statur: So charakterisiert der griechische Philosoph Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) in seiner Nikomachischen Ethik den »hochsinnigen« Menschen. Die skulpturalen Gottmenschen wie Apollo oder Aphrodite, in denen das klassische Griechenland Teile dieses Ideals verewigt hat, charakterisiert der deutsche Archäologe und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717 bis 1768) mit der wunderbar suggestiven Formel »Edle Einfalt und stille Größe« so bündig wie paradox. Für Winckelmann war die ästhetische Anmutung der Würde ohne den Bezug auf das Griechenland des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. unvorstellbar: »Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten.«
Allerdings hat die mitteleuropäische Bildhauerkunst, die diesem Ideal im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert mit schneeweißen Marmorfiguren nacheifert, mit den historischen griechischen Bildhauerwerken, die ja farbig waren, wenig gemeinsam. Edle Einfalt, stille Größe: Natürliche, sinnliche Spontaneität plus zurückhaltende geistige Souveränität – so gefasst, ist die Würde-Formel Winckelmanns immer noch aktuell.
Der originalgriechische hochsinnige Mensch nach Aristoteles hat alle typischen Eigenschaften des würdigen Menschen, ohne dass der griechische Ausdruck für »Würde« oder »Ansehen« (axia) dabei als Leitbegriff besonders auf den Schild gehoben würde. Denkwürdig und angesichts heutiger Popmusik-Ästhetik recht aktuell ist die Charakterisierung, zu den Merkmalen, die dem »Hochgesinnten« abgingen, gehörten »eine schrille Stimme und fahrige Bewegungen«.
Der Erste, der nach Aristoteles den Hochgesinnten einen »Würdigen« nennt, ist der römische Senator, Meisterredner und Philosoph Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.). Ein wesentlicher Teil seiner persönlichen historischen Würde gründet in dem Verdienst, die nach 450 Jahren ihrer Existenz ernsthaft gefährdete Römische Republik vor der potentiellen Tyrannei des beliebten Heerführers Antonius bewahrt zu haben – durch die Förderung des Antonius-Rivalen und Caesar-Großneffen Octavian, des späteren Kaisers Augustus. Octavian herrschte zwar nach 27 v. Chr. faktisch allein, bestand jedoch selbst darauf, lediglich princeps, der »Erste« in einer formalrechtlich...