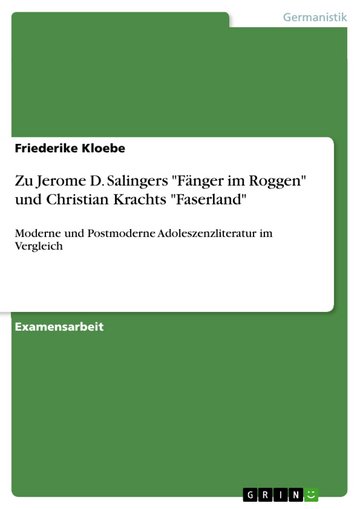3. Analyse der Romane
3.1. Jerome D. Salingers „Der Fänger im Roggen“ als Beispiel eines modernen Adoleszenzromans
Jerome David Salingers 1951 erschienener und 1962 erstmals erfolgreich ins Deutsche übersetzte Roman „Der Fänger im Roggen“[100] war gattungsprägend für den modernen Adoleszenzroman und ist eines der erfolgreichsten und gleichzeitig eines der am Widersprüchlichsten aufgenommenen Werke der amerikanischen Nachkriegsliteratur.[101] Einige Kritiker ließen sich ausgesprochen enthusiastisch über den Roman aus, wie z.B. Ihab Hassan, der den Roman als „some of the best fiction of our time“[102] lobte, wohingegen andere vernichtende Urteile über das Werk fällten und es z.B. als „predictable and boring“[103] bezeichneten. Viele Meinungen und Deutungen stehen in direktem Gegensatz zueinander. Während Strauch eine komplizierte symbolische Struktur im Roman ausmachte, konnte Ways nur ein alptraumhaftes Durcheinander entdecken; sah Vanderbilt eine beginnende Entwicklung zur Reife bei Holden, so sprach Aldridge diesem jegliche Entwicklung ab.[104] Weitere Gegensatzpaare dieser Art gibt es noch viele,[105] doch diese Beispiele sollten genügen, um zu veranschaulichen, dass „Rang, Symbolgehalt, Struktur und Stil des Romans (…) also ebenso umstritten [sind] wie Holdens Entwicklung, die sozialkritischen Implikationen und Salingers philosophische Begründungen seiner Geschichte (…).“[106]
Nichtsdestotrotz oder vielleicht auch gerade deswegen ist der Roman ein Bestseller geworden, der in zahlreiche Sprachen übersetzt und über 35 Millionen Mal verkauft wurde,[107] sowie Eingang in zahlreiche Leselisten an amerikanischen high schools fand und sogar in Deutschland 1966 als Pflichtlektüre für den Deutschunterricht angegeben wurde.[108] Doch auch als Unterrichtsgegenstand löste der Fänger im Roggen eine Kontroverse aus. Empörte Eltern warfen dem Roman einen verderblichen Einfluss auf die Jugendlichen vor und führten durch ihren Protest zur Verbannung des Buches von den Leselisten, sowie sogar zur Suspendierung von Lehrern, die das Werk im Unterricht behandelten.[109]
Die große Bandbreite an unterschiedlichen Äußerungen über den Text resultiert unter anderem daraus, dass nur sehr wenige Aufsätze eine eng am Text bleibende Analyse von Aufbau und Struktur des gesamten Romans beinhalten und dadurch oft auch Fehldeutungen entstehen. Die umfangreichste und ausführlichste Analyse stammt von Freese (1971) und wird auch für die nachfolgende Analyse des Romans mit herangezogen.
Bevor allerdings der Text untersucht wird, erfolgt hier noch eine kurze Bemerkung zum Autor. Salinger lebt extrem zurückgezogen. Insgesamt gab er lediglich zwei Interviews und er wird vermutlich auch keine weiteren geben; des Weiteren hat er sogar sein Foto vom Klappentext des Romans entfernen lassen. Obwohl er sich also gerade nicht als Autor in der Öffentlichkeit inszeniert, wird behauptet, dass ein Teil seines Erfolges gerade daraus resultiere, dass er seine Leserschaft bewusst im Unklaren über seine Person lasse und so zu seiner Mystifizierung beitrage.[110] Im Gegensatz zu Salingers Zurückgezogenheit steht die relativ große Medieninszenierung Christian Krachts, auf die in Kapitel 3.2 kurz eingegangen wird.
3.1.1. Formale Aspekte
Der Roman ist das klassische Beispiel eines Initiationsreise-Romans (vgl. Kapitel 2.2) und lässt sich folglich in drei klar erkennbare Abschnitte einteilen.[111] Der erste Teil umfasst die Kapitel 2 bis 7, in denen das Leben des Protagonisten in der Schule, und damit in einer geordneten Gesellschaft dargestellt wird, aus der er schließlich ausbricht. Kapitel 8 stellt mit der Zugfahrt nach New York die Überleitung zum zweiten Teil des Romans her, der dann die Kapitel 9 bis 19 beinhaltet. Sie schildern die Erlebnisse des nun auf sich alleine gestellten Protagonisten in einer fremden Umwelt. Zu Fuß macht er sich in Kapitel 20 dann auf den Weg nach Hause, also zur Rückkehr in eine Gesellschaft, die in den Kapiteln 21 bis 25 dargestellt wird. Die Kapitel 1 und 26 sind Ein- bzw. Ausleitung des Geschehens und bilden den Erzählrahmen.
Die erlebten Ereignisse werden rückblickend aus der, für den modernen Adoleszenzroman typischen, Ich-Perspektive des 17-jährigen Protagonisten Holden erzählt, der zum Zeitpunkt der Handlung 16 Jahre alt ist (S. 19). Der Zeitraum der Handlung umfasst ein Wochenende kurz vor Weihnachten von Samstag Mittag bis Montag Mittag, wobei jeder der drei Abschnitte einem Wochentag entspricht. Die Erzählzeit ist also nur etwas kürzer als die erzählte Zeit,[112] wodurch die Relevanz der Erlebnisse deutlich wird. Die zeitliche Einteilung spiegelt sich auch im Umfang der Teile zueinander wieder: Die Handlung in Teil 1 und 3 dauert jeweils ca. 12 Stunden und beide Teile sind auch in etwa gleich lang, während Teil 2 ungefähr doppelt so umfangreich ist und einen 24-Stunden-Zeitraum darstellt.[113]
Die sprachliche Gestaltung des Romans ist durch den Charakter des Ich-Erzählers determiniert. Zu Beginn des Romans wird der Leser direkt angesprochen: „Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als Erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war (...)“ (S. 9). Solche Anreden folgen an diversen Stellen des Romans und stellen eine Form von Unmittelbarkeit dar. Es entsteht dadurch beim Leser der Eindruck, Holden erzähle ihm gerade unmittelbar von den Geschehnissen seines ereignungsreichen Wochenendes und der Erzählton ist daher von Mündlichkeit geprägt. Häufig wird z.B. einem vollständigen Satz noch ein „...und so“ angehängt. Umgangssprache und Flüche, wie z.B. die häufig vorkommenden Wörter „verdammt“ und „verflucht“ durchziehen den gesamten Roman. Damit soll zum einen die authentische Sprache eines typischen Jugendlichen wiedergegeben werden, andererseits soll aber die Sprache des Romans durch eine ganz eigene, individuelle Ausdrucksweise Holdens auch zur Charakterisierung des Protagonisten beitragen.[114] Holden habe also „an extremely trite and typical teenage speech, overlaid with strong personal idiosyncrasies.“[115] Die hauptsächlichen sprachlichen Eigenheiten seien das bereits erwähnte “und so” und der Nachsatz “Wirklich.”[116] Holdens „und so“ zeugt laut Costello von Mangel an Ausdrucksfähigkeit und geht teilweise damit einher, dass er mehr weiß, als er sagt. Allerdings denke ich, dass Holden sich durchaus präziser ausdrücken könnte, wenn er wollte, da er belesen und sprachreflektiert[117] ist. Er liest „eine Menge Klassiker“ (S. 31) und wünscht sich bei guten Büchern, er könne mit dem Autor telefonieren (S. 31). Meiner Meinung nach hat er also entweder einfach keine Lust sich anders auszudrücken, oder er treibt bewusstes understatement, um cool zu wirken. Das unterstelle ich auch seiner Aussage „Ich bin ziemlich ungebildet, aber ich lese viel“ (S. 39). Der häufig verwendete Nachsatz „wirklich“ zeugt davon, dass Holden sich in der verlogenen Welt dazu verpflichtet fühlt, seine Aufrichtigkeit zu beteuern.
3.1.2. Soziale Kontakte und Kommunikation
Holden befindet sich zwar anfangs durch seinen Aufenthalt in der Schule in einer Gemeinschaft, allerdings kann man sich seine Mitschüler nicht aussuchen und die Gemeinschaft basiert daher auf Zwang. Die beiden dem Leser vorgestellten Schulkameraden Ackley und Stradlater sind keine Freunde von Holden. Der Außenseiter Ackley ist ungepflegt, ignorant und merkt nicht, wenn er stört (S. 31-40). Holden zieht die Lektüre eines Buches einem Gespräch mit ihm vor (S. 32). Allerdings hat er auch Mitleid mit ihm und nimmt ihn daher mit ins Kino (S. 56, S. 51f). Stradlater hingegen ist das Gegenteil von Ackley. Er ist gutaussehend, sportlich und hat viele Verabredungen mit Mädchen, allerdings ist er eingebildet und oberflächlich (S. 41f). Holden findet Stradlater nicht unsympathisch, er mag seine Großzügigkeit (S. 38) und seine Freundlichkeit (S. 39), jedoch findet er diese auch teilweise verlogen. Zum Zerwürfnis zwischen den beiden kommt es schließlich aus Eifersucht.[118] Als Freund bezeichnet Holden nur seinen Schulkameraden Mal Brossard (S. 51), jedoch wird das Verhältnis der beiden durch eine sprachliche Klammer wieder dekonstruiert:[119] Als Holden im Kino mit Ackley und Brossard ist, „lachten beide wie die Hyänen über Sachen, die nicht mal komisch waren.“ (S. 53) Samstagabend in New York begegnet Holden einem „Haufen rowdyartige(r) Typen mit ihren Schnecken, und alle lachten sie wie die Hyänen über was, was garantiert nicht komisch war“ (S. 108) und kurze Zeit später bemerkt er über das oberflächliche Publikum in Ernies Bar: „Es waren genau die gleichen Idioten, die bei Filmen wie die Hyänen über Sachen lachten, die überhaupt nicht komisch sind.“ (S. 111) Durch diese Wortklammer wird Mal Brossard in eine Reihe mit unangenehmen, oberflächlichen Menschen gestellt und wird dadurch als echter Freund fragwürdig.
Eine weitere bezeichnende Tatsache ist die, dass Holden in seinem Adressbuch nur drei Telefonnummern notiert hat, und zwar die von Jane,...