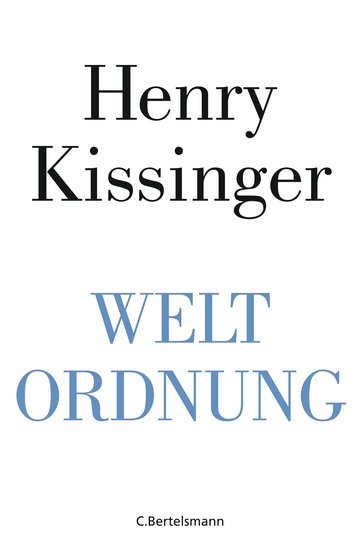Einleitung: Die Suche nach einer Weltordnung
Als junger Akademiker berief ich mich in einer Rede, die ich 1961 in Kansas hielt, auf Präsident Harry S. Truman. Er hatte auf die Frage, was ihn als Präsidenten besonders stolz gemacht habe, geantwortet, »dass wir unsere Feinde völlig besiegten und sie dann als Gleichgestellte in die Völkergemeinschaft zurückgeführt haben. Ich nehme an, dass nur Amerika so etwas tun würde«. Truman war sich der riesigen Macht Amerikas bewusst, aber stolz war er vor allem auf die humanitären und demokratischen Werte der USA. Er wollte, dass man sich weniger an die Siege Amerikas als vielmehr an seine Versöhnungsleistungen erinnerte.
Seit Truman haben sich alle Präsidenten diese Auffassung in irgendeiner Form zu eigen gemacht und sich voller Stolz auf ähnliche Attribute der amerikanischen Geschichte berufen. Und für den größten Teil dieses Zeitraums spiegelte die Völkergemeinschaft, für deren Erhalt diese Präsidenten sich einsetzten, einen amerikanischen Konsens wieder – eine sich stetig ausbreitende, kooperative Ordnung von Staaten, die gemeinsamen Regeln und Normen folgen, liberale Wirtschaftssysteme haben, territorialer Eroberung abschwören, nationale Souveränität achten und sich partizipative und demokratische Regierungssysteme geben. Amerikanische Präsidenten beider Parteien drängen andere Staaten unermüdlich und oft sehr nachdrücklich und mit großer Überzeugungskraft, sich dem Schutz und der Achtung der Menschenrechte zu verpflichten. Und in vielen Fällen trägt die Verteidigung dieser Werte durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dazu bei, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen grundlegend verändern.
Heute jedoch steht dieses »regelbasierte« System vor großen Herausforderungen. Schon die häufigen Ermahnungen an andere Länder, »ihren angemessenen Teil beizutragen«, sich an »die Regeln des 21. Jahrhunderts zu halten« oder sich in dem gemeinsamen System als »verantwortungsbewusste Akteure« zu verhalten, verdeutlichen die Tatsache, dass es keine allgemeine Definition des Systems und auch kein gemeinsames Verständnis dessen gibt, was denn nun ein »angemessener« Beitrag sein könnte. Außerhalb der westlichen Welt wird die Gültigkeit dieser Regeln in ihrer derzeitigen Form von Staaten und Regionen infrage gestellt, die eine minimale Rolle bei ihrer ursprünglichen Formulierung spielten; sie lassen keinen Zweifel aufkommen, dass sie diese Regeln modifizieren wollen. Während man sich heute vielleicht häufiger als in jeder anderen Ära auf »die internationale Staatengemeinschaft« beruft, bietet uns diese Gemeinschaft kein klares Bild, keine fest vereinbarten Ziele, Methoden oder Grenzen.
Unser Zeitalter sucht beharrlich, und manchmal geradezu verzweifelt, nach dem Konzept einer Weltordnung. Chaos droht, doch zugleich herrscht eine noch nie da gewesene Interdependenz: im Hinblick auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, den Zerfall von Staaten, die Auswirkungen der Umweltzerstörungen, die immer wieder begangenen Völkermorde und die Ausbreitung neuer Technologien, die es ermöglichen, Konflikte so weit zu eskalieren, dass sie unkontrollierbar und letztlich auch undurchschaubar werden. Neue Methoden der Verfügbarkeit und der Weitergabe von Informationen verbinden und einen die Regionen dieser Welt wie nie zuvor und projizieren jedes Ereignis auf eine globale Ebene. Doch das geschieht auf eine Art und Weise, die jede Reflexion behindert und die politischen Führer zwingt, ihre Reaktionen unverzüglich kundzutun, und das in der möglichst schlichten Form von Schlagzeilen. Stehen wir vor einem neuen Zeitabschnitt, in dem die Zukunft durch Kräfte bestimmt wird, die durch keine Ordnung mehr begrenzt werden?
Varianten der Weltordnung
Bis heute gab es keine wahrhaft globale »Weltordnung«. Was unsere Zeit als Ordnung versteht, wurde vor fast vier Jahrhunderten in Westeuropa entworfen, auf einer Friedenskonferenz in Westfalen. Sie fand ohne Beteiligung oder auch nur Wissen der meisten anderen Kontinente oder Zivilisationen statt. Vorausgegangen war ein Jahrhundert religiöser Konflikte und politischer Umwälzungen in Mitteleuropa, die schließlich im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) ihren Höhe- oder vielmehr Tiefpunkt erreicht hatten – einem wahren Flächenbrand, in dem sich politische und religiöse Zwistigkeiten vermischten, die Konfliktparteien den »totalen Krieg« gegen die Bevölkerungszentren führten und fast ein Viertel der mitteleuropäischen Bevölkerung an Kriegsfolgen, Krankheiten oder Hunger starb. Die erschöpften Kriegsparteien einigten sich schließlich auf eine Reihe von Vereinbarungen, durch die weiteres Blutvergießen verhindert werden sollte. Die religiöse Einheit war brüchig geworden: Der Protestantismus hatte überlebt und sich weiter ausgebreitet. Politische Vielfalt war schon in der schieren Menge autonomer politischer Einheiten angelegt, die sich so lange bekämpft und doch nur ein Patt erreicht hatten. Doch damit zeigte Europa bereits bestimmte Bedingungen unserer heutigen Welt auf: Es existierte eine Vielzahl politischer Einheiten, von denen keine stark genug war, um alle anderen zu besiegen, und die zum Teil gegensätzlichen Philosophien anhingen und unterschiedliche Regierungssysteme hatten. Nun jedoch begaben sie sich gemeinsam auf die Suche nach neutralen Regeln für ihr Verhalten und für die Schlichtung ihrer Konflikte.
Im Westfälischen Frieden spiegelte sich eine pragmatische Anpassung an die Realität und keineswegs eine einzigartige moralische Einsicht. Er beruhte auf einem System unabhängiger Staaten, die davon Abstand nahmen, sich in die inneren Angelegenheiten der anderen einzumischen, und die die jeweiligen Bestrebungen der anderen durch ein allgemeines Gleichgewicht der Kräfte zu kontrollieren suchten. In den europäischen Konflikten hatte sich kein Anspruch auf eine alleinige Wahrheit und keine universale Vorherrschaft durchzusetzen vermocht. Vielmehr wurden nun alle Staaten mit dem Attribut der Souveränität über das eigene Territorium ausgestattet. Jeder Staat anerkannte die inneren Strukturen und das religiöse Bekenntnis der anderen Staaten als Realitäten und enthielt sich jeder Infragestellung ihrer Existenz. Das Mächtegleichgewicht wurde nun als natürlich und erwünscht angesehen; auch die Bestrebungen der Herrscher wurden in ein Gleichgewicht gestellt, und zumindest theoretisch wurde die Tragweite der Konflikte begrenzt. Teilung und Vielfalt, Zufallsprodukte der europäischen Geschichte, wurden zu Kennzeichen eines neuen Systems der internationalen Ordnung, das eine eigene, klare philosophische Perspektive hatte. In diesem Sinne gestaltete und umriss das damalige Bemühen, den Flächenbrand in Europa zu beenden, bereits die moderne Befindlichkeit: Es enthielt sich eines Urteils über das Absolute zugunsten einer pragmatischen und ökumenischen Weltsicht, und es wollte Ordnung schaffen, indem es die bestehende Vielfalt anerkannte und gleichzeitig gegenseitige Zurückhaltung zusicherte.
Die Verhandlungsführer des 17. Jahrhunderts, die den Westfälischen Frieden aushandelten, konnten natürlich nicht ahnen, dass sie das Fundament für ein global anwendbares System legten. So unternahmen sie auch keinen Versuch, das benachbarte Russland einzubeziehen. Russland hatte gerade seinen eigenen Albtraum hinter sich, die sogenannte »Zeit der Wirren« (russ. »Smuta«, eine von politischen Unruhen, Hungersnöten und Interventionen ausländischer Mächte geprägte Periode, 1598–1613; A. d. Ü.), und machte sich nun daran, seine innere Ordnung neu zu festigen. Dabei wurden bestimmte Prinzipien verankert, die in einem ausgeprägten Gegensatz zum Westfälischen Gleichgewicht standen: ein einzelner, absolut regierender Herrscher, eine einheitliche religiöse Orthodoxie und ein Programm territorialer Expansion in alle Himmelsrichtungen. Auch die anderen wichtigen Machtzentren betrachteten den Westfälischen Frieden (sofern sie überhaupt davon erfuhren) als für ihre eigenen Regionen nicht relevant.
Die Idee einer Weltordnung bezog sich damals nur auf den geografischen Raum, der den zeitgenössischen Staatsmännern bekannt war – und dieses Muster wiederholte sich auch in anderen Regionen. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, dass der damalige Stand der Technologie die Steuerung eines einzigen globalen Systems weder beförderte noch überhaupt zuließ. Da es weder Instrumente einer kontinuierlichen Interaktion noch einen Bezugsrahmen gab, durch den sich die Macht einer Region im Vergleich zu einer anderen einschätzen ließ, betrachtete jede Region ihre eigene Ordnung als einzigartig und definierte die anderen Völker als »Barbaren« – die in einer Weise regiert wurden, welche der etablierten Ordnung unverständlich und für ihre Ziele irrelevant erschien, sofern sie nicht sogar als Bedrohung wahrgenommen wurde. Jede Ordnung definierte sich selbst als Mustervorlage für die legitime Organisation der Menschheit und wollte durch ihre Herrschaft über die unmittelbare Umgebung auch zugleich die Welt ordnen.
Am Europa entgegengesetzten Ende der eurasischen Landmasse bildete China das Zentrum seines eigenen, hierarchischen und theoretisch universalen Ordnungskonzepts. Es war ein System, das seit Jahrtausenden funktioniert hatte – es hatte bereits bestanden, als das Römische Weltreich Europa als Einheit beherrschte. Das chinesische Ordnungskonzept gründete nicht auf der souveränen Gleichheit von Staaten, sondern auf der Annahme, dass der Einfluss des Kaisers grenzenlos sei. In diesem Konzept gab es keine Souveränität im europäischen Sinne, weil der Kaiser über alles »unter dem Himmel« herrschte. Er stand an der Spitze einer politischen und kulturellen Hierarchie, einzigartig und...