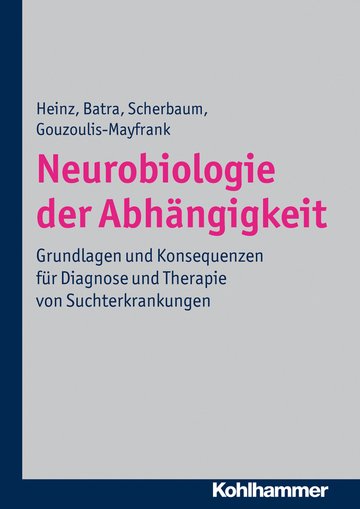2 Was macht Substanzen wie Alkohol, Heroin, Kokain und Nikotin zu Drogen?
Alkohol und Nikotin gelten als Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial und damit als Drogen, die zu einer Abhängigkeitserkrankung führen können. Diese Definition mag auf den ersten Blick überraschen, ist man doch gewohnt, bei Drogen eher an sog. harte Drogen und damit an Substanzen wie Heroin oder Kokain zu denken, deren Konsum illegal ist und die zu schweren Abhängigkeitserkrankungen führen. Allerdings sind die gesundheitlichen Konsequenzen des Nikotin- und Alkoholkonsums als ähnlich schwer wie die des Konsums illegaler Drogen einzuschätzen. So sterben pro Jahr in Deutschland bis zu 2.000 Menschen aufgrund des Gebrauchs illegaler Drogen, etwa 40.000 durch Alkoholwirkungen und bis zu 140.000 Menschen durch Nikotinkonsum und seine Folgen (DHS, 2010). Bezieht man die Zahl der Todesfälle auf die Anzahl der abhängig erkrankten Personen, die beim Konsum illegaler Drogen um 200.000 liegt, bei Alkoholabhängigkeit um ca. 1,3 Millionen und bei Nikotinabhängigkeit um 14 Millionen Menschen (BfG, 2010b), so sterben jeweils etwa 1 bis 3 % aller Drogenkonsumenten an den Folgen dieser Drogeneinnahme, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Alkohol, Nikotin oder illegale Drogen handelt. Eine Gefährlichkeit des Konsums für die Gesundheit ist also bei all diesen Drogen gegeben. Aber was macht eine Droge zur Droge?
Vereinfachend könnte man sagen, dass eine Substanz dann eine Droge ist, wenn sie eine Abhängigkeitserkrankung hervorrufen kann. In den internationalen Klassifikationssystemen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (American Psychiatric Association, APA) werden Abhängigkeitserkrankungen relativ übereinstimmend durch die Entwicklung von Toleranz gegenüber den Substanzwirkungen und das Auftreten von Entzugserscheinungen beim plötzlichen Absetzen der Substanz einerseits und durch das Verlangen nach der Substanz sowie die verminderte Kontrolle im Umgang mit der Substanz andererseits charakterisiert (WHO: ICD-10; APA: DSM-IV). Auf die genaue Definition und die neurobiologischen Grundlagen dieser Phänomene wird in weiteren Kapiteln eingegangen werden.
Im Tierversuch kann man oft schon vor der Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung abschätzen, ob eine Substanz eine Droge ist oder nicht. Denn um als Droge zu gelten, muss die Substanz zwei Eigenschaften erfüllen: Sie muss eine bestimmte, charakteristische Befindlichkeit auslösen, die von der Wirkung anderer Substanzen unterschieden werden kann, und sie muss freiwillig konsumiert werden und dabei so attraktiv sein, dass das Tier Anstrengungen unternimmt, diese Droge zu erlangen, oft auf Kosten anderer Aktivitäten (Wise, 1988; di Chiara, 1995; Tzschentke, 1998). Wenn man also gar nicht merkt, dass der Konsum einer Substanz seelische Phänomene auslöst und wenn diese Wirkungen nicht zumindest teilweise so angenehmer Art sind, dass der Substanzkonsum wiederholt wird, dann bildet sich keine Abhängigkeitserkrankung aus. Wenn umgekehrt die seelischen Wirkungen von zwei Drogen relativ ähnlich sind, dann kann die eine anstelle der anderen konsumiert werden, und es gibt einen Hinweis darauf, dass beide Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial ähnliche neurobiologische Vorgänge im Gehirn auslösen. Beispielsweise stimulieren sowohl Nikotin wie Amphetamin eine Dopaminausschüttung in bestimmten Hirnregionen wie dem ventralen Striatum, die zu so angenehmen Gefühlen führen soll oder so viel Begierde nach der Substanz auslöst, dass der Drogenkonsum wiederholt wird (Wise, 1988; di Chiara, 1995; Heinz et al., 2009a). Die neurobiologischen Systeme, die drogenassoziierte Gefühle von Lust oder Begierde vermitteln, werden im weiteren Verlauf genauer dargelegt.
2.1 Lernmechanismen in der Entstehung und Aufrechterhaltung abhängigen Verhaltens
Wichtig für die Entstehung einer Abhängigkeitserkrankung sind Lernmechanismen wie der Prozess der klassischen Konditionierung, die dazu führen können, dass nicht nur die Droge selbst, sondern auch Umweltreize oder Situationen, die regelmäßig mit dem Drogenkonsum gepaart waren, eine Motivation zum weiteren Drogenkonsum auslösen. Eine erste derartige Beobachtung wurde von Wikler berichtet (1948), dem auffiel, dass Ratten, die immer in einer bestimmten Umgebung Opiate erhielten, Entzugserscheinungen zeigten, wenn sie in diese Box platziert wurden und die Opiateinnahme ausblieb. Offenbar reagierten die Tiere mit einer konditionierten Reaktion, die der Drogenwirkung entgegengesetzt war und die bei Ausbleiben der Opiateinnahme zu Entzugserscheinungen führte. Eine derartige, der Drogenwirkung entgegengesetzte konditionierte Reaktion ist eigentlich ein Schutzmechanismus gegen eine Überdosierung durch das Suchtmittel: Wenn beispielsweise dieselbe Opiatmenge, an die sich ein Individuum gewöhnt hat, außerhalb des normalen Applikationsortes verabreicht wird, kann es zu Atemstillstand und Tod kommen (Siegel et al., 1982). Die der Drogenwirkung entgegengesetzte, konditionierte Reaktion erhöht die Toleranz gegenüber dem Suchtmittel. Sie kann aber das Rückfallrisiko eines Abhängigkranken erhöhen, wenn dieser in eine Situation gerät, in der er früher regelhaft Drogen konsumiert hat. Denn jetzt kann der konditionierte Entzug so unangenehm sein, dass sich ein starkes Verlangen nach Drogen einstellt, deren Konsum die negativen Entzugswirkungen reduzieren soll (Verheul et al., 1999). Man spricht hier von negativer Verstärkung, weil die Drogeneinnahme durch den Wegfall unangenehmer Entzugserscheinungen belohnt wird.
Ein weiterer Lernmechanismus, der an der Entstehung abhängigen Verhaltens beteiligt ist, ist die sog. positive Verstärkung durch die angenehmen Wirkungen des Drogenkonsums, die auch durch konditionierte, regelhaft mit der Drogeneinnahme assoziierte Reize ausgelöst werden kann (Wise, 1988). Hier wurde oft eine durch Drogen und drogenassoziierte Reize bewirkte Dopaminausschüttung im ventralen Striatum als ursächlich angesehen (Wise, 1988; di Chiara, 1995). Eine alternative Hypothese vertraten Robinson und Berridge (1993), die annahmen, dass drogenassoziierte Reize zwar eine Dopaminausschüttung im ventralen Striatum bewirken, dass diese aber nicht mit Lust- oder Glücksgefühlen, sondern mit dem Verlangen nach der Suchtsubstanz verbunden sei. So sei es zu erklären, dass Drogen auch dann konsumiert werden, wenn die Einnahme längst nicht mehr als angenehm oder euphorisierend erlebt wird. Das Verlangen nach einer Substanz muss also von der Lust am Genuss dieser Substanz unterschieden werden. Argumente für und wider diese These werden bei der Beschreibung des dopaminergen Verstärkungssystems und seiner Verbindung zu anderen Neurotransmittersystemen diskutiert.
2.2 Störungen der Verhaltenskontrolle und zwanghafter Suchtmittelkonsum – mögliche neurobiologische Korrelate
Abhängiges Verhalten wird häufig durch die positive und negative Verstärkung der Substanzeinnahme erklärt. Ruft also eine Droge bei einem Individuum eine besonders starke Stimmungssteigerung hervor, hat sie wenig unangenehme Nebenwirkungen und reduziert sie gar Entzugserscheinungen, die sich nach chronischem Gebrauch eingestellt haben, dann tritt der Konsum verstärkt auf (Wise, 1988). Die Konzentration auf die verhaltensverstärkenden Wirkungen einer Substanz mit Abhängigkeitspotenzial übersieht jedoch, dass viele Abhängige der Droge sehr ambivalent gegenüberstehen und versuchen, den Konsum einzuschränken oder einzustellen (Robbins und Everitt, 1999). Der Drogenkonsum findet dann statt, wenn die bewusste Entscheidung, keine Drogen zu nehmen, durch die Motivation zum Suchtmittelkonsum „überrannt“ wird. Das heißt, dass die Abhängigkeitsentwicklung auch durch eine Schwäche oder Störung der Verhaltensplanung und Verhaltenskontrolle und damit der Bewertung langfristiger Ziele gegenüber den kurzfristig positiven Wirkungen des Suchtmittelkonsums befördert wird (Breier et al., 1999). Diese Funktionen werden traditionell dem frontalen Kortex zugeschrieben, insbesondere der Haubenregion, dem sog. dorsolateralen präfrontalen Kortex (d’Esposito et al., 1995; Bechara et al., 1998). Von zentraler Bedeutung für die Verhaltenssteuerung ist auch das anteriore Cingulum, das besonders bei einem Konflikt zwischen konkurrierenden Handlungsmöglichkeiten aktiviert wird (Carter et al., 1998). Ein solcher Konflikt kann sich zwischen der Abstinenzentscheidung und der Motivation zur Drogeneinnahme ergeben.
Die neuronalen Strukturen des frontalen Kortex, die dieser Verhaltenskontrolle zugrunde liegen, werden nun beispielsweise durch chronischen Alkoholkonsum besonders beeinträchtigt (Kril et al., 1997). Möglicherweise ist eine Störung dieser Hirnregionen aber bereits an der Entstehung der Alkoholabhängigkeit beteiligt. Eine solche Störung des frontalen Kortex könnte als Folge verschiedener Krankheiten und Verletzungen auftreten, wie sie bei einer alkoholbedingten Schädigung des Fetus im Mutterleib, Hirntraumen bei körperlichem Missbrauch oder im Rahmen der Disposition zu Aufmerksamkeitsstörungen und dem sog. hyperkinetischen Syndrom gegeben sind (Giancola und Moss, 1998). Die damit verbundene Störung der langfristigen Handlungsplanung könnte dazu beitragen, dass die auf kurzfristige Belohnung ausgerichtete Motivation zur Drogeneinnahme das Verhalten bestimmt und es zum Rückfall kommt.
Drogenverlangen und stereotyper Drogenkonsum tragen Züge zwanghafter Verhaltensweisen. Gerade bei Patienten mit langer Dauer der Abhängigkeitserkrankung löst die Droge oft kaum noch angenehme Gefühle aus, trotzdem denken diese Patienten oft obsessiv an den Drogenkonsum (Anton et al., 1995). Die neurobiologischen Strukturen, die diesem zwanghaften Alkoholverlangen zugrunde liegen können, sind...