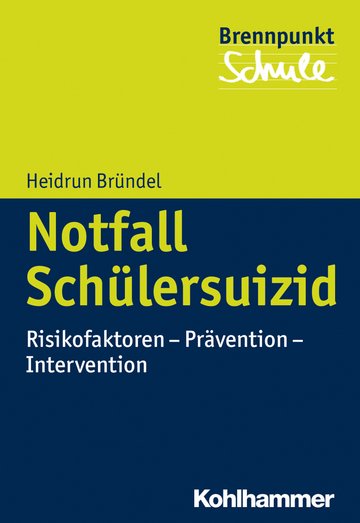3
Einteilung in Programmkategorien und ihre kritische Wertung
Auf der Basis solcher Bedenken oder gerade trotz dieser Bedenken erschienen zu Beginn des jetzigen Jahrtausends bis heute in angloamerikanischen Ländern anhaltend viele Buchbeiträge, Übersichtsartikel und ›systematic reviews‹. Die Autoren unterzogen die existierenden Präventionsprogramme der letzten zehn bis fünfzehn Jahre einer kritischen Sicht und einer systematischen Kategorisierung (Shaffer & Gould 2002; Gould, Greenberg, Drew, Velting & Shaffer 2003; Kalafat 2003; Mann, Apter, Bertolote et al. 2005; Chagnon, Houle, Marcoux & Renaud 2007; Yip 2011; Cusimano & Sameem 2011; Robinson, Hetrick & Martin 2011; van de Feltz-Cornelis, Sarchiapone, Postuvan et al. 2011; Robinson, Yuen, Martin et al. 2011; Roscoät & Beck 2013; Robinson, Cox, Manole et al. 2013; Silva, de; Parker, Purcel et al. 2013; Klimes-Dougan, Klingbeil & Meller 2013). Fast alle Autoren kamen zu der Erkenntnis, dass – selbst wenn es einige positive Effekte gegeben haben mag – die Programme doch mit einiger Vorsicht betrachtet werden müssten.
Die bestehenden angloamerikanischen Programme wurden zunehmend differenziert betrachtet und je nach inhaltlichen Schwerpunkten in unterschiedliche Programmkategorien eingeteilt. Sie wurden einer weiteren kritischen Sicht unterzogen:
1. Psychoedukative Präventionsprogramme
2. Screeningverfahren
3. Gatekeeper-Programme
4. Postventive Interventionen
3.1 Psychoedukative Präventionsprogramme
Psychoedukative Präventionsprogramme werden direkt im Unterricht eingesetzt und informieren Schülerinnen und Schüler vor allem über das Thema ›Suizid‹. Über ihre Effektivität gibt es widersprüchliche Meinungen. Einige Programme sollen zu einer Abnahme von Suizidgedanken und Suizidversuchen geführt haben (Aseltine & DeMartino 2004), aber valide Forschungsbelege gibt es dafür bis heute nicht (Cusimano & Sameem 2011). Das hat u. a. mit statistischen, aber auch ethischen Problemen der Messung zu tun: Randomisierte Kontrollgruppen in experimentellen Forschungsdesigns verbieten sich beim Thema Suizid. Bei Schülerinnen und Schülern konnte allerdings eine Verbesserung der Kenntnisse über Suizid festgestellt werden (a. a. O.). Dies bestätigen weitere Autoren (Portzky & van Heeringen 2006; Aseltine, James, Schilling & Glanovsky 2007). Doch mehr Wissen allein – so wird von Klimes-Dougan, Klingbeil & Meller (2013) kritisch angemerkt – verändert noch nicht die bei vielen Jugendlichen bestehende und gefährliche ›positive Einstellung‹ zum Suizid. Andere Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass Präventionsprogramme die Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern gestärkt hätten, sich Hilfe und Unterstützung zu holen (Klingman & Hochdorf 1993; Ciffone 1993; 2007; Kalafat & Elias 1994; Kalafat & Gagliano 1996).
Exkurs
In der angloamerikanischen Literatur wird die Bedeutung der ›Einstellung zum Suizid‹ immer wieder betont. Damit ist gemeint, dass viele Jugendliche häufig eine im Grunde ›positive Einstellung‹ zum Suizid haben. Sie glauben, Suizid würde bei Stress und Belastungen eine Handlungsoption darstellen. Sie unterschätzen, verkennen oder ignorieren damit die dem Suizid oftmals vorausgehende Depression und die damit zusammenhängende psychische Erkrankung.
Es gibt Programme, die Suizid als eine verständliche, jedoch fehlgeleitete Antwort auf belastende Ereignisse ansehen und Schülerinnen und Schülern Filme zeigen, in denen Teenager davon berichten, dass sie sich so belastet gefühlt und nicht mehr gewusst hätten, wie sie ihre Probleme anders hätten lösen können als durch einen Suizidversuch (Garland, Shaffer & Whittle 1989). Diese Sichtweise steht im Widerspruch zu dem in der Wissenschaft etablierten Verständnis von Suizid als psychischer Krankheit und ignoriert die Bedeutung depressiver Symptome.
Die Schlussfolgerung daraus lautet, dass bevor Suizidpräventionsprogramme in Schulen eingesetzt werden, sie auf das ihnen zugrunde liegende Verständnis von Suizid kritisch geprüft werden sollten (Shaffer & Gould 2002). Lehrkräfte müssen daher Schülerinnen und Schülern klar und deutlich zu verstehen geben, dass Suizidalität eine ›psychische Erkrankung‹ darstellt, die mit großem psychischem Leid, depressiven Stimmungen und Verzweiflung gekoppelt ist. Ihnen muss außerdem verdeutlicht werden, dass Suizidsymptome erkannt werden können und das tödliche Ende verhindert werden kann.
Shaffer & Gould (2002) berichten von insgesamt enttäuschenden Ergebnissen. Die erhofften Ziele, nämlich zu erreichen, dass Klassenkameraden in der Lage wären, auf Warnsignale zu achten und suizidgefährdete Klassenkameraden zu erkennen, seien nicht erreicht worden. Ebenso wenig hätten sie dazu geführt, dass Klassenkameraden sich trauten, Erwachsene über Freunde in psychischer Not zu informieren. In noch geringerem Maße hätten Programme zu einer abnehmenden Scheu der Jugendlichen geführt, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen (›help-seeking-behavior‹).
Die geringe Effektivität vieler psychoedukativer Programme kann u. a. auch mit der Art ihrer Durchführung, die meistens klassenweise geschah, begründet werden. Diese Vorgehensweise spricht den einzelnen Jugendlichen zu wenig an. Damit kann es zusammenhängen, dass sich die depressive Stimmung der Schülerinnen und Schüler wenig oder nicht verändert hat und ihre Copingstrategien auch nicht gestärkt werden konnten (a. a. O.). Um eine wirkliche Veränderung zu erzielen, bedarf es – so das Fazit – einer individuelleren Ansprache der Schülerinnen und Schüler sowie einer persönlichen Hilfestellung.
Eine große Anzahl der psychoedukativen Programme war ›selbstgestrickt‹ und nicht evaluiert worden. Bei manchen Suizidprogrammen bestand sogar die Gefahr möglicher schädlicher Einflüsse (Klimes-Dougan, Klingbeil & Meller 2013). Einige Studien haben als Folge von Suizidprogrammen eine Abnahme ›wünschenswerter Einstellungen‹ zum Suizid – Erkennen, dass Suizid das Ende einer psychischen Erkrankung darstellt – herausgefunden (Gould, Greenberg, Dres, Velting & Shaffer 2003).
Psychoedukative Programme bestehen häufig nur aus kurzen Unterrichtseinheiten. Zwei- bis Vier-Stunden-Einheiten können jedoch – entgegen bester Absicht – vor allem latent suizidale Schülerinnen und Schüler ermutigen, Suizid zu begehen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn dem Suizidgeschehen das Stressmodell zugrunde gelegt wird, d. h., dass Suizid als Antwort auf erhöhte Belastungen angesehen wird. Unterrichtseinheiten, die Suizid dagegen als psychische Erkrankung ansehen und gesundheitsfördernde Aspekte betonen und dabei die Schutzfaktoren besonders herausstreichen, sind eher in der Lage, Suizidgedanken und -pläne von Schülerinnen und Schülern zu reduzieren (http://theguide.fmhi.usf.edu; Stand: 4.9.2014).
An Schulen gerichtete Anregungen lauten (a. a. O.):
Vermeiden Sie kurze Unterrichtseinheiten.
Betonen Sie den Krankheitsaspekt von Suizid.
Besprechen Sie das Thema ›Suizid‹ nicht in Klassen, in denen Schülerinnen oder Schüler sind, die einen Suizidversuch begangen haben.
Stärken Sie vor allem Problemlöse- und Bewältigungsfähigkeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler.
Setzen Sie sich im Kollegium für abgestimmte Vorgehensweisen bei Verdacht auf Suizidgefährdung ein.
In vielen Programmen wird zu Recht eine Enttabuisierung des Suizids angestrebt. Das ist jedoch nicht ganz unproblematisch, denn damit geht die Gefahr einher, den Suizid zu ›normalisieren‹. Es könnte manche Jugendliche verführen, ihn spontan und unüberlegt doch als Handlungsoption zu verstehen, was ja gerade vermieden werden soll. Wenn Suizid u. a. als zweithäufigste Todesart bei Jugendlichen in Deutschland dargestellt wird – was der statistischen Tatsache entspricht –, so kann schon diese Information bei Jugendlichen den Eindruck erwecken, dass Suizid auch für sie ein gangbarer Weg sei, wenn ihn doch so viele beschreiten. So gerechtfertigt eine Enttabuisierung auch erscheint, es muss damit sensibel und verantwortungsvoll umgegangen werden.
Mann, Apter, Bertolote et al. (2005) favorisieren Programme, die vor allem Hinweise auf Unterstützungsmaßnahmen in den Mittelpunkt stellen und...