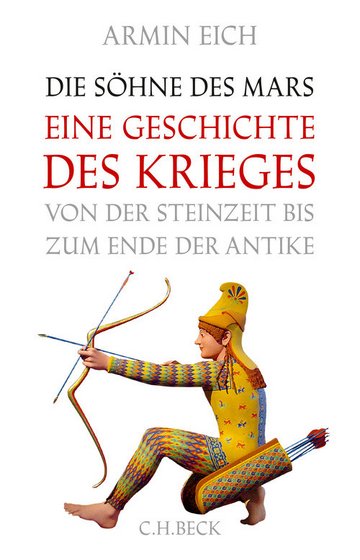1
KRIEG, SEIT ES MENSCHEN GIBT?
Die Frage, ob Krieg geführt wird, seit es Menschen gibt, oder ob er sich als soziales Verhalten erst entwickelt hat, wurde schon in der antiken Literatur gestellt und unterschiedlich beantwortet. Für die einen, wie Platon und Thukydides, gehörte der Krieg untrennbar zur Natur des Menschen, für andere, wie den Philosophen Epikur und seinen Schüler Lukrez, ist der Krieg erst im Laufe der Geschichte unter bestimmten sozialökonomischen Bedingungen entstanden. Thukydides folgte später Thomas Hobbes, so wie Jean-Jacques Rousseau sich auf Lukrez für seine der Hobbes’schen widersprechende Geschichtsrekonstruktion berief. Die auf diese Autoren zurückgehenden Positionierungen spalten noch heute die Forscher in Hobbesianer, die den Krieg als eine unvermeidliche Begleiterscheinung der menschlichen Existenz betrachten, und Rousseauianer, die den Krieg für historisch geworden und damit prinzipiell für überwindbar halten. In jüngster Zeit ist die Auseinandersetzung wieder aufgelebt, allerdings auf einer gänzlich veränderten Grundlage. Während Hobbes, Rousseau und ihre Zeitgenossen des 17. und 18. Jahrhunderts noch darauf angewiesen waren, sich den Verlauf der Geschichte so auszumalen, wie sie ihn aufgrund ihres Menschenbildes für plausibel erachteten, steht heute eine Fülle empirischen Materials zur Verfügung, das bei der Entscheidung zwischen beiden Auffassungen hilfreich sein kann. Grundsätzlich hat dies an der Positionierung der beiden Lager nichts geändert. Es ist zu befürchten, dass individuelles Temperament und persönliche Erfahrungen immer noch eine größere Rolle bei der Beantwortung der Frage nach der Ewigkeit oder dem Gewordensein des Krieges spielen als die unvoreingenommene Beurteilung der Befunde. Doch ist gleichzeitig einzuräumen, dass die heute vorliegenden Quellen bei all ihrer Reichhaltigkeit tatsächlich erheblichen Spielraum für unterschiedliche Deutungen lassen.
Zu den wichtigsten Hobbesianern der Gegenwart gehören Lawrence Keeley, Steven LeBlanc, Ian Morris und Steven Pinker. Von großem Vorteil für ihren Standpunkt ist, dass sie aus einer nahezu unerschöpflichen Fülle von archäologischem und ethnographischem Anschauungsmaterial auswählen konnten, das sie in ihren reich illustrierten Werken vor ihren Lesern ausgebreitet haben: zerschlagene und abgetrennte Schädel, von Pfeilen durchbohrte Körper, erwürgte, erschlagene, zerteilte und erschossene Menschen aus allen Erdteilen und unterschiedlichen Epochen der Geschichte und Vorgeschichte auf insgesamt mehreren tausend Seiten. Schon das Durchblättern dieser Werke und die Betrachtung der Bilder reichen aus, um dem Leser die gesicherte Überzeugung zu vermitteln, dass Menschen anderen Menschen seit Jahrtausenden unsagbare Gewalt angetan haben. Daran haben auch die Rousseauianer prinzipiell nie gezweifelt. Offen bleiben allerdings die grundsätzlichen Fragen, ob diese Gewaltintensität eine durchgehende historische Konstante war und wie die spezielle Form der Gewaltausübung, die der Krieg darstellt, in dieser Hinsicht zu beurteilen ist. Wenn man die Werke der genannten Autoren unter diesen Fragestellungen genauer betrachtet, fällt auf, dass das eindrücklich präsentierte Material unter historischen Gesichtspunkten nicht immer hinreichend differenziert interpretiert und eingeordnet worden ist. An dieser Stelle setzt die Kritik der Rousseauianer an, die nun aber nicht in allen Details, sondern nur hinsichtlich einiger besonders aussagekräftiger Aspekte referiert werden kann.
Als Ausgangspunkt für die Darstellung dieser kritischen Positionen kann das Buch Steven Pinkers The Better Angels of our Nature, das unter dem Titel Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit ins Deutsche übersetzt worden ist, genommen werden. In diesem Werk sind zahlreiche Materialien aus Publikationen verschiedener Disziplinen auf über 1200 Seiten zusammengeführt und in einem dezidiert hobbesianischen Sinn interpretiert worden. Die Grundthese besagt, dass unter prähistorischen und vormodernen Bedingungen die Gewaltausübung zwischen menschlichen Verbänden weitaus häufiger und brutaler war als in der Neuzeit und vor allem der Gegenwart, in der durchsetzungsfähige Regierungen die Gewaltimpulse der Menschen kontrollieren und im Wesentlichen im Zaum halten würden. Damit nimmt Pinker im Verhältnis zu einigen der oben genannten Autoren noch eine relativ optimistische Position ein. Der Althistoriker Ian Morris etwa geht davon aus, dass die menschliche Neigung zu organisierter Gewalt in keiner Weise zu bändigen ist, und nutzt seine Geschichte des Krieges[1] für einen Appell an die amerikanische Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger der Vereinigten Staaten zu einer umfassenden technologiegetriebenen Rüstungsoffensive. Die Unterschiede zu Pinker sind allerdings nur graduell: Beide Autoren gehen davon aus, dass Gewalt zwischen menschlichen Gruppen ein evolutionsbiologisches Erbe und festliegendes gattungsgeschichtliches Merkmal ist. Die Vorgeschichte, die durch die Abwesenheit von «Staaten» und damit wirksamer Regulierungsinstanzen charakterisiert ist, war demnach zwangsläufig eine Hochzeit ungebremst ausgelebter Aggression und Gewalttätigkeiten jeglicher Spielart zwischen menschlichen Gruppen oder Verbänden.
Diese auf biologischen Annahmen beruhende Sicht auf die Vergangenheit der Menschheit suchen die genannten Autoren mit empirischen Daten zu stützen. Steven Pinker hat bei der Aufbereitung dieses aus der anthropologischen und historischen Literatur zusammengetragenen Datenmaterials in besonderem Maße Vollständigkeit und Präzision angestrebt.[2] Im Ergebnis präsentiert der Autor eine Liste von prähistorischen archäologischen Fundstätten mit einundzwanzig Einträgen, die zum Teil einzelne Fundorte, zum Teil aber auch Zusammengruppierungen mehrerer Fundorte aus derselben Region verzeichnen (S. 93). Bei den Fundstätten handelt es sich entweder um prähistorische Grablegen oder um die Relikte vorgeschichtlicher Massaker. Statistisch ausgewertet wurden im Besonderen die noch erkennbaren tödlichen Verletzungen, die die an den jeweiligen Fundorten geborgenen menschlichen Skelette aufwiesen. Pinker errechnet aus diesem Material einen Durchschnitt von fünfzehn Prozent gewaltsamer Todesfälle, die die jeweiligen Gemeinschaften zu verzeichnen hatten. Diese aus archäologischen Quellen gewonnenen Zahlen vergleicht er mit Opferzahlen, die in der anthropologischen Literatur für Kriege zwischen heute noch existierenden Jäger-und-Sammler- bzw. Jäger-und-Gärtner-Verbänden aufgeführt sind und die eine ähnliche Größenordnung aufweisen (nach Pinker vierzehn Prozent im Durchschnitt). Die Anzahl dieser «kriegsbedingten Todesfälle» (S. 92) vergleicht der Autor wiederum mit Gefallenenzahlen in modernen Kriegen. Beispielsweise geht er davon aus, dass von den abgerundet etwa sechs Milliarden Menschen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts zu Tode gekommen sind, nur 40 Millionen unmittelbar durch kriegerische Gewalt starben, also nur etwa 0,7 Prozent. Selbst wenn die mittelbar an Kriegsfolgen Gestorbenen (angeblich 180 Millionen) eingerechnet werden, beliefe sich der Anteil immer noch auf lediglich drei Prozent Kriegsopfer im Verhältnis zu allen für das 20. Jahrhundert verzeichneten Todesfällen.
Pinker gründet auf diese Zahlen seine optimistische Geschichtsauffassung. Diese steht im vorliegenden Zusammenhang nicht zur Diskussion, wohl aber seine prähistorische Gefallenenstatistik. Diese hat, wie namentlich der Ethnologe Richard Brian Ferguson in einer Pinkers Liste betitelten Arbeit[3] nachgewiesen hat, erhebliche empirische Mängel. Beispielsweise sind einige Fundstätten versehentlich doppelt aufgeführt, weil sie in der Fachliteratur unter verschiedenen Namen behandelt werden. In einigen von Pinker angeführten prähistorischen Grablegen sind nur sehr wenige oder gar keine tödlich Verletzten nachweisbar, so dass sie als Beleg für «prähistorische Kriege» ausscheiden. Versehen und Ungenauigkeiten pflegen allerdings in der Wissenschaft vorzukommen und sollten nicht überbewertet werden, wenn sie auf das Gesamtergebnis keine gravierenden Auswirkungen haben. Doch solche schwerer wiegenden Ungereimtheiten sind bei Pinker durchaus zu verzeichnen.
Dazu rechnet, dass Pinker seinen Auswertungen durchaus nicht, wie seine einleitenden Bemerkungen suggerieren, eine vollständige oder auch nur eine repräsentative Auswahl des zur Verfügung stehenden Materials zugrunde gelegt hat. Seine Liste von zehn Jäger-und-Gärtner-Völkern, die er im Hinblick auf Gewaltopfer untersucht, umfasst nahezu ausschließlich solche Verbände, deren hohe Gewaltbereitschaft notorisch ist. Eine gewisse Ausnahme stellen lediglich die Gebusi (im heutigen Papua-Neuguinea) dar, die zwar keine Kriege führen, aber aufgrund ihrer mit Gottesurteilen arbeitenden Rechtsfindung eine hohe Zahl von Justizopfern aufweisen. Doch der Liste Pinkers lässt sich beispielsweise die Liste von 73 nichtkriegführenden Volksgruppen (meist Jäger und Sammler oder Gärtner) gegenüberstellen, die Douglas Fry in seinem Buch über das «menschliche Friedenspotential»[4] publiziert hat. Nicht alle der dort aufgeführten Völker leben...