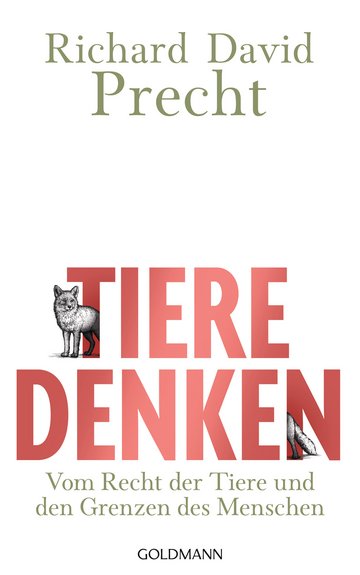Einleitung
Wir haben nicht zwei Herzen – eins für die Tiere und eins für die Menschen.
Alphonse de Lamartine
Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt, und die andere hat darunter zu leiden. Die eine nennt sich selbst »Menschen« und die andere sind eben »nur Tiere«. Die eine besitzt eine Menge großartiger Fähigkeiten: Sie hat eine Sprache, gebraucht Werkzeuge und kann aufrecht durchs Leben schreiten. Die andere kann nur einen Teil davon. Sie ist folglich dümmer, irgendwie mangelhaft und entsprechend rechtlos.
Manche Unterschiede machen einen Unterschied, und manche tun dies nicht. In der gegenwärtigen Moral und Rechtsordnung ist der Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch größer als jener zwischen Schimpanse und Blattlaus. Die Rechte des Menschen regeln die Verfassung und das Bürgerliche Gesetzbuch, der Schimpanse hingegen hat überhaupt keine Rechte. Seine Belange regelt ebenso wie jene des Maulwurfs das Tierschutzgesetz. Maulwürfe und Schimpansen sind keine Rechtssubjekte. Man darf sie in enge Käfige einpferchen, man darf sie mit Elektroschocks foltern, mit tödlichen Keimen infizieren, sie am lebendigen Leib verätzen, sie verstümmeln und vergiften.
Das vernünftige und sittliche Leben und das unvernünftige, rohe Leben teilen die Welt in zwei Herrschaftsbereiche. Einer davon besitzt ein moralisches Siegel. Der andere dagegen ist ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Fast hundertsechzig Jahre ist es her, dass der britische Naturforscher Charles Darwin den gemeinsamen Ursprung, die fließenden Übergänge und zarten Verästelungen allen Lebens bewies. Doch Menschen gelten weder alltagssprachlich noch rechtlich als Tiere. Eine alte Gewohnheit trennt den Menschen von seinen animalischen Verwandten. Es gehört zu den eigentümlichen Folgen der Darwin’schen Wende, dass sie, mit einigen kleineren Korrekturen, das anthropozentrische Weltbild unangetastet ließ. Kaum jemand dürfte sich als jener Trockennasenprimat in der Verwandtschaft von Menschenaffen, Meerkatzen und Pavianen sehen, als den uns die Zoologie klassifiziert. Stattdessen definieren wir uns als Menschen und geben uns alle Mühe, unsere animalische Natur zu vergessen und zu verbergen.
Das Band zu den anderen Tieren haben wir vor langer Zeit zerschnitten. Vor etwa 10 000 Jahren hat der Mensch gelernt, die Rohstoffreserve »Tier« planmäßig zu züchten. Er hält sie von nun an in Form eines lebenden Versorgungsvorrats zum eigenen Nutzen und Frommen. In den Anfängen der Tierzucht legten manche sesshaft gewordenen Jäger gestorbene Hunde in dafür vorgesehene Gruben und bestatteten sogar Mutter, Kind und Rinder gemeinsam. Welten klaffen zwischen dem animistischen Glauben der ersten Viehzüchter und der materialistischen Massentierhaltung der modernen Gesellschaft. Mit dem Ende der Konkurrenz schwand die Notwendigkeit, sich mit dem Tier als einem Lebewesen auseinanderzusetzen. Heute nutzen wir die Ressource »Tier« völlig fraglos für die Ansprüche des Menschen. Das Gemeinsame von Tier und Mensch trat in den Hintergrund. Zwar lebte das Tier noch immer in der kulturellen Fantasie fort, als magische oder fantastische Gestalt, als Freund, Gefährte oder Bedrohung. Doch die Bedeutung in der Alltagswelt ermattete auf Schwundstufen der Natur wie Schoßhund, Zierguppy, Legehenne und Zirkuspferd. Grenzenlos überlegen und unabhängig gegenüber den Tieren seiner Umwelt, entwickelte sich im menschlichen Bewusstsein ein völlig entfremdetes Verhältnis. Nicht nur radikale Ausnutzung und Sadismus, auch falsch verstandene Liebe, Denaturierung und unfreiwillige Quälerei bestimmen seither den menschlichen Umgang mit dem Tier.
Bis ins frühe Mittelalter überwog die Zahl der wilden Tiere die Anzahl der Nutz- und Haustiere, die der Mensch in seinen Dienst gestellt hatte. Doch spätestens mit dem Siegeszug des Kapitalismus in Westeuropa und Nordamerika verschwanden die Reste der Ehrfurcht in die Märchenbücher und Zirkusdarbietungen. Moderne Agrarunternehmen, Industriemetropolen, Autobahnen und Hochspannungsmasten bilden das Ornament unserer Umwelt, die wir seit mehreren hundert Jahren »Landschaft« nennen. Nirgendwo in der Alltagswelt eines Menschen der westlichen Zivilisation begegnet uns das Tier noch als Konkurrent: nicht bei der Ernährung, nicht im Kampf um den Lebensraum und nicht als Fressfeind, dessen Zähne und Klauen ernsthaft Furcht erregen könnten. Das einzig Bedrohliche, das heute bleibt, sind ausgerechnet ein paar kleine Tiere, etwa Ratten und Mäuse, die letzten gefährlichen Fresskonkurrenten des Menschen. Dazu kommen Insekten, Mikroben und Viren.
Das Band zwischen uns und den anderen Tieren wuchs auch nicht dadurch wieder zusammen, dass wir die Tiere über die Wissenschaft als Verwandte wiederentdeckten. Seit mehr als zweitausend Jahren sieht sich der Mensch als legitimer Herrscher über eine beherrschbare Umwelt, dazu geschaffen, sie zu nutzen und auszubeuten. Unsere Evolution hat sich dabei rasant beschleunigt. Längst findet sie kaum noch in unserem Körper statt, sondern vor allem in unserer Technik und Kultur. Und schon lange dient sie nicht mehr dazu, sich der Natur anzupassen. Sie dient einer immer wieder neu geschaffenen menschlichen Kultur. Anpassung bedeutet heute, sich an den eigenen Fortschritt anzupassen mit all den bekannten Folgen für unsere Umwelt. Dramatische Klimawechsel, die Zerstörung der schützenden Ozonschicht, die Versteppung weiter Landstriche auf allen Südkontinenten und die Vergiftung der Meere vernichten nicht nur die nichtmenschliche Tierwelt, sie betreffen mehr und mehr den Menschen selbst.
In atemberaubendem Tempo beschleunigte das industrialisierte 20. Jahrhundert die Beherrschung und Ausbeutung der Natur und mit ihr die der Tiere. Schon in den vergangenen Jahrtausenden hatte Homo sapiens den gesamten Planeten in Besitz genommen. Kein größeres Wirbeltier besitzt ein solches Verbreitungsgebiet, bewohnt Wüsten, Regenwälder und Polarregionen gleichermaßen. Und kein größeres Wirbeltier hat sich zu Milliarden vermehrt. Rücksichtslose Plünderung der Rohstoffe und ein ungeheures Bevölkerungswachstum der Spezies Homo sapiens schaffen einen erdgeschichtlichen Ausnahmezustand.
Der Mensch beherrscht heute den Planeten, aber offensichtlich nicht sich selbst. Es könnte daran liegen, dass es »den Menschen« gar nicht gibt. Stattdessen gibt es mehr als sieben Milliarden unterschiedliche Individuen. Und niemand davon ist für die Menschheit zuständig. Sie ist eine Gemeinde, der anzugehören nicht dazu verpflichtet, sich um das Ganze zu sorgen und zu kümmern.
Zu herrschen bedeutet, Ordnungen zu etablieren und Regeln dafür aufzustellen, was wichtig ist und unwichtig, richtig oder falsch. Jahrhundertelang sah die Moral der abendländischen Zivilisation in der Ausrottung der Wildtiere und Ausbeutung der Nutztiere nahezu kein Problem. Eine klare Grenzziehung erlaubte jeden Umgang mit dem Tier, von der Liebe bis zur Folter, von der Zucht bis zur Tötung. Das Argument war schlicht: Der Mensch ist eine Sonderanfertigung Gottes und mit dem Tier gerade mal durch den losen Faden der göttlichen Schöpfungstat verbunden. So kam, in den Worten des deutsch-französischen Theologen und Arztes Albert Schweitzer, »die Ansicht auf, dass es wertloses Leben gäbe, dessen Schädigung und Vernichtung nichts auf sich habe. Unter wertlosem Leben werden dann, je nach den Umständen, Arten von Insekten oder primitive Völker verstanden.«2 (Eine Klientel, die sich überdies noch um Frauen erweitern ließe.)
Diese Grenze wurde und wird in der abendländischen Kulturgeschichte variantenreich verteidigt. Doch je genauer wir sie betrachten, umso seltsamer erscheint sie uns. Denn sie lässt sich immer schlechter begründen, und zwar sowohl philosophisch als auch biologisch. Seit etwa vierzig Jahren besteht in der Gesellschaft eine Debatte, die unseren Umgang mit Tieren grundsätzlich infrage stellt. Tierethiker wie Peter Singer und sein US-amerikanischer Philosophenkollege Tom Regan fordern Rechte auch für Tiere. Der Ausschluss der Tiere aus der Ethik sei ein moralischer Skandal. Das Tier heute moralisch draußen vor der Tür zu lassen sei das Erbe eines religiösen Aberglaubens. Da der Mensch keine Sonderanfertigung Gottes sei, sondern ein intelligentes Tier, müssten wir die Reichweite der Moral ebenso auf die »anderen Tiere« ausdehnen. Haben wir nicht nach und nach gelernt, die Sklaverei zu ächten und Frauen als gleichberechtigte Menschen zu achten? Und ist es nun nicht an der Zeit, neu über Tiere nachzudenken und sie moralisch angemessen zu beurteilen?
Doch wie könnte ein solcher angemessener Umgang mit den anderen Tieren aussehen? Den Menschen als ein Tier unter anderen anzusehen könnte ja auch bedeuten, ihn abzuwerten, statt die Tiere moralisch ernster zu nehmen. Das Unheil des Sozialdarwinismus und der barbarischen Rassentheorie steht uns mahnend vor Augen. Und was ist überhaupt das Kriterium dafür, Tiere moralisch zu achten? Ist es ihre Leidensfähigkeit, ihr Lebenswille oder ihre Intelligenz? Haben kluge Tiere ein höheres Lebensrecht als dümmere? Das Verhältnis des Menschen zu den anderen Tieren neu zu bewerten ist eine große und schwierige Aufgabe.
Ich möchte in diesem Buch versuchen, diese Fragen neu zu stellen und zu durchdenken. Dabei betrachte ich den Menschen als ein besonderes Tier unter vielen auf andere Weise besonderen Tieren. Ich möchte mich nicht darauf festlegen, den Menschen allgemein über bestimmte Eigenschaften zu definieren, die ihn ethisch...