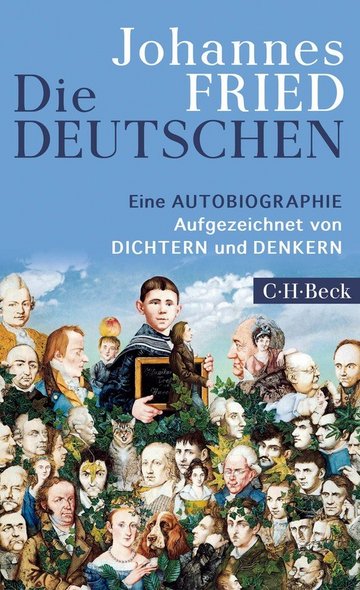1. Deutsch ist völkisch:
Die Implikationen des deutschen Volksnamens
Wer sind wir? Wir, die Deutschen? Woher kommen wir? Seit wann gibt es uns? Mit welchem Selbstverständnis traten wir in die Welt? Wie brachte und bringt es sich zur Geltung? Wie wirkt es nach? Was haben zeitgenössische Dichter und Denker damit zu schaffen? Der Mediävist kann zur Beantwortung derartiger Fragen in langfristiger Perspektive außerliterarische Kontinuitätslinien der Dichtung und Reden aufweisen, die von den Ursprüngen bis zur Gegenwart reichen. Die folgende Betrachtung will – das sei noch einmal betont – keinen deutschen Nationalcharakter aufspüren oder konstruieren, sondern verfolgt deutsche poetische oder philosophische Selbstzeugnisse von den Anfängen bis zur Gegenwart je in ihrer Zeit. Der Historiker ist freilich seinerseits ein Zeitgenosse, den die Fragen und Probleme von heute ebenso bewegen wie andere Zeitgenossen sonst in der Welt. Er ist ein Beobachter einstiger Sachverhalte, der Deutungen wagt und damit Urteile trifft, die nicht jedermann schmecken. Diese Urteile sind gegenwartsbedingt und relativ, sind subjektiv; sie unterliegen den Spannungen aktueller gesellschaftlicher Prozesse.
Die Deutschen sind keine Gabe Gottes, nicht aus seiner Hand entlassen; sie sind nicht von jeher, sind nicht einmal eines der antiken Kulturvölker, sie sind ein vergleichsweise junges Volk, erst aus den Wirren und Turbulenzen nachantiker Geschichte vor nicht allzu langer Zeit hervorgetreten, haben mühselig zu sich selbst gefunden, wenn sie denn je zu sich gefunden haben. Immer wieder traten retardierende Momente der Volksentstehung hervor, immer wieder bedrohten Abspaltungen die Existenz als eines einigen Volkes, immer wieder machten äußere Feinde sich seine schwankende Eintracht zunutze, um die Spaltung zu vertiefen. Beobachtet hat es niemand, erlitten haben es viele. Düstere Schatten fielen von hier auf die Zukunft. Kein Mythos erzählt diese Geschichte, kein Mythenerzähler tat sich hervor; er hätte nichts zu erzählen gehabt. Kein Gründungsheld trat auf. Kein Barde sang eine Gründungssaga, wie aus dem «Völkergewimmel»[1] der vielen, noch heute bekannten Völkerschaften der Friesen, Sachsen, Sorben, Wenden, Thüringer, Franken, Alemannen, Baiern und Karantanen die Deutschen wurden. Vom «Volk der Deutschen» sprach niemand.
Auch Poeten und Philosophen beobachteten keinen Einigungsprozess. Sie traten erst im Nachhinein mit ihren Reflexionen hervor. Gleichwohl sind es Literaten, denen die ersten Spuren der Volksentstehung zu verdanken sind. Dichter meldeten sich dabei, wenn auch nur vereinzelt, eher beiläufig und ohne Emphase, vergleichsweise früh zu Wort; aber Denker spitzten erst spät die Federn, um über die Deutschen nachzusinnen. Einer der ersten, der aus Deutschland stammte, war im 15. Jahrhundert Nikolaus von Kues, zuletzt ein Kardinal der römischen Kirche, ein anderer, der wenigstens das Land lange Zeit und weiträumig bereist und am Kaiserhof gedient hatte, war der Humanist Enea Silvio Piccolomini, zuletzt Papst Pius II.
Die Geschichte dieses Hervortretens ist merkwürdig genug, war planlos, ziellos, voller Widersprüche und Ungereimtheiten. In der Tat kein Stoff für Dichter. Die «deutsche» Geschichte begann prosaisch mit dem Adjektiv «deutsch», das trotz ursprünglich anderer Bedeutung zu einem Namen wurde, und dieser brachte mit der Zeit und über mancherlei Umwege und Widerstände das Volk der «Deutschen» hervor. Der Name war vor dem Volk. Ein holpriger Weg also vom «Wort» zur «Sache», den zudem Fremde ebneten. Über ihn hat kein mittelalterlicher Philosoph reflektiert, wohl aber manch ein Dichter aufschlussreiche Verse hinterlassen. Einzig moderne Philologen und Historiker dröselten den Sachverhalt auf. Dennoch, die Frühgeschichte, die Geschichte nämlich des allmählichen Hervortretens des Namens und des zugehörigen «deutschen Volkes» spiegelt sich allein bei den Literaten. Sie sind es und zumal die Dichter, und zwar nur sie, die uns durch ihre Hinterlassenschaften Einblicke in die ersten Jahrhunderte dieses Prozesses geben. Dichter also an der Wiege der Deutschen, nicht als Ammen, wohl aber als Herolde.
Wir müssen ein wenig in die Wortgeschichte eintauchen, um den Verlauf des Weges zu erkunden und zu deuten und den Beitrag der Dichter zu würdigen. Der heutige Volksname leitet sich von einem erschlossenen germanischen Adjektiv thiutisk, dann dem gesicherten westfränkisch latinisierten theodiscus, resp. dem ostfränkischen thiutiscus, endlich dem althochdeutschen diudisc her[2]. Das alles sind Frühformen des Wortes «deutsch» und sind ihrerseits das Adjektiv zu dem erschlossenen germanischen Nomen theudo und dem gesicherten althochdeutschen dîet, einem untergegangenen Wort mit der Bedeutung «Volk» oder auch «Volksmenge», «Leute». (Man vergleiche die semantisch identischen Namen Dietmar und Volkmar, je «Volksruhm» oder «berühmt im Volk», oder auch Volker und Dieter, je «Volksheer») «Deutsch» bedeutet ursprünglich mithin «zum Volk (zur Volksmenge) gehörig», «völkisch», was hieß: «illiterat», «ungebildet». Diese Bedeutung gefiel den Dichtern nicht und von den Denkern allenfalls Nietzsche.
Die ältesten Zeugnisse für das Wort – beginnend im Jahr 786 mit einem für den Papst bestimmten Bericht über eine angelsächsische Bischofssynode[3] – sind ganz prosaisch. Sie galten in latinisierter Gestalt der «Sprache der Leute», nämlich jener Leute, die nicht wie die Kleriker Latein sprachen, jetzt eben einige Angelsachsen. Die theodisca lingua ist mit Hilfe eines neulateinischen Worts frühzeitig, nämlich im Jahr 788, auch im Umfeld des Frankenkönigs Karls des Großen bezeugt; vielleicht ist der Begriff überhaupt eine Schöpfung fränkischer Sachkenner. Leute, die kein Latein sprachen, fehlten auf dem Festland natürlich nicht. Sie gehörten aber zu diversen, einander fremden, vielfach verfeindeten Völkern (den frühmittelalterlichen gentes), den schon erwähnten Franken, Friesen, Sachsen, Thüringern, Alemannen und Baiern, zu denen einige slawische Völkerschaften traten, um von den Kelten, Romanen, Burgundern oder Goten zu schweigen, die in kleinen Resten ebenfalls an der deutschen Ethnogenese mitwirkten. Die letzten «Welschen» (das sind Romanen) hatten sich in die Alpentäler zurückgezogen, wo sie mancherorts bis heute fortleben, «Ladinisch» sprechen, aber dennoch auf die Formierung der Deutschen einwirkten. Auch in den Winzergebieten des Moseltales überlebten Reste des Lateins und des Keltischen bis zur Gegenwart[4]. Alle diese Völker und Volksgruppen standen erst im Reich der Karolinger unter einem König, an dessen Hof ihre Eliten hervortraten, in dessen Heer ihre Krieger dienten und die sich in ihren, vom gelehrten Latein und untereinander unterschiedenen Volkssprachen verständigen konnten. Tatsächlich begegneten thiudiscus und die analogen lateinischen Wortformen stets auf die Idiome der Nichtlateiner und Nichtromanen bezogen[5]. So grenzte die Sprache ab, ohne schon Völker zu trennen.
In Gebrauch standen diese Sprachen vor allem im Volksgericht, auch im Heer, am Königshof und an weiteren Fürstenhöfen, soweit dort nicht das «Vulgärlatein», die lingua Romana rustica, Anwendung fand, oder man in die klerikale «Hochsprache» des Lateins etwa für eine Niederschrift wechselte. Allein in kirchlichem oder klösterlichem Kontext waren die «Lateiner», die literati, zu Hause, doch sprachen oder verstanden damals auch der König, seine Kinder und einige gebildete Laien Latein. Nichts verwies darauf, dass thiudiscus einmal für die linguistische Grundlage des Namens eines bislang unbekannten, noch gar nicht existenten Volkes herhalten, «volksschöpferisch» wirken würde. Seit dem früheren 9. Jahrhundert sind Spannungen zwischen den romanischen und «theudisken» Sprachgruppen bis hin zu Totschlag bezeugt[6]. Sie ziehen sich durch das gesamte Mittelalter; doch zu Kämpfen zwischen «Völkern» wurden sie erst, nachdem die Sprachen ethnisch gedeutet waren.
Eine gens teudisca erscheint zwar bei dem Dichter Gottschalk um das Jahr 860, darf aber nicht als «deutsches Volk» missverstanden werden. Die Wendung galt vielmehr eindeutig noch immer den «volkssprachlichen Leuten» im Unterschied zu jenen, die Latein sprachen; zu ihnen, den Lateinern, rechnete der Autor, ein Sachse von Geburt, sich selbst[7]. Entsprechendes trifft auf seltene Glossenbelege zu, die etwa apud Thiudiscos, «bei den Volkssprachlern», überliefern. Sie bezeichneten noch immer ein...