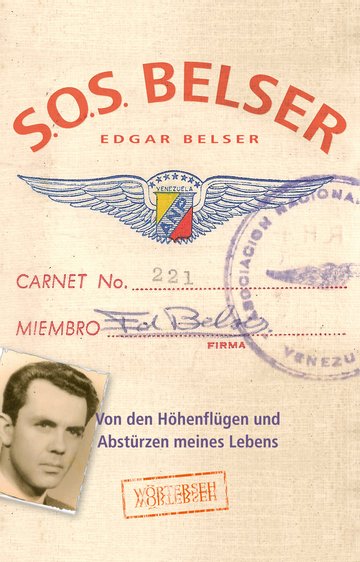Kinderzeit
Dramatische Geburt. Fremd im Tessin. Ministrant in Krisenjahren. Flugzeug-, Auto-, Radiobastler. Bubenstreiche, Lebensweisheiten und ein erster Kuss.
Ein Schrei und danach ein jämmerliches Geheul an diesem 19. Mai 1931 um 13 Uhr 55 im Kantonsspital Aarau. Mir wurden soeben beide Schlüsselbeine gebrochen, damit ich das Licht der Welt, später vielleicht sogar die Sonne sehen könnte. Ich wollte und wollte den warmen Bauch meiner Mutter nicht verlassen. Ein verspätetes Riesenbaby: 5040 Gramm schwer, 55 Zentimeter lang.
Ich war ein Missgeschick und nie wirklich willkommen. Das glaube ich noch heute. Mein Vater war fünfzig Jahre alt bei meiner Geburt und hatte bereits drei Kinder. Seine erste Frau war an der Spanischen Grippe gestorben, die zwischen 1918 und 1920 weltweit mindestens 25 Millionen Todesopfer gefordert hatte, 25 000 in der Schweiz. Kurz danach heiratete Vater meine Mutter. 1921 kam meine Schwester Hanna zur Welt, ich folgte zehn Jahre später. Mutter war bei meiner Geburt vierzig. Ob ich schon im Mutterleib spürte, dass draußen nichts Wünschenswertes auf mich wartete? Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Massenelend. Im Spital, wo ich meine ersten Tage interniert war, gefiel es mir ganz und gar nicht. Was immerhin einen Vorteil hatte: Ich brüllte so laut und ausdauernd, dass meine Mutter mich jeweils problemlos fand. Später klagte sie, mich mit meinem Gewicht nur mit Mühe herumtragen zu können.
Zweieinhalbjährig, bekam ich zu Weihnachten ein grellrotes Feuerwehrauto mit elektrischen Scheinwerfern und einer ausziehbaren Leiter. Zu dieser Zeit bröckelte das Glück meiner Eltern. Der Grund war so alt wie ich: Für die Zeit meiner Geburt hatte Mutter unsere Nachbarin gebeten, bei uns zum Rechten zu sehen. Anscheinend nahm die gut aussehende Witwe ihre Aufgabe etwas zu ernst, was Vater beglückte, Mutter aber betrübte. Ich war vier, als Mutter mit mir zu ihrer Schwester nach Zürich zog und Hanna ins Internat kam.
Das Feuerwehrauto ist meine früheste Erinnerung. Dazu kommen die sonntäglichen Spaziergänge im Park der Schuhfabrik Bally in Schönenwerd, der Aare entlang, zusammen mit meinem Poppeli, einem herzigen Rehpinscher, der, müde vom Laufen, auf dem Heimweg meist zu mir in den Kinderwagen durfte.
Nach der Scheidung ließ sich Mutter in Locarno Monti nieder. Vater besuchte uns regelmäßig. Wären die beiden nicht so starrköpfig gewesen, hätten sie vielleicht wieder zusammengefunden. Vater meinte: »Mutter ist ja weggezogen, will sie zurückkommen, ist sie willkommen.« Mutter sagte: »Zurück gehe ich nicht. Kommt Vater ins Tessin, ist mir das recht.« So blieb Vater im Norden, Mutter im Süden.
Sechs Jahre lang, zwischen acht und vierzehn, ministrierte ich täglich um sechs Uhr früh in der Kirche Madonna del Sasso. Das hatte seine Vorteile. Erstens gaben mir die Kapuziner-Patres nach der Messe eine Tasse Milchkaffee aus gerösteten Eicheln und den Viertel eines Brotes – damit war auch Mama geholfen, denn während des Zweiten Weltkriegs waren die Lebensmittel rationiert, und die Alimente des Vaters reichten nur knapp. Zweitens diente mir der Altardienst als plausible Ausrede, wenn ich verspätet zur Schule kam, ins Istituto Sant’Eugenio, von Schwestern des Klosters Ingenbohl geführt. Drittens bewunderten mich die Kameraden, weil ich Latein sprach – und warens auch nur die Messgebete.
Als Ausländer wahrgenommen zu werden, begleitete mich als Trauma durchs Leben. Es begann schon in der Kindheit. Mit Mama unterhielt ich mich auf Schweizerdeutsch. Meine Tessiner Lehrerinnen sprachen jedoch kein Wort Deutsch. Ich hatte enorme Mühe, etwas zu verstehen und verstanden zu werden. Man nannte mich »Züchin« oder »Tüderli«, gebräuchliche Übernamen für Deutschsprachige. Züchin bedeutete Zucchino, Blödling im übertragenen Sinn. Tüderli steht für das Schweizerdeutsche mit seinen vielen »ü« und »li«. Mutter lebte dreißig Jahre im Tessin, ohne Italienisch zu lernen. Sie verständigte sich auf Französisch, das die Tessiner in der Schule als Zweitsprache lernen – und war in Locarno und Umgebung die »Madam«.
Mit neun Jahren übte ich mich im Rollschuhlaufen, saß allerdings mehr auf dem Hintern. Überdrüssig, mir immer wieder neue Hosen kaufen zu müssen, stattete mich Mama mit einer echten bayerischen Lederhose aus. Vorne zwischen den Hosenträgern schimmerten zwei Edelweißblüten hinter einem Zelluloidfenster. Diese Hose verhöhnten meine Schulkollegen als das Lächerlichste auf Erden. Eines Tages ging das Plastikfenster kaputt, die Alpenblumen waren verloren. Mutter brachte die Hose zum Schuster und wünschte sich statt Edelweiß die Anfangsbuchstaben meines Names in zweifarbigem Leder – B und E. Nun hatten die Kollegen leichtes Spiel: Sobald ich auftauchte, begannen alle wie Schafe zu meckern: »BE BE BE BE BE …« Nach zwei Jahren war die Hose Gott sei Dank zu klein. Doch das Geblöke musste ich noch lange hören.
An meinem Italienisch gab es mittlerweile nichts mehr auszusetzen. Doch meine Ohren boten Gelegenheit zum Spott. Diese, von väterlicher Seite geerbt, konnten sich sehen lassen. Meine Kameraden verglichen sie mit einem Hasen – und nannten mich »Cünili«, eben Hase im Tessiner Dialekt. Dies alles machte mich wahnsinnig wütend. In der Deutschschweiz war ich der italienische, im Tessin der Deutschschweizer Ausländer. Später, in Südamerika, dann der Musiú – von Anfang an und auch nach 45 Jahren noch. Der Begriff kommt vom französischen Monsieur und wird für alle Europäer gebraucht. Die Nordamerikaner sind und bleiben Gringos, die Leute aus arabischen Ländern Turcos, jene aus dem Fernen Osten Chinos. Was vor allem die Japaner als Schimpfwort empfinden.
Ein erniedrigendes Gefühl, als Ausländer, als zweitklassiger Mensch zu gelten, wo immer ich war. Nirgendwo daheim zu sein. Ich reagierte allergisch auf jede Form von Nationalismus, lernte aber schnell, meine Weltbürger-Ideen für mich zu behalten, da die meisten halt doch mehr oder weniger eingefleischte Nationalisten sind. Erzählte ich später während eines Ferienaufenthalts in der Schweiz einem Eidgenossen von meinem Leben in Südamerika, ließ die Frage nicht auf sich warten: »Aber Sie wollen doch sicher für immer zurück in die Schweiz kommen?« Dass ich dies nicht wollte, verstand kaum jemand. Da steht einer und erkennt das Paradies nicht! Ziehen nicht viele Ausländer die Schweiz ihrer Heimat vor? Natürlich bewundere ich mein schönes, perfektes, sicheres, sauberes Heimatland, aber jedes Land hat seine Vor- und Nachteile – und mir gefiel es in Venezuela. Das Klima ist angenehmer, das Land grösser, die Natur unberührter. Der Einzelne lebt freier, was allerdings seinen Preis hat: Gestatten sich nämlich alle Leute mehr Freiheit, kann diese auch ab und zu auf die Nerven gehen.
Zurück ins Tessin. Als nach dem Krieg die ersten Douglas DC-3 in Magadino starteten und auf dem Flug nach Barcelona ganz nah vorüberdonnerten, hatte ich nur einen Wunsch: fliegen. Einmal nur. Schon als Siebenjähriger ließ ich Hunderte von Papierflugzeugen von unserem Balkon in den Rebberg des Nachbarn segeln, bis dieser reklamierte, er möge wohl Trauben, aber keine Flugzeuge zusammenlesen. Ein paar Jahre später baute ich mein erstes Modellflugzeug. Beim Jungfernflug vom Monte Bré Richtung Lago Maggiore kam es vom geplanten Kurs ab. Die Suchaktion mit Schulkameraden blieb erfolglos – und ich stellte die Fabrikation von Flugzeugen ein.
Die Kunst, sich den Verhältnissen anzupassen, bringt Vorteile: Das kapierte ich schon als kleiner Bub. Einmal, ich war acht, spedierte meine Mutter mich in ein Jugendlager nach Fusio, letzter Ort im Val Lavizzara, im Norden des Maggiatals. Aufgewachsen mit Deutschschweizer Küche, war mir das Essen eine Qual. Täglich kam Polenta auf den Tisch, die Tessiner Nationalspeise: Polenta mit Ziegenmilch, Polenta mit Schafmilch. Ab und zu Reis oder Teigwaren. Ich vermisste Kartoffeln, Gemüse, Cervelats, Wienerli. Am scheußlichsten schmeckte die Schafmilch.
Noch schwieriger als das Essen war, mit den Kumpanen auszukommen. Wie gesagt, als Deutschschweizer, also »Ausländer«, war ich nicht sonderlich beliebt. Im Lager bildeten sich schnell ein paar Gruppen. Jede baute am Bachufer Burgen. Ich hielt mich an eine Gruppe gleichaltriger und jüngerer Kinder. Regelmäßig überfielen uns ältere Schüler, zerstörten die Burgen, nahmen uns gefangen, banden uns an Marterpfähle, führten triumphierend Indianertänze auf und bespritzten uns mit Wasser und Sand, denn skalpieren konnten sie ihre Kriegsgefangenen nun doch nicht. Anderntags wiederholte sich das erniedrigende Spiel, die Prügeleien. »Bin ich lieber der Schwanz eines Drachens oder der Kopf einer Maus?« Diese – spanische – Frage lernte ich erst viel später kennen. Damals entschied ich mich intuitiv dafür, Schwanz eines Drachens zu sein, und lief zum Feind über. Ich musste die unbeliebteste Arbeit übernehmen: Wache halten. Aber ich gehörte der...