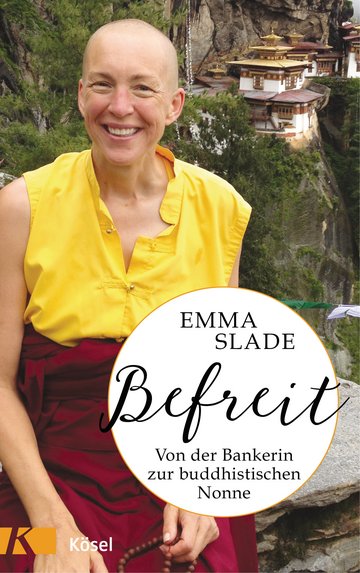Der Hüftschwung
Ich fühlte mich ein kleines bisschen sexy. Beim Gehen fühlte ich einen leichten Hüftschwung – das lag an den Schuhen. Ich trug die schwarzen Riemchenpumps, die ich mit viel Geld und einer Dosis schlechtem Gewissen bezahlt hatte. Ich hatte mich vor der makellos sauberen Schaufensterscheibe dieses Ladens in der Londoner Sloane Street herumgedrückt, hinter der einige wenige ausgesuchte Schuhe auf hohen weißen Sockeln präsentiert wurden. Die Versuchung war einfach zu groß. Ich ging hinein und schlug zu: Meins!
Es war schön, dieses Klick, Klack meiner eleganten Absätze zu hören, während ich die polierten Steinstufen des Grand Hyatt Hotels in Jakarta, Indonesien, hinaufstieg. Ich residierte in einem Fünfsternehotel und kam mir selbst auch ziemlich fünfsternemäßig vor. Kein Supermodel, aber hochgewachsen in einem teuren, perfekt sitzenden Kostüm mit stoffbezogenen Knöpfen. Die Besprechung, von der ich zurückkam, war super gelaufen. Ich war eine Frau in einer Männerwelt und machte meine Sache gut, ziemlich gut sogar. Nicht übel für ein Mädchen, das in einem ruhigen Küstenstädtchen groß geworden war, wo man das Salz im Leitungswasser schmecken konnte und der Geruch von Muscheln in der Luft hing.
In der feuchtwarmen Luft Asiens gab es nichts davon. Die Blätter der Pflanzen waren groß genug, dass sich der nachmittägliche Regen in reglos-stillen Tropfen darauf sammeln konnte. Jetzt, an diesem warmen Nachmittag im September 1997, machte ich Pläne für den Rest dieses Tages. Ich würde auf mein Zimmer gehen, in meinen Badeanzug schlüpfen und dem von unten beleuchteten, wunderschönen Swimmingpool des Hotels einen Besuch abstatten. Ich hatte ihn von oben bereits flüchtig gesehen: die tiefblauen Reflexe des Wassers, umrundet von sich diskret bewegenden Bediensteten, die Tabletts mit nur einem Drink darauf herumtrugen. Danach würde ich etwas sehr Leichtes und sehr Gesundes essen, wie es sich für eine Geschäftsfrau in leitender Position gehörte, und mich anschließend mit Greg und wen er sonst noch mitbrachte treffen. Gut – somit war alles klar. Nun musste der Plan nur noch ausgeführt werden.
Hotelzimmer zu erkunden hat mir immer Spaß gemacht – die weichen Bettdecken und die Batterie von Mini-Kosmetika im Bad. In diesem Hotel hatte ich ein Zimmer im vierten Stock, ein kurzes Stück den vergleichsweise kahlen Korridor hinunter auf der rechten Seite. Zweifellos sahen die Flure auf den anderen Etagen exakt aus wie dieser.
Das Zimmer war groß, größer als meine komplette ehemalige Wohnung in Hongkong. Wohnraum hatte in Hongkong seinen Preis und meine Wohnung im Lan-Kwai-Fong-Viertel war klein, aber in allen Räumen mit Spiegeln ausstaffiert, um sie geräumiger wirken zu lassen. Mit ein paar Gläsern intus konnte das schon mal zum Problem werden. Dieses Hotelzimmer hingegen war komplett anders. Es gab reichlich Platz, dazu sorgfältig im Raum verteilte Objekte, die einem das Gefühl gaben, als wären sie wie die Figuren auf einem Schachbrett mit Bedacht gesetzt worden. Bewegungsfreiheit nach allen Seiten.
Wenn man hineinkam, lag linker Hand die Tür zum Bad. Gleich daneben folgte ein cremefarbener Schrank, dann ein Sitzbereich mit einem antik aussehenden Frisiertischchen samt zugehörigem Standspiegel. Der Eingangstür gegenüber lag ein großes Fenster, dessen Scheibe von dicken grauen Sprossen in Quadrate unterteilt wurde. Vor dem Fenster stand ein großer Schreibtisch mit Ledereinlage, davor ein verschnörkelter Holzstuhl europäischen Stils. Man hätte meinen können, das Zimmer stünde für so hohen Besuch wie Napoleon persönlich bereit. Weiter zur Rechten fand sich das Bett, links und rechts davon blieb nur ein schmaler Durchgang übrig. Das Bett war groß, ja riesig, und gehörte mir allein. Ich konnte mich rückwärts darauf fallen lassen wie ein Lotteriegewinner, der seinen neuen Reichtum genießt.
Ich legte meinen Laptop in seiner schwarzen Reißverschlusstasche neben das Telefon auf den Schreibtisch und nahm meine silberne Halskette und die Uhr mit dem quadratischen Zifferblatt ab. Erst in den frühen Morgenstunden war ich von Hongkong herübergeflogen und hatte einen langen Tag hinter mir. Ich streifte meine Schuhe ab und war gleich ein paar Zentimeter kleiner. Ich spürte, wie meine Füße erleichtert aufseufzten und meine Waden sich entspannten.
Herrlich.
In Strumpfhosen, ohne Blazer und mit gelockerter Bluse ging ich ins Bad. Bedächtig wusch ich mir die Hände mit dem kleinen Stück Seife, das ich eben ausgepackt und an dem ich zuerst geschnuppert hatte. Als ich mich umsah, fand ich nur zwei Handtücher. Ein kleines direkt neben mir und ein zweites, das zusammengefaltet über dem verchromten Handtuchwärmer hing. Nur zwei? Ich sah noch mal unter dem Waschtisch nach, aber ja, es gab tatsächlich nur zwei Handtücher.
Hmm. Etwas schäbig für ein Fünfsternehotel. Würde es am Pool Extra-Handtücher geben, oder erwarteten die hier von mir, dass ich mit dem größeren Handtuch zum Schwimmen ging und mir dann mit dem kleineren im Bad behalf? Hmpf. Schwierig.
Sollte ich vielleicht den Zimmerservice anrufen? Würde ich mich dann nicht wie eine verzogene Göre aufführen, die sich in einem Raum, der so groß ist, dass man darin locker ein Tischtennisturnier veranstalten könnte, über einen »Mangel« an Handtüchern beschwert?
Prüfend betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel. Die Augenbrauen waren sauber gezupft, das Haar im Nacken zur Welle gerollt, und das immer noch strahlende Himbeerrot des Lippenstiftes betonte die Konturen meiner Lippen. Das Badezimmerlicht hatte eine schmeichelhafte Wirkung – ein guter Hintergrund für das Erscheinungsbild der erfolgreichen Geschäftsfrau. Ich verspürte ein leichtes Triumphgefühl. Mein Vater wäre zweifellos stolz auf mich gewesen. Das hier war, was er sich immer für sein ältestes Kind gewünscht hatte. Er wäre stolz auf das Kostüm, die Schuhe und die vielen Geschäftsreisen gewesen. Er hätte seinen Kumpels davon erzählt, sonntagmittags im Pub. Ich sah vor mir, wie er sich an den Tresen lehnte, freundlich und umgänglich in seinen Gummistiefeln, und sich eine Pause vom Kartoffelgraben in seinem Schrebergarten gönnte, wo er gewöhnlich seine Wochenenden verbrachte.
Vor langer Zeit hatte er einmal zu mir gesagt: »Em, weißt du, ich kann mir dich gut als Investmentbankerin vorstellen.« Er goss gerade seinen Garten mit der großen grünen Gießkanne mit dem Kupferkopf, während ich im Gras herumlief und auf meine neuerdings recht großen Füße guckte. In die warme Luft des Nachmittags mischten sich schon herbstliche Düfte und der Boden war trocken und krümelig. Ich muss so um die zehn, elf Jahre alt gewesen sein und hatte nicht die leiseste Ahnung, was ein Investmentbanker war, abgesehen davon, dass es sich nach etwas anhörte, das nur Männer machten. Doch es freute mich, dass es etwas gab, das mein Vater mich »tun« sah. Es fühlte sich gut an, etwas zu haben, das er und ich teilten und worauf wir hofften. Es war nett, dass er sich über meine Zukunft Gedanken machte, während er seine Pflanzen goss.
Schon seltsam, wie einem solche Momente gegenwärtig bleiben und nie ganz als Vergangenheit abgelegt werden.
»Das ist meine Tochter«, hörte ich ihn stolz sagen.
Während meine Gedanken so umherwanderten, schlüpfte ich in meinen einteiligen, türkisfarbigen Badeanzug. Die Farbe passte perfekt zu meiner englisch-blassen Haut und dem dunkelblonden Haar.
Innerlich immer noch beschäftigt mit Handtuchfragen und meinen Vater-Tochter-Geschichten, hörte ich, wie es an der Tür klopfte. Ich zog mir den weißen Hotelbademantel über und ging, ohne groß nachzudenken, um aufzumachen. Irgendwie erwartete ich wohl das Zimmermädchen mit ein paar Handtüchern, den Reinigungsdienst oder ein Begrüßungsgeschenk.
Stattdessen sah ich geradewegs in den Lauf einer Pistole.
Hartes Metall rammte sich in die weiche Mitte meiner Brust. Ich stolperte rückwärts ins Zimmer, meine Beine knickten unter mir ein wie bei einem Pferd, das eingeschläfert wird.
Was ist hier los?
Der Mann mit der Pistole packte mich von hinten, hielt mir den Mund zu und drückte mich auf den Teppich. Ich versuchte, mich zusammenzukauern, meinen Körper ganz klein zu machen, wobei ich instinktiv meinen Kopf mit meinen Händen schützte. Ich schrumpfte förmlich in mich zusammen. Der Mann mit der Pistole stand über mir.
In einem Zimmer auf der vierten Etage eines Fünfsternehotels begann ich, um mein Leben zu betteln. Die Worte kamen ganz automatisch, verzweifelt.
»Oh Gott, bitte bringen Sie mich nicht um!« Die Worte klebten mir zwischen den Zähnen, mein ganzer Körper war kalt. Alles ging so rasend schnell. Ich wusste, dass er mir jederzeit etwas antun konnte. Von oben, von der Seite, gegen den Kopf, in den Bauch – er konnte mir jederzeit einen Schlag oder Tritt versetzen, ohne dass ich mich hätte wehren können. Alles, was mir blieb, waren Worte.
»Bitte, bringen Sie mich nicht um.« Bitte, bitte. »Jesus. Gott. Bitte.« Ich erwartete einen Knall, ein Loch, einen dumpfen Aufschlag.
Ich hatte niemals »Jesus« und nur selten »Gott« gesagt. Warum also jetzt? Ich wusste einfach keinen anderen Namen, den ich um Hilfe flehend hätte anrufen können. Hätte ich den Namen meines Angreifers gekannt, hätte ich vielleicht diesen gesagt.
Werde ich sterben?
Ich trug einen Bademantel und drunter einen Badeanzug. Ich war Engländerin. Eine Frau. Ich hatte einen guten Job. Ich hatte Erfolg. Ich hatte all das. Ich konnte es einfach nicht...