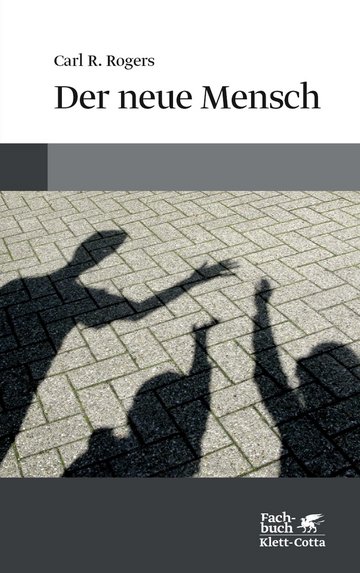2 Alt werden oder: älter werden und wachsen
Das folgende Kapitel ist eine autobiographische Skizze über einen jüngst zu Ende gegangenen Lebensabschnitt, das Jahrzehnt zwischen meinem fünfundsechzigsten und fünfundsiebzigsten Lebensjahr. Da ich inzwischen achtundsiebzig bin, habe ich eine Ergänzung hinzugefügt, die sich an diesen Bericht anschließt.
Dieser Aufsatz hat mehrere Stadien durchlaufen. Eine Fassung präsentierte ich 1977 auf einem großen Workshop in Brasilien. Eine revidierte Fassung trug ich später vor einem kleineren Kreis in San Diego vor. Im Juli 1977 fand in La Jolla eine Veranstaltung mit dem Titel »Leben heute: ein Seminar über Lebensstadien« statt, bei der ich den Essay in der nachstehenden Fassung vortrug.
Ich war eingeladen worden, über die späteren Lebensjahre zu sprechen. Es wurde mir jedoch bewußt, daß ich über das Altern generell nur ungenügend informiert bin, und daß der einzige ältere Mensch, den ich wirklich kenne, ich selbst bin. Deshalb habe ich über diesen Menschen gesprochen.
Wie ist das, wenn man fünfundsiebzig Jahre alt ist? Es ist nicht dasselbe, wie wenn man fünfundfünfzig oder fünfunddreißig ist, und dennoch sind die Unterschiede für mich nicht so groß, wie Sie sich vielleicht vorstellen. Ich bin nicht sicher, ob meine Geschichte für andere nützlich oder bedeutsam sein wird, weil ich so ganz besonders vom Glück begünstigt gewesen bin. Ich tue es deshalb in erster Linie für mich selbst, wenn ich einige meiner Wahrnehmungen und Reaktionen festhalte. Ich habe beschlossen, mich auf das Jahrzehnt zwischen fünfundsechzig und fünfundsiebzig zu beschränken, da mit fünfundsechzig für viele Menschen das produktive Leben endet und der »Ruhestand« beginnt, was auch immer das bedeuten mag!
Die körperliche Seite
In körperlicher Hinsicht verspüre ich ein Nachlassen der Kräfte. Ich merke das auf vielfältige Weise. Vor zehn Jahren hatte ich großen Spaß daran, ein Frisbee zu werfen. Jetzt ist die Arthritis in meiner rechten Schulter so schmerzhaft geworden, daß ein solches Spiel nicht mehr in Frage kommt. In meinem Garten sind mir Arbeiten, die mir vor fünf Jahren noch leicht fielen, aber im vorigen Jahr bereits Mühe machten, jetzt schon zuviel, und es ist gescheiter, sie dem Gärtner zu überlassen, der einmal in der Woche kommt. Dieser allmähliche Abbau, verbunden mit verschiedenen kleineren Störungen des Sehvermögens, der Herztätigkeit und ähnlichem, bringt mir zu Bewußtsein, daß der körperliche Anteil dessen, was ich als »Ich« bezeichne, nicht ewig dauern wird.
Andererseits macht es mir immer noch Spaß, fünf Kilometer am Strand entlang zu wandern. Ich kann schwere Dinge heben und das ganze Einkaufen, Kochen und Geschirrspülen besorgen, wenn meine Frau krank ist, ich kann selbst meine Koffer tragen, ohne zu schnaufen. Der weibliche Körper erscheint mir immer noch als eine der anmutigsten Schöpfungen des Universums und entzückt mich immer wieder aufs neue. Meine Interessen in sexueller Hinsicht sind dieselben wie mit fünfunddreißig, auch wenn ich dies von meiner Potenz nicht sagen kann. Ich bin unerhört froh, daß ich sexuell noch lebendig bin, obwohl ich die Bemerkung des Obersten Bundesrichters Oliver Wendell Holmes nachfühlen kann, der im Alter von achtzig Jahren beim Verlassen eines Varietés seufzte: »Ach, einmal noch siebzig sein!« Ja, oder fünfundsechzig, oder sechzig!
Es ist mir also durchaus bewußt, daß ich zweifellos alt bin. Doch innerlich bin ich in vieler Hinsicht immer noch derselbe Mensch, weder alt noch jung. Von diesem Menschen möchte ich sprechen.
Aktivitäten
Neue Unternehmungen
In den letzten zehn Jahren habe ich mich auf viele neue Unternehmungen eingelassen, die nicht nur psychische, sondern auch physische Risiken enthielten. Zu meiner eigenen Verwunderung wurde mein Engagement in den meisten Fällen durch Anregungen oder Bemerkungen anderer Leute ausgelöst. Daran habe ich erkannt, daß in mir häufig eine Bereitschaft für dieses oder jenes vorhanden sein muß, deren ich mir nicht bewußt bin und die erst dann aktiviert wird, wenn jemand den richtigen Knopf drückt. Lassen Sie mich das verdeutlichen.
Mein Kollege Bill Coulson und einige andere sagten 1968 zu mir: »Unsere Gruppe sollte eine neue, eigenständige Organisation ins Leben rufen.« Diese Anregung führte zur Gründung des »Center for the Study of the Person« – der ausgeflipptesten, unwahrscheinlichsten und einflußreichsten Antiorganisation, die man sich vorstellen kann. Sobald der Gedanke dieses Zentrums geboren war, beteiligte ich mich sehr aktiv an der Gruppe, die es ins Leben rief, und ließ ihm – wie uns allen – in den ersten schwierigen Jahren meine besondere Fürsorge angedeihen.
Eine Nichte von mir, die Grundschullehrerin Ruth Cornell, fragte mich: »Warum haben wir auf unserer Leseliste für Pädagogik kein Buch von dir?« Dies regte mich zu den Gedanken an, die ich später in meinem Buch Lernen in Freiheit niederlegte.
Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, die statusbewußte Ärzteschaft beeinflussen zu wollen, wenn mir meine Kollegin Orienne Strode nicht von ihrem Wunschtraum vorgeschwärmt hätte, durch intensive Gruppenerfahrungen eine humanisierende Wirkung auf die Mediziner auszuüben. Skeptisch, aber auch voll Hoffnung mobilisierte ich Energie, um das Programm starten zu helfen. Das Risiko zu scheitern war groß. Inzwischen übt das Programm einen großen Einfluß aus. Neunhundert Hochschulprofessoren für Medizin und deren Ehefrauen haben bereits an den Encounter-Gruppen teilgenommen, aber auch zahlreiche in Ausbildung befindliche junge Ärzte, die den Werdegang des Mediziners noch aus der »Froschperspektive« sehen. Es ist eine aufregende und fruchtbare Entwicklung, die ich jetzt nur noch in geringfügigem Maße zu unterstützen brauche.
In diesem Sommer hielten wir unseren fünften zweiwöchigen Intensiv-Workshop über den personenzentrierten Ansatz ab. Auf diesen Workshops habe ich mehr als aus allen anderen Unternehmungen der letzten zehn Jahre gelernt. Ich habe neue Weisen, ich selbst zu sein, gelernt und in die Praxis umgesetzt. Ich habe kognitive und intuitive Erkenntnisse über den Gruppenprozeß und über Gruppeninitiativen zur Bildung einer Gemeinschaft gewonnen. Dies sind unerhörte Erfahrungen gewesen, geteilt von einer Gruppe starker Mitarbeiter, die inzwischen zu einer engen Familie zusammengewachsen ist. Wir sind bei unserer Erprobung neuer Formen des Umgangs mit Gruppen schließlich immer größere Risiken eingegangen. – Und wie wurde ich in dieses aufwendige und zeitraubende Unternehmen hineingezogen? Vor vier Jahren sagte meine Tochter Nathalie zu mir: »Warum machen wir keinen Workshop zusammen, vielleicht mit einem personenzentrierten Ansatz?« Keiner von uns beiden hätte sich träumen lassen, was sich alles aus diesem Gespräch entwickeln würde.
Mein Buch Die Kraft des Guten (1978) verdankt seine Konzeption ebenfalls einem Gespräch. Alan Nelson, damals Doktorand, stellte meine Äußerung in Frage, daß es in der klientenzentrierten Therapie keine »Politik« gebe. Dies war ein Denkanstoß in eine Richtung, für die ich schon bereit gewesen sein muß, denn Teile dieses Buches schrieben sich sozusagen ganz von selbst.
Tollkühn oder weise?
Das jüngste und vielleicht riskanteste Unternehmen war die Reise nach Brasilien, die ich mit vier anderen Mitgliedern des Center for Studies of the Person unternahm. In diesem Fall waren es die organisatorische Leistung, die Vision und die Überzeugungskraft von Eduardo Bandeira, die mich zur Zustimmung bewogen. Manche Leute meinten, die Reise werde für mich in meinem Alter zu lang und anstrengend sein, und ich hegte selbst einige Bedenken dieser Art in bezug auf den fünfzehnstündigen Flug und dergleichen. Andere wiederum hielten es für überheblich zu glauben, daß unsere Bemühungen ein so riesiges Land in irgendeiner Weise beeinflussen könnten. Aber die Gelegenheit, brasilianische Gruppenleiter, von denen die meisten schon an unseren Workshops in den Vereinigten Staaten teilgenommen hatten, auszubilden, damit sie selbst Intensivkurse abhalten konnten, war sehr verlockend.
Und dann winkte noch ein anderes Angebot. Wir sollten in drei der größten Städte Brasiliens mit jeweils sechs- bis achthundert Menschen zusammentreffen. Es handelte sich dabei um zweitägige Workshops, bei denen wir insgesamt etwa zwölf Stunden mit den Leuten zusammen sein sollten. Vor unserer Abreise aus den Vereinigten Staaten kamen wir überein, daß wir uns angesichts einer so großen Teilnehmerzahl und einer so kurzen Kursdauer darauf beschränken müßten, Referate zu halten. Doch als der Augenblick näherrückte, empfanden wir immer deutlicher, daß es unseren Prinzipien widersprach, über den personenzentrierten Ansatz zu sprechen, ohne die Teilnehmer über die Leitung und den Verlauf von Sitzungen mitbestimmen zu lassen und ihnen die Chance zu geben, sich selbst zu äußern und ihre eigene Macht zu erleben.
Wir ließen uns also auf einige höchst riskante Unternehmungen ein. Neben sehr knappen Referaten versuchten wir es mit ungeleiteten kleinen Gruppen, Spezialinteressengruppen, einer Encounter-Gruppe zu Demonstrationszwecken und Dialogen zwischen meinen Mitarbeitern und den Tagungsteilnehmern. Aber das gewagteste Unternehmen war, mit den achthundert Anwesenden einen großen Kreis zu bilden (in Zehner- und Zwölferreihen) und sie ihre Gefühle und Einstellungen äußern zu lassen. Wer sprechen wollte, bekam ein Mikrophon in die Hand. Die Tagungsteilnehmer und meine Mitarbeiter begegneten sich auf der Basis der Gleichberechtigung. Kein einzelner...