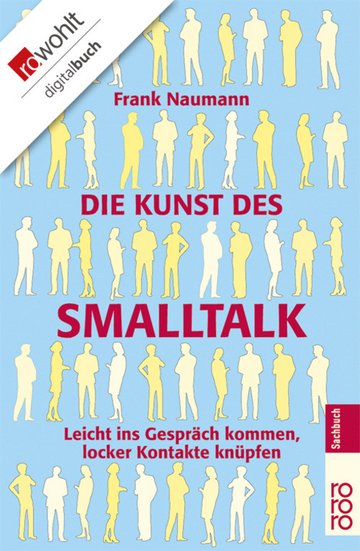Keine Angst vor der Öffentlichkeit!
«Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich selbst macht.»
Dieser Satz stammt nicht etwa von einem amerikanischen Präsidentenberater oder einem Hollywoodstar, der durch gekonnte Selbstinszenierung immer wieder Schlagzeilen in der Presse bekommt, sondern von dem schon zitierten Freiherrn von Knigge, geschrieben im Jahre 1788.
Mehr Schein als Sein? In seiner Anwendung beweisen Karrieristen und Hochstapler, dass das dauernde Reden über die eigene Tüchtigkeit einem oft erspart, seine Leistungsfähigkeit praktisch unter Beweis zu stellen. Auch Ende des 20. Jahrhunderts war es möglich, dass ein psychisch Kranker es schaffte, zum wiederholten Mal als Arzt in einer Klinik zu praktizieren – ohne Zeugnisse oder irgendeine Art von medizinischer Ausbildung. Sein selbstbewusstes Auftreten im weißen Kittel reichte, die Leute in seiner Umgebung von sich zu überzeugen.
Die Werbeindustrie hat aus dem Satz längst gelernt, dass auch die unwahrscheinlichste Behauptung über das zu verkaufende Produkt schließlich akzeptiert wird, wenn man sie nur oft genug wiederholt.
Ein bekannter Bauunternehmer folgte Knigges Devise und erhielt von Fachleuten der Großbanken, die geschult sind, Betrüger zu entlarven, Milliardenkredite – und hinterließ einen Berg von Schulden, den einer der Bankmanager, um sein Versagen zu bagatellisieren, als «Peanuts» bezeichnete.
Selbst Wissenschaftler wissen inzwischen: Man erwirbt sich einen Ruf als Experte am leichtesten dadurch, dass man seine Meinung im Brustton der Überzeugung häufig im Fernsehen und auf Vorträgen verkündet. Für fleißige Genies, die von früh bis abends nur forschen und ihre Laboratorien kaum verlassen, interessiert sich außer ein paar Fachkollegen niemand.
Und wenn auf einer Party zehn Leute beieinander stehen, wird man sich an die ein oder zwei erinnern, die durch amüsantes Plaudern auf sich aufmerksam machten, während die stummen Zuschauer in der Erinnerung keine Spur hinterlassen.
Zum Glück lassen wir uns nicht schrankenlos manipulieren. Wer uns eine Rolle vorspielt, die nicht seiner wahren Persönlichkeit entspricht, wird früher oder später durchschaut. Nur in den Medien kann ein falsches Image über längere Zeit geschickt inszeniert werden. Im persönlichen Umgang lässt sich ein Schein ohne Sein nicht lange aufrechterhalten. Dazu müssten wir unsere Mimik und Gestik einer perfekten Selbstkontrolle unterwerfen. Das ist nicht nur sehr anstrengend, sondern auch beim besten Willen praktisch nicht lückenlos durchführbar. Einige Bereiche der Körpersprache steuert das Unterbewusstsein. Das heißt, die Mimik reagiert auf unsere augenblickliche Stimmung. Der Versuch, willentlich Zorn oder Freude auf das Gesicht zu zaubern, spiegelt äußerlich genau das wider, was er ist – ein kläglich gescheiterter Versuch, eine Laune vorzutäuschen, die nicht da ist. Versuchen Sie einmal zu lächeln, wenn Ihnen nicht nach Lächeln zumute ist, und schauen Sie sich das Ergebnis im Spiegel an.
Ein schüchternes Mädchen mit einem eher stillen, nach innen gekehrten Charakter wäre also schlecht beraten, wenn sie versuchen wollte, auf der Geburtstagsparty ihrer besten Freundin einen großen Auftritt als Femme fatale zu inszenieren. Mit den Schwindlern, Prahlern und Abenteurern dieser Welt in Wettbewerb zu treten wäre der falsche Weg.
Wohl aber sollten wir lernen, uns von unserer vorteilhaftesten Seite zu zeigen. Wir hören viel davon, dass es auf die inneren Werte der Menschen ankommt – weniger darüber, wie Sie diese inneren Werte äußerlich sichtbar machen können. Mag sein, dass Sie feinsinnig, klug, nachdenklich, einfühlsam, freundlich, tolerant, zuverlässig, treu und pflichtbewusst sind – solange Sie stumm und unauffällig mit einem Glas Wein aus einer Ecke das Treiben beobachten, wird niemand auf die Idee kommen, dass Sie diese Qualitäten besitzen, und Sie deswegen kennen lernen wollen.
Theoretisch mag das alles klar sein. Kaum jemand geht zu einer Betriebs- oder Geburtstagsfeier ohne den Vorsatz, sich prächtig zu unterhalten. In der Praxis scheitern zwischen zehn und fünfzig Prozent der Gäste – je nachdem, wie förmlich die Veranstaltung ist – bereits vor dem ersten Satz, der eine Bekanntschaft einleiten könnte. Wie erleichtert ist man, wenn man wenigstens ein bekanntes Gesicht entdeckt! Das möglichst einer Person gehört, die auch niemanden zum Reden gefunden hat. Die Leidensgefährten suchen sich eine stille Ecke und tauschen spitze Bemerkungen über die unerreichbaren Gäste aus oder schwelgen in Erinnerungen an bessere Zeiten.
Kontakthemmnis Schüchternheit. Nach einer Untersuchung des amerikanischen Psychologen Philip G. Zimbardo, die mehrere Länder einbezog, halten sich etwa vierzig Prozent der Menschen für schüchtern. Zehn Prozent fehlt es ständig und in jeder Situation an Mut im Umgang mit anderen. Die übrigen dreißig Prozent fühlen sich in bestimmten Situationen gehemmt. Dazu gehören insbesondere ungewohnte Umgebungen und fremde Menschen. Weitere vierzig Prozent haben oder hatten zumindest gelegentlich Probleme beim Zusammensein mit anderen. Nur knapp zwanzig Prozent aller Befragten sagten, Schüchternheit stelle für sie nie ein Problem dar.
Daraus können wir zweierlei lernen:
Schüchternheit ist ein Massenphänomen. Wer zugibt, schüchtern zu sein und sich deswegen nicht traut, von sich aus ein Gespräch zu suchen, kann mit Verständnis rechnen. Die meisten wissen aus eigener Erfahrung, wie sich Befangenheit anfühlt.
Wer im Laufe eines Abends versucht, mit wenigstens drei Leuten Bekanntschaft zu schließen, trifft nach statistischer Wahrscheinlichkeit auf mindestens eine Person, der ebenfalls etwas mulmig zumute ist und die sich deshalb freut, dass man ihr die «Kontaktarbeit» abgenommen hat.
Aber wenn mich das fremde Gegenüber abschätzig von oben bis unten mustert und mich mit einer geringschätzigen Bemerkung abblitzen lässt? Der Trost, dass die Unhöflichkeit dann auf der Seite des anderen lag, hilft nicht viel. Peinlich bleibt es trotzdem. Wenn es doch einen sicheren Gesprächsanfang gäbe, der eine negative Reaktion ausschließt!
Keine Sorge, es gibt ihn.
«Hallo, ich bin …»
Für die Autoren der Knigges von heute ist es klar: Guten Tag sagen ist höflich, stumm vorbeischauen eine Flegelei. «Grüßen ist eine freundliche Geste, die nichts kostet und jeden freut», schreibt Benimmexpertin Gisela Tautz-Wiessner. «Freundliche Menschen werden als sympathischer empfunden als distanzierte – grüßen Sie schon deswegen lieber zehnmal zu viel als einmal zu wenig.» Sie begründet ihre Empfehlung: «Nichtgrüßen kommt dem willkürlichen Negieren der Existenz des anderen gleich. Er wird quasi für tot erklärt. ‹Ich grüße ihn nicht mehr› bedeutet auch: ‹Er ist Luft für mich›, ‹Ich rede nicht mehr mit ihm.› – In unserer Gesellschaft gibt es kaum eine größere Kränkung.»
Tatsächlich? Wie viel Prozent der Menschen, denen wir täglich begegnen, grüßen wir? Ist es nicht selbstverständlich, dass man Fremde ignoriert? Wenn Sie den australischen Film «Crocodile Dundee» gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht an die Szene, in welcher der Held nach Amerika kam und erstmals durch die Straßen von New York ging. Im australischen Busch, wo er nur alle paar Tage einer anderen Menschenseele begegnete, tauschte er mit jedem, den er traf, ein paar freundliche Worte aus. Diese Sitte versuchte er auf die anonymen Millionenmetropole zu übertragen und grüßte am laufenden Band die Passanten, die links und rechts zu Hunderten an ihm vorbeiströmten.
Grüßen bei begrenzter Personenzahl. Auf einem Dorf mögen sich noch alle Bewohner grüßen, in der Stadt ignoriert man die, die man nicht kennt – schon weil man sonst vor lauter Guten-Tag-Sagen nicht mehr Atem schöpfen könnte. Bewegen wir uns aber unter einer begrenzten Teilnehmerzahl – auf einer Party, einem Weiterbildungsseminar, einer Ausstellungseröffnung –, ist ein freundliches «Hallo» die unabdingbare Voraussetzung dafür, sich nicht von vornherein an den Rand katapultieren. Die Faustregel lautet: In einem Kreis von Gruppengröße (bis höchstens zwanzig Teilnehmer) grüßen wir alle Anwesenden. Sind es mehr, dürfen wir eine Auswahl treffen. Aber auch dann haben wir für jeden Vorbeigehenden, dessen Blicke wir kreuzen, wenigstens ein freundliches Nicken übrig.
Wer auf Etikette Wert legt, wird einwenden, dass gesittete Leute immer in der Höflichkeitshierarchie nach oben grüßen, also Männer die Frauen, Jüngere die Älteren, Mitarbeiter die Vorgesetzten. Aber wollen Sie es als Frau wirklich darauf ankommen lassen, ob der toll aussehende Mann, der neben dem Büffet mit zwei Bekannten fachsimpelt, gerade in dem Moment den Blick schweifen lässt und Ihnen zunickt, in dem Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit zuwenden? Die Etikette sagt nämlich auch: Wer einen Raum betritt – also gerade zur Party eintrifft, aber auch in ein Sprechzimmer oder ein Geschäft kommt –, grüßt als Erste(r). Und: Selbstbewusste grüßen zuerst. Denn was bedeuten kleinkarierte Regelwerke neben dem Bedürfnis, einer konkreten Person ein Zeichen der Sympathie zu übermitteln?
Die gegrüßte Person tut in jedem Fall gut daran, freundlich zurückzugrüßen, auch wenn sie sich beim besten Willen nicht erinnern kann, dem andern früher...