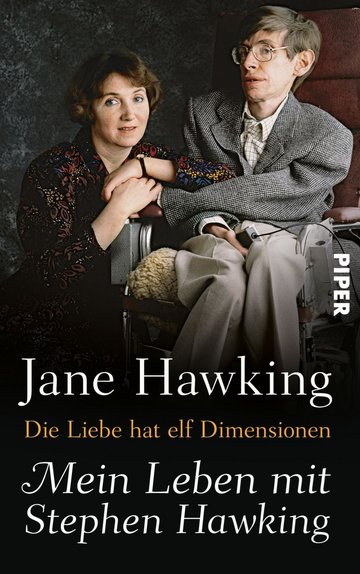Leseprobe Erster Teil 1 Flügel zum Abheben Die Geschichte meines Lebens mit Stephen Hawking begann im Sommer 1962, aber möglicherweise hatte sie auch schon zehn Jahre früher begonnen, ohne dass ich etwas davon mitbekommen hatte. Als ich Anfang der Fünfzigerjahre als siebenjährige Erstklässlerin an die St Albans High School für Mädchen kam, gab es dort für kurze Zeit einen Jungen mit strubbeligem goldbraunem Haar, der im angrenzenden Klassenzimmer gewöhnlich an der Wand saß. Die Schule nahm nämlich auch Jungen auf, meinen Bruder Christopher beispielsweise, aber den Schüler mit dem strubbeligen Haarschopf sah ich nur, wenn unser Lehrer fehlte und wir Erstklässler uns mit den älteren Kindern in einen Raum quetschen mussten. Damals haben wir nie miteinander gesprochen, aber ich bin sicher, dass diese frühe Erinnerung mich nicht trügt, denn Stephen hat dort zu jener Zeit tatsächlich ein Halbjahr verbracht, ehe er an eine private Grundschule wechselte. An Stephens Schwestern kann ich mich besser erinnern. Mary, die ältere von beiden, war nur 18 Monate jünger als Stephen und eine unverkennbar exzentrische Gestalt: sie war pummelig, stets zerzaust, geistesabwesend und von einzelgängerischem Naturell. Ihr großer Trumpf, ein hell schimmernder Teint, wurde durch eine unvorteilhafte Brille mit dicken Gläsern verdeckt. Philippa, fünf Jahre jünger als Stephen, hatte helle Augen, kurze Zöpfe und ein rundes rosafarbenes Gesicht; sie war nervös und leicht erregbar. Die Schule verlangte strenge Konformität sowohl in punkto Lehrstoff als auch, was die Disziplin anging, und die Schüler konnten auf grausame Weise intolerant gegenüber Außenseitern sein. Es war toll, einen Rolls-Royce und ein Landhaus zu haben, aber wenn jemand wie ich mit einem Standard 10 aus Vorkriegszeiten in die Schule gefahren wurde, war er eine Witzfigur oder jedenfalls der Gegenstand herablassenden Mitleids. Die Hawkings hatten es noch schlimmer erwischt: Sie wurden in einem ausrangierten Londoner Taxi zum Unterricht gebracht und legten sich im Auto auf den Boden, um von ihren Mitschülern nicht gesehen zu werden. (Unser Standard 10 hatte unten leider nicht genug Raum für solche Versteckspiele.) Beide Hawking-Schwestern verließen die Schule, ehe sie in die Oberstufe kamen. Ihre Mutter war eine kleine, drahtige Person im Pelzmantel, die oft neben der Schule am Zebrastreifen stand und auf ihren jüngsten Sohn Edward wartete, der mit dem Bus aus seiner privaten Grundschule auf dem Lande kam. Auch mein Bruder besuchte nun diese Schule, die Aylesford House hieß und in der die Jungen Rosa trugen - rosa Blazer und rosa Mützen. In jeder anderen Hinsicht war sie ein Paradies für kleine Jungen, besonders für solche, die keine gelehrten Absichten hegten. Der bezaubernde und sehr gut aussehende Edward war acht, als ich die Hawkings kennenlernte, und hatte mit seiner Adoptivfamilie gerade einige Schwierigkeiten - womöglich weil man dort die Gewohnheit pflegte, den Lesestoff mit an den Abendbrottisch zu bringen und jeden zu ignorieren, der kein Bücherwurm war. Eine meiner Schulfreundinnen, Diana King, hatte diese spezielle Hawking'sche Sitte selbst miterlebt. Vielleicht lag es daran, dass sie Jahre später, als ich ihr von meiner Verlobung mit Stephen erzählte, ausrief: »Oh, Diana, da heiratest du ja in eine total bekloppte Familie ein!« Diana war es auch, die mich in jenem Sommer 1962 zum ersten Mal auf Stephen aufmerksam machte. Nach den Prüfungen genoss ich gemeinsam mit ihr und meiner besten Freundin Gillian die herrlich entspannte Zeit bis zum Ende des Schuljahrs. Diana und Gillian sollten in jenem Sommer von der Schule abgehen, während ich im Herbstsemester noch als Schulsprecherin fungieren würde und mich dann um einen Studienplatz bewerben wollte. An jenem Freitagnachmittag schnappten wir uns unsere Taschen, rückten die Strohhüte zurecht und steuerten das Stadtzentrum an, um dort den Fünfuhrtee zu trinken. Wir waren noch keine 100 Meter gegangen, als sich uns auf der anderen Straßenseite ein seltsamer Anblick bot: Ein junger Mann hoppelte mit gesenktem Blick in die Gegenrichtung. Eine widerspenstige braune Haarmasse schirmte sein Gesicht vor der Welt ab. Ganz in Gedanken versunken, blickte er weder nach rechts noch nach links und bekam von uns überhaupt nichts mit. Für das sittenstrenge und verschlafene St Albans war er eine exzentrische Erscheinung. Gillian und ich starrten ihm vor lauter Verblüffung ziemlich unverfroren hinterher, aber Diana blieb cool. »Das ist Stephen Hawking. Ich bin schon mit ihm ausgegangen«, verkündete sie ihren sprachlosen Freundinnen. »Nein!«, riefen wir und lachten ungläubig. »Mach keine Witze!« »Doch, wirklich. Er ist merkwürdig, aber sehr clever. Mein Bruder ist mit ihm befreundet. Stephen hat mich mal ins Theater mitgenommen, und bei ihm zu Hause war ich auch schon. Er geht zu den Anti-Atomkriegs-Märschen.« Mit einem leichten Stirnrunzeln setzten wir unseren Weg fort, aber ich konnte den Ausflug nicht richtig genießen, fühlte ich mich doch irgendwie unbehaglich wegen des jungen Mannes, den wir gerade gesehen hatten. Vielleicht lag gerade in seiner Exzentrik etwas, das mich gefangen nahm. Vielleicht hatte ich auch die seltsame Vorahnung, dass ich ihn wiedersehen würde. Was immer es gewesen sein mag - diese Szene grub sich tief in mein Gedächtnis ein. Die Ferien in jenem Sommer waren ein Traum für einen Teenager an der Schwelle der Unabhängigkeit, aber für meine Eltern mögen sie ein Albtraum gewesen sein, denn ich fuhr zu einem Sommerkurs nach Spanien, und 1962 war dieses Land derart abgeschieden und mit Wagnissen befrachtet, dass es für junge Leute ein so exotisches Reiseziel war wie heutzutage vielleicht Nepal. Mit all der Selbstsicherheit meiner 18 Jahre zweifelte ich nicht daran, dass ich auf mich selbst aufpassen konnte, und ich hatte mich nicht getäuscht. Der Sprachkurs war gut organisiert, und wir Teilnehmer wurden in kleinen Gruppen bei Privatleuten untergebracht. An den Wochenenden nahm man uns auf geführte Exkursionen zu allen Sehenswürdigkeiten mit - nach Pamplona, wo die Stiere durch die Straßen rannten, zum einzigen Stierkampf, den ich je gesehen habe und der brutal und grausam war, aber auch spektakulär und fesselnd, und schließlich nach Loyola, dem Heimatort des heiligen Ignatius. Ansonsten verbrachten wir unsere Nachmittage am Strand, und abends gingen wir hinunter zum Hafen in die Restaurants und Bars, beteiligten uns an den Fiestas und tanzten, hörten dem heiseren Gegröle der Bands zu und blickten atemlos auf die Feuerwerke. Als ich nach England zurückkam, wurde ich von meinen Eltern gleich wieder ins Ausland entführt. Erleichtert darüber, dass ich wohlbehalten heimgekehrt war, hatten sie einen Familienurlaub in den Niederlanden und Luxemburg geplant. Solche Reisen waren eine Spezialität meines Vaters. Seiner Begeisterung hatten wir es zu verdanken, dass wir sozusagen den Vortrupp der späteren Touristenströme bildeten: Wir reisten Hunderte von Kilometern auf mäandernden Landstraßen durch ein Europa, das sich allmählich von seinem Kriegstrauma erholte, und besichtigten Städte, Kathedralen und Museen. Es war eine anregende Kombination: Bildung durch Kunst und Geschichte plus Spaß an den guten Dingen des Lebens - Wein, landestypische Küche und Sommersonne -, und in all dies mischten sich die Kriegsdenkmäler und die Soldatenfriedhöfe auf Flanderns Schlachtfeldern. Als ich im Herbst wieder zur Schule musste, hatten mir die Erfahrungen des Sommers ein noch nie da gewesenes Gefühl von Selbstsicherheit beschert. Während ich aus meiner Verpuppung stieg, fand ich, dass die Schule nur einen blassen Rahmen für die Bewusstheit und das Selbstvertrauen lieferte, die ich auf meinen Reisen erworben hatte. In Anlehnung an die neuen Satireformen, die damals gerade im Fernsehen auftauchten, ersann ich, die Schulsprecherin, für die amüsierte Abschlussklasse eine Modenschau, bei der alle Kleidungsstücke aus bizarr umfunktionierten Einzelteilen der Schuluniform hergestellt waren. Die Disziplin brach völlig zusammen, als die ganze Schule lauthals Einlass in den Saal forderte, und Miss Meiklejohn, die stämmige, wettergegerbte Sportlehrerin, deren maskulines Gebell die Schule gewöhnlich am Laufen hielt, stand wie vom Schlag gerührt herum und konnte sich im allgemeinen Lärm kein Gehör mehr verschaffen. In ihrer Verzweiflung griff sie zum Megafon - das dröhnte sonst nur beim Sportfest, auf der Haustiershow sowie zur Steuerung jener unendlichen Zweierreihen, die wir bilden mussten, wenn wir einmal im Halbjahr zum Gottesdienst in die Abtei zogen. Dieses lang vergangene Schulhalbjahr im Herbst 1962 war eigentlich nicht dazu angetan, irgendwelche Shows zu veranstalten. So sehr wir Präsident Kennedy auch anhimmelten - die Kubakrise im Oktober jenen Jahres hatte das Sicherheitsgefühl meiner Generation ernsthaft erschüttert. Wenn die Supermächte solche gefährlichen Spiele mit unserem Leben spielten, war es keineswegs sicher, dass wir uns noch auf eine Zukunft freuen durften. Während wir in der Schulversammlung unter Anleitung des Dekans für den Frieden beteten, musste ich an eine Prognose denken, die Feldmarschall Montgomery in den späten Fünfzigern abgegeben hatte: Innerhalb des nächsten Jahrzehnts werde es zu einem Nuklearkrieg kommen. Es war allgemein bekannt, dass uns bei einem Angriff mit Atomwaffen nur vier Minuten Vorwarnzeit blieben - einem Angriff, der das jähe Ende aller Zivilisation bedeuten würde. Ganz unabhängig von dieser alles überschattenden Bedrohung spürte ich, dass ich nach den Prüfungen ausgebrannt war und dass es mir, nachdem ich im Sommer die Luft der Freiheit geschnuppert hatte, an Enthusiasmus für die schulische Arbeit mangelte. Die Studienplatzsuche hielt für mich nur Demütigungen bereit, da weder Oxford noch Cambridge das geringste Interesse an mir bekundeten. Als Miss Gent, unsere Schulleiterin, bemerkte, wie sehr ich mir den Misserfolg zu Herzen nahm, legte sie mir ausführlich dar, dass es keine Schande sei, in Cambridge nicht angenommen zu werden, denn viele Männer dort stünden intellektuell weit unter den abgelehnten Frauen. Damals kamen in Oxford und Cambridge ungefähr zehn Männer auf eine Frau. Miss Gent empfahl mir ein Vorstellungsgespräch am Londoner Westfield College, und so stieg ich an einem nasskalten Dezembertag in St Albans in den Bus, um ins 15 Meilen entfernte Hampstead zu fahren. Dieser Tag war ein solches Desaster, dass ich erleichtert war, am Ende wieder im Bus zu sitzen und durch den trostlos grauen Graupelregen nach Hause zu fahren. Zuerst hatte ich mich im Spanisch-Institut durch ein Gespräch bluffen müssen, das sich fast nur um T. S. Eliot drehte - einen Autor, über den ich so gut wie nichts wusste. Dann musste ich mich in die Warteschlange vor dem Büro der Rektorin einreihen. Als ich endlich dran war, führte sie das Gespräch wie eine lustlose Angestellte aus dem öffentlichen Dienst und löste ihren Blick kaum einmal von den Unterlagen, um mich anzuschauen. Ich beschloss, wenigstens ihre Aufmerksamkeit zu wecken, selbst wenn ich mir dabei alle Chancen verbaute. Als sie mit gelangweilter Stimme fragte, weshalb ich mich für Spanisch eingetragen habe, obwohl doch Französisch meine erste Fremdsprache sei, entgegnete ich im selben gelangweilten Ton: »Weil Spanien irgendwie heißer ist als Frankreich.« Das Papier glitt ihr aus den Händen, und sie schaute mich tatsächlich an. Zu meinem Erstaunen bekam ich dann wirklich einen Platz am Westfield College, aber von all dem Elan meines spanischen Sommers war inzwischen nicht mehr viel übrig. Für den 1. Januar 1963 lud mich Diana zu einer Neujahrsparty ein, die sie mit ihrem Bruder ausrichten wollte. Ich ging hin - ordentlich angezogen in dunkelgrüner Seide (natürlich synthetisch) und mit zurückgekämmten Haaren, die sich hinten zu einer extravaganten Rolle bauschten. In meinem Innern war ich schüchtern und meiner selbst überhaupt nicht sicher. Auf der Party traf ich den jungen Mann wieder, den ich im Sommer die Straße hatte entlanghoppeln sehen. Das Haar fiel ihm über die Brillengläser ins Gesicht, und er trug ein staubig samtschwarzes Jackett und eine Fliege aus rotem Samt. Abseits von den anderen Grüppchen unterhielt er sich gerade mit einem Freund aus Oxford und erklärte ihm, dass er in Cambridge mit Forschungen auf dem Gebiet der Kosmologie begonnen habe - anders als erhofft nicht unter dem Patronat von Fred Hoyle, dem populären Fernsehwissenschaftler, sondern betreut von Dennis Sciama. Stephen gab zu, dass er sehr erleichtert gewesen war, als er letzten Sommer in Oxford sein Studium mit »sehr gut« abgeschlossen hatte. Dies war das glückliche Ergebnis eines mündlichen Examens gewesen, mit dem die Prüfer herausfinden wollten, ob man dem außerordentlich linkischen Kandidaten, dessen Arbeiten aber auch brillante Geistesblitze enthielten, ein »sehr gut«, ein »gut« oder ein »bestanden« geben sollte, wobei Letzteres mit einem Scheitern gleichbedeutend gewesen wäre. Stephen teilte seinen Prüfern in lässigem Ton mit, dass er im Falle eines »sehr gut« nach Cambridge gehen und dort eine Dissertation schreiben wolle. Dadurch hätten die Professoren ein trojanisches Pferd ins rivalisierende Lager einschleusen können, während er bei einem »gut« (das auch zu einer Forschungslaufbahn berechtigte) in Oxford geblieben wäre. Die Prüfer gingen auf Nummer sicher und gaben ihm ein »sehr gut«. Ich hörte amüsiert und gleichermaßen fasziniert zu; durch seinen Sinn für Humor und seine unabhängige Persönlichkeit fühlte ich mich angezogen von diesem ungewöhnlichen Charakter. Hier war ganz offensichtlich jemand, der wie ich durchs Leben stolperte und es schaffte, an allen Dingen die lustige Seite zu sehen. Jemand, der wie ich recht schüchtern war und es sich doch nicht verkniff, seine Meinung zu sagen; jemand, der im Gegensatz zu mir ein Gefühl für den eigenen Wert entwickelt hatte und die Unverfrorenheit besaß, dies auch zu demonstrieren. Als sich die Party dem Ende zuneigte, tauschten wir Namen und Adressen aus, aber ich rechnete nicht damit, ihn wiederzusehen, höchstens vielleicht einmal auf der Straße. Die verrutschte Frisur und die Fliege waren eine Fassade, eine Bekundung geistiger Unabhängigkeit, und in Zukunft würde ich diese Zeichen übersehen können, statt nur verblüfft auf ihn zu starren - falls ich ihm noch einmal über den Weg laufen sollte. 2 Auf der Bühne Wenige Tage später bekam ich von Stephen eine Karte, auf der er mich für den 8. Januar zu einer Party einlud. Die Karte war in solch einer gestochenen Handschrift geschrieben, wie ich sie selbst niemals zustande gebracht hätte. Ich beriet mich mit Diana, die ebenfalls eine Einladung erhalten hatte. Sie sagte mir, es sei die Feier zu Stephens 21. Geburtstag (was aus der Einladung nicht hervorging), und dann versprach sie, vorbeizukommen und mich abzuholen. Es war schwierig, ein Geschenk für jemanden auszusuchen, den man gerade erst kennengelernt hatte, und so entschied ich mich für einen Schallplatten-Gutschein. Das Haus in der Hillside Road von St Albans war eine Bastion der Sparsamkeit. Nicht dass dies in jenen Tagen ungewöhnlich gewesen wäre - in der Nachkriegszeit waren wir alle dazu erzogen worden, Geld mit Respekt zu behandeln und nichts zu verschwenden. Die Hillside Road Nr. 14 war in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet worden, ein riesiger dreigeschossiger Bau aus roten Backsteinen. Das Haus hatte einen gewissen Reiz, denn es war noch ganz in seinem ursprünglichen Zustand und hatte keine Modernisierungen wie Zentralheizung erfahren. Die Natur, die Elemente und eine Familie mit vier Kindern hatten an der schäbigen Fassade ihre Spuren hinterlassen. Vom hinfälligen gläsernen Vordach hing Blauregen herab, und oben an der Eingangstür waren von den bleigefassten Farbglasrauten der Entstehungszeit nur noch wenige übrig geblieben. Obgleich sich auf unser Klingeln erst einmal nichts rührte, wurde die Tür schließlich von Isobel Hawking, Stephens Mutter, geöffnet. Begleitet wurde sie von einem reizenden kleinen Jungen mit dunklen Locken und hellblauen Augen. Hinter ihnen erhellte eine einzige Glühbirne den langen, gelb gefliesten Korridor mit seinen schweren Möbeln und der originalen, inzwischen nachgedunkelten William-Morris-Tapete. Als die verschiedenen Familienmitglieder zur Begrüßung der Neuankömmlinge an der Wohnzimmertür auftauchten, stellte ich fest, dass ich sie alle schon kannte: Stephens Mutter war mir durch ihr Wachestehen an der Kreuzung ohnehin vertraut; sein jüngerer Bruder Edward war der kleine Junge mit der rosa Mütze; Mary und Philippa, die Schwestern, waren mir schon in der Schule aufgefallen, und Frank Hawking, der groß gewachsene, weißhaarige und distinguierte Familienvater, war einmal bei uns vorbeigekommen, um im Garten einen Bienenschwarm einzufangen. Eigentlich hatten mein Bruder Chris und ich ihm dabei zuschauen wollen, aber er hatte uns mit seiner Schroffheit verscheucht. Außer dass Frank Hawking der einzige Imker von St Albans war, gehörte er auch zu den wenigen Einwohnern, die Skier besaßen. Im Winter pflegte er jenen Hügel hinter unserem Haus hinabzufahren, auf dem wir im Frühling und Sommer picknickten und Hasenglöckchen pflückten. Nun war es, als würden sich die Teile eines Puzzles zusammenfügen: Von all diesen Leuten war mir jeder für sich bereits vertraut gewesen, aber ich hatte nie begriffen, dass sie zusammengehörten. Und noch ein anderes Mitglied des Haushalts erkannte ich: Agnes Walker, Stephens schottische Großmutter. Sie war stadtbekannt aufgrund ihres Könnens als Pianistin, das sie einmal im Monat unter Beweis stellte, wenn sie sich im Rathaus mit Molly Du Cane, unserer aufgedreht-nervigen Volkstanzspezialistin, zusammentat. In den Teenagerjahren waren Tanzen und Tennis so ziemlich meine einzigen sozialen Aktivitäten. Durch sie hatte ich eine Gruppe von Freunden aus verschiedenen Schulen und Milieus gewonnen. In unserer freien Zeit traten wir überall im Rudel auf - am Samstagmorgen zum Kaffeetrinken, abends zum Tennisspielen, im Sommer zum geselligen Beisammensein im Tennisclub, im Winter zum Volkstanz. Die Tatsache, dass auch unsere Mütter die Volkstanzabende besuchten und wir dort auf einen guten Teil der älteren Bevölkerung von St Albans trafen, störte uns überhaupt nicht. Wir saßen abseits und tanzten nur mit jungen Leuten aus unserem Kreis. Gelegentlich keimten in unserer Ecke Romanzen auf und gaben Anlass zu einer Menge Klatsch, aber meist erledigten sie sich so rasch, wie sie entstanden waren. Wir waren ein unbekümmerter, freundlicher Haufen von Teenagern und führten ein einfacheres Leben als die Jugendlichen von heute. Zu Stephens Geburtstagsparty waren Freunde und Verwandte gekommen. Einige Gäste hatte er erst in Oxford kennengelernt, aber die meisten waren alte Klassenkameraden und hatten 1959 zum großen Erfolg seiner Schule bei den Aufnahmeprüfungen für Oxford und Cambridge beigetragen. Mit 17 war Stephen jünger gewesen als die meisten Mitschüler, und so war er auch in jenem Herbst bei Studienbeginn einer der Jüngsten. Viele seiner Kommilitonen waren gleich mehrere Jahre älter als er, da sie ihr Studium erst nach dem inzwischen abgeschafften Wehrdienst aufgenommen hatten. Später sollte Stephen einräumen, dass er wegen jenes Altersunterschieds seine Studienzeit in Oxford nicht rundum hatte genießen können. Ganz gewiss aber pflegte er zu seinen Schulfreunden engere Beziehungen als zu all seinen Bekannten aus Oxford. Abgesehen von Basil King, Dianas Bruder, waren sie mir nur vom Hörensagen als die neue Elite von St Albans bekannt. Es hieß, dass sie die intellektuellen Abenteurer unserer Generation wären: leidenschaftlich darauf bedacht, alle Gemeinplätze zu kritisieren, jede klischeehafte Bemerkung lächerlich zu machen, ihre eigene geistige Unabhängigkeit zu behaupten und bis an die Grenzen des Denkbaren vorzustoßen. Natürlich unterschieden sie sich sehr von meinen Freunden, und ich, eine aufgeweckte, aber ganz gewöhnliche 18-jährige Studentin, fühlte mich eingeschüchtert. Von ihnen verbrachte sicher niemand seine Abende mit Volkstanz. Ich war mir meines Mangels an Weltläufigkeit schmerzlich bewusst, setzte mich in eine Ecke, nahm Edward auf den Schoß und hörte den Partygästen zu. An ihrer Konversation teilzunehmen versuchte ich gar nicht erst. Manche hatten sich hingesetzt, andere lehnten an den Wänden des großen Wohnzimmers, dessen einzige Wärmequelle ein Ofen mit Glasfront war. Die Gespräche liefen stockend und bestanden meistenteils aus Witzen, die nicht im Entferntesten so intellektuell waren, wie ich erwartet hatte. Es verging eine gewisse Zeit, ehe ich von Stephen das nächste Mal etwas hörte. Ich absolvierte in London einen Sekretärinnenkurs, bei dem uns eine revolutionäre Form der Stenografie beigebracht wurde: Anstelle von Hieroglyphen benutzte man dabei das Alphabet, aber alle Vokale wurden ausgelassen. Abgesehen von einer kurzen Mittagspause brachte ich den ganzen Tag im Klassenzimmer zu, umschwirrt vom Geklapper zahlreicher altmodischer Schreibmaschinen und dem Geschnatter junger Mädchen aus gutem Hause, die ihren Status weitgehend danach bemaßen, wie oft sie bereits in den Buckingham-Palast, den Kensington-Palast oder nach Clarence House eingeladen worden waren. Die neue Stenografiemethode war leicht genug zu erlernen, aber das Zehnfingersystem beim Maschineschreiben war der reinste Albtraum. Den Sinn des Stenografierens konnte ich noch einsehen, denn es würde mir für meine Vorlesungsmitschriften an der Universität nützlich sein, aber das Maschineschreiben war extrem öde, und ich war dafür hoffnungslos unbegabt und kämpfte noch damit, 40 Worte pro Minute zu schaffen, als der Rest der Klasse den Kurs bereits beendet und alle übrigen Fertigkeiten einer Sekretärin erlernt hatte. An den Wochenenden konnte ich die Schrecken des Maschineschreibens vergessen und alte Freunde wiedersehen. Eines Samstagmorgens im Februar traf ich Diana, die inzwischen Schwesternschülerin am Sankt-Thomas-Krankenhaus war, und Elizabeth Chant, eine weitere Schulfreundin, die zur Grundschullehrerin ausgebildet wurde. Wir saßen an unserem Lieblingsort - dem Café von Green's, dem einzigen Kaufhaus in St Albans. Als wir über unsere Freunde und Bekannten zu reden begannen, fragte Diana plötzlich: »Habt ihr das mit Stephen gehört?« »O ja«, sagte Elizabeth, »schrecklich, nicht wahr?« Mir wurde klar, dass sie über Stephen Hawking sprachen. »Was meint ihr?«, fragte ich. »Ich weiß von nichts.« »Na, er soll schon zwei Wochen im Krankenhaus sein«, klärte mich Diana auf. »Er ist dauernd gestolpert und konnte seine Schnürsenkel nicht mehr binden.« Sie hielt einen Moment inne. »In der Klinik haben sie jede Menge schreckliche Tests mit ihm gemacht und schließlich rausgefunden, dass er an einer furchtbaren unheilbaren Krankheit leidet, bei der man gelähmt wird. Ein bisschen wie bei Multipler Sklerose, aber es ist was anderes, und sie schätzen, dass ihm nur noch ein paar Jahre bleiben.« Ich war fassungslos. Ich hatte Stephen doch gerade erst kennengelernt, und trotz seiner exzentrischen Art mochte ich ihn. Wir beide wirkten schüchtern, wenn andere dabei waren, aber innerlich waren wir voller Zuversicht und Selbstvertrauen. Für mich war es unvorstellbar, dass jemand, der nur wenige Jahre älter war als ich, schon den eigenen Tod vor Augen haben sollte. Der Gedanke ans Sterben spielte in unserem Alltag keine Rolle. Wir waren noch jung genug, um ein ewiges Leben vor uns zu haben. »Wie geht es ihm jetzt?«, fragte ich, erschüttert von der Nachricht. »Basil ist bei ihm gewesen«, fuhr Diana fort, »und er meint, dass Stephen ziemlich deprimiert ist; die Tests sind wirklich kein Spaß, und im Bett neben seinem ist letztens ein kleiner Junge aus St Albans gestorben.« Sie seufzte. »Wegen seiner sozialistischen Prinzipien hat Stephen darauf bestanden, im großen Krankensaal zu liegen, obwohl ihn seine Eltern in ein Einzelzimmer bringen wollten.« »Kennt man denn die Ursachen seiner Krankheit?«, fragte ich Diana. »Nicht wirklich«, meinte sie. »Vor einigen Jahren ist er in Persien gegen Pocken geimpft worden, und sie glauben, dass man da vielleicht nicht steril gearbeitet hat und ein Virus in sein Rückenmark gelangt ist - aber das ist bloß Spekulation, genau weiß es keiner.« Ich ging schweigend nach Hause und dachte an Stephen. Meiner Mutter fiel auf, wie besorgt ich war. Sie hatte ihn noch nicht gesehen, kannte ihn aber vom Hörensagen und wusste auch, dass ich ihn mochte. Vorsichtshalber hatte ich sie schon einmal gewarnt, dass er sehr exzentrisch sei - es konnte ja sein, dass er ihr einmal unangekündigt über den Weg lief. In ihrem tief verwurzelten Glauben, der ihr während der Kriegsjahre, der letzten Krankheit ihres geliebten Vaters und der Depressionsschübe ihres Ehemanns geholfen hatte, sagte sie ganz ruhig: »Warum betest du nicht? Es könnte helfen.« Etwa eine Woche später wartete ich auf den Neunuhrzug nach London, als zu meiner Verblüffung Stephen den Bahnsteig entlangschlenderte, in der Hand einen braunen Segeltuchkoffer. Er wirkte ganz fröhlich und schien sich zu freuen, mich zu sehen. Sein Erscheinungsbild war diesmal konventioneller und im Grunde noch anziehender als sonst: die Merkmale seines alten Images, das er wahrscheinlich in Oxford kultiviert hatte - Fliege, schwarzes Samtjackett und langes Haar -, waren einer roten Krawatte, einem beigefarbenen Regenmantel und einem ordentlicheren, kürzeren Haarschnitt gewichen. Unsere beiden vorigen Begegnungen hatten abends bei gedämpftem Licht stattgefunden, aber nun betonte das Tageslicht sehr vorteilhaft sein breites, gewinnendes Lächeln und seine hellgrauen Augen. Hinter der eulenhaften Brille lag in seinen Zügen etwas, das mich anzog und mich, vielleicht nur unbewusst, an Lord Nelson erinnerte, meinen ostenglischen Lokalhelden. Im Zug nach London saßen wir zusammen und unterhielten uns fröhlich, aber seine Krankheit erwähnten wir dabei kaum. Als ich sagte, wie leid es mir getan habe, von seinem Krankenhausaufenthalt zu hören, rümpfte er nur die Nase und entgegnete nichts. Er benahm sich so überzeugend, als wäre alles in Ordnung, und ich spürte, dass es grausam wäre, das Thema noch länger zu erörtern. Er war auf dem Rückweg nach Cambridge, und als wir uns dem Bahnhof St Pancras näherten, erwähnte er, dass er an den Wochenenden recht häufig in seinem Elternhaus sei. Vielleicht mochte ich ihn hin und wieder ins Theater begleiten? Natürlich mochte ich. An einem Freitagabend trafen wir uns in einem italienischen Restaurant in Soho, was schon für sich genommen ein verschwenderischer Abend gewesen wäre. Stephen hatte aber auch Theaterkarten, und das Dinner musste zu einem hastigen und peinlich teuren Abschluss gebracht werden, damit wir noch rechtzeitig über den Fluss zum berühmten Old Vic Theatre kamen, wo Volpone auf dem Spielplan stand. Als wir ins Theater hineingerauscht kamen, hatten wir gerade noch Zeit, unsere Sachen unter den Sitzen zu verstauen, und schon begann das Stück. Meine Eltern waren eifrige Theaterbesucher gewesen, und so hatte ich bereits Jonsons anderes großes Stück Der Alchimist gesehen und von Anfang bis Ende genossen; Volpone war genauso unterhaltsam, und schon bald war ich gefesselt von den Intrigen des alten Fuchses, der die Aufrichtigkeit seiner Erben prüfen wollte und dessen Pläne gründlich in die Hose gingen. Noch ganz beschwingt von der Aufführung standen wir hinterher an der Bushaltestelle. Ein Penner näherte sich uns und fragte Stephen höflich, ob er etwas Kleingeld habe. Stephen wühlte in seinen Hosentaschen und antwortete verlegen: »Tut mir leid, ich glaub, ich habe keinen Penny mehr!« Der Penner grinste und schaute mich an. »Is schon in Ordnung, Chef, ich verstehe«, sagte er und winkte mir zu. In diesem Moment hielt der Bus vor uns an, und wir stiegen ein. Als wir uns hinsetzten, sagte Stephen mit betretener Miene: »Es ist mir total peinlich, aber ich hab nicht mal mehr Geld für das Busticket. Hast du vielleicht noch welches?« Da ich mich sowieso schon schuldbewusst bei dem Gedanken daran fühlte, welche Summen er für unseren Abend ausgegeben haben musste, wollte ich ihm nur zu gern aushelfen. Der Schaffner nahte und wich uns nicht von der Seite, während ich in den Tiefen meiner Handtasche nach dem Portemonnaie suchte. Meine Verlegenheit reichte an Stephens heran, als ich entdeckte, dass es fort war. An der nächsten Ampelkreuzung sprangen wir aus dem Bus und rannten zurück zum Old Vic. Der Haupteingang war schon geschlossen, aber Stephen hastete weiter - zum Bühneneingang an der Seite. Er war noch offen, und im Korridor brannte Licht. Vorsichtig wagten wir uns hinein, doch es war kein Mensch zu sehen. Als wir den Korridor bis zum Ende durcheilt hatten, fanden wir uns plötzlich auf der verwaisten, aber noch hell erleuchteten Bühne wieder. Von Ehrfurcht ergriffen, überquerten wir sie auf Zehenspitzen und stiegen die Stufen zum dunklen Zuschauerraum hinab. Zu unserer beider Erleichterung fanden wir die grüne Lederbörse im Handumdrehen unter meinem Sitzplatz. Gerade als wir zur Bühne zurückgehen wollten, gingen die Lichter aus, und wir standen in völliger Dunkelheit da. »Halt dich an mir fest«, sagte Stephen mit Autorität in der Stimme. Ich nahm seine Hand und folgte ihm atemlos und in stiller Bewunderung. Zum Glück war der Bühnenausgang noch geöffnet, und als wir auf die Straße hinaustaumelten, mussten wir erst einmal loslachen. Wir hatten auf der Bühne des Old Vic gestanden!