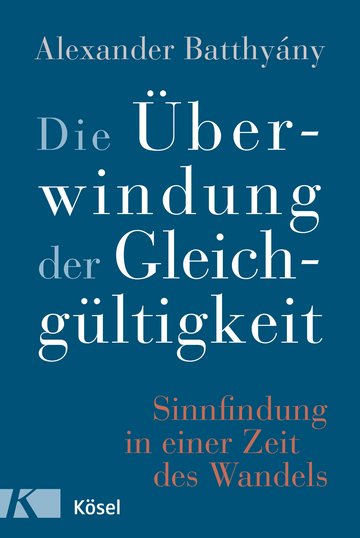Der Traum, den wir einst hatten …
Einleitung: Lebenshaltung und Lebensführung
Dieses Buch handelt von zwei der menschlichsten Regungen überhaupt: von der Hoffnung und der Bereitschaft, engagiert und wohlwollend am Leben teilzunehmen. Und von der Fähigkeit, einen Sollzustand in der Welt als Auftrag und Anfrage an uns selbst wahrzunehmen: Als Auftrag etwa, dort etwas zum Guten zu wenden zu versuchen, wo man andernfalls bloß schulterzuckend vorbeigegangen wäre.
Es handelt auch von den Gründen, die uns daran hindern können, ein interessiertes, existenziell großzügiges, aufmerksames und zum Teilen bereites, offenes Leben zu führen. Ein Leben, das seine Stärke nicht nur daraus gewinnt, dass wir an uns selbst denken, sondern vor allem daraus, dass wir ansprechbar und interessiert und engagiert bleiben – und zwar auch dann und obwohl uns mit einiger Sicherheit manches von dem, was wir uns vornehmen, nicht oder nur sehr unvollkommen gelingen wird.
Von Florence Foster-Jenkins, der von Musikkritikern einhellig beschieden wurde, sie sei vermutlich die schlechteste Sängerin der Welt, ist der schöne Satz überliefert: »Die Leute mögen sagen, ich könne nicht singen. Aber keiner kann sagen, ich hätte nicht gesungen.« Und es soll keiner sagen können, wir hätten nicht zumindest versucht, dem Leben unser Bestes zu geben – was allerdings voraussetzt, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben oder sie, wo das nötig ist, wiedergewinnen.
Von ebendieser Hoffnung handelt dieses Buch. Es handelt genauer von den vielfältigen Beziehungen zwischen unserer Hoffnung, unserem Selbstbild, Weltbild und Menschenbild und unserem persönlichen Erleben, Denken, Entscheiden, Verhalten und Handeln. Es handelt von Einstellungen und Werten und auch davon, dass es Welt- und Selbstbilder gibt, die unser Leben und Zusammenleben eher gelingen lassen, und solche, die uns und anderen sowohl das Leben als auch selbst noch das Sterben schwerer machen, als es womöglich sein müsste. Der Blick auf das eigene Selbstbild, Menschenbild und Weltbild ist nicht nur ein Schlüssel zum Verstehen unseres Erlebens und Handelns, sondern auch zur Veränderung und Reifung und schließlich: zu einem gelingenden, erfüllenden Leben – persönlich und sozial.
Denn Einstellungen lassen sich ändern. Das gelingt nicht nur durch Überzeugungsarbeit und Appelle (damit sogar meist weniger), sondern vor allem durch das Verstehen und Anerkennen einiger mitunter überraschend einfacher, aber umso leichter vergessener oder übersehener Gegebenheiten des Daseins.
Wenn wir diese Gegebenheiten in den Blick nehmen, lassen sich Einstellungen sogar oft wesentlich leichter korrigieren. Und diese Korrektur bewirkt auch eine tiefgreifendere und nachhaltigere Veränderung unseres Verhaltens als etwa der bloße Vorsatz, von heute an so und nicht anders zu entscheiden, zu handeln, zu reagieren. Die meisten von uns wissen es aus eigener Erfahrung: Es ist verhältnismäßig leicht, hehre Vorsätze zur Änderung des eigenen Verhaltens zu fassen, aber ebenso schwer, diese Vorsätze auch über längere Zeit konsequent umzusetzen. Zahlreiche psychologische Forschungsarbeiten bestätigen diesen Erfahrungsbefund.1 Sie legen vielmehr nahe, dass der Schlüssel zum Verstehen und Ändern unseres Verhaltens weniger nur im Verhalten selbst, als vielmehr in den unserem Handeln zugrunde liegenden Einstellungen, Erwartungen und Haltungen liegt. Anders gesagt: Unser Handeln und unsere Lebensführung sind bis zu einem gewissen Grad stets auch »Symptom« und Ausdruck unserer Lebenshaltung.
Es gibt somit einen bedeutenden Zusammenhang zwischen dem, was wir über uns, unsere Mitmenschen und die Welt glauben, und dem, was wir von uns selbst, anderen und dem Leben insgesamt erwarten. Und es ist wichtig, wie viel Hoffnung wir in uns selbst und das Leben setzen. Von diesen Erwartungen und Hoffnungen hängt wie gesagt ein Großteil unseres Handelns und Verhaltens, vielleicht sogar unser gesamter Lebensentwurf, ab. Dieser Zusammenhang ist genau genommen so stark, dass sich uns das Verhalten anderer überhaupt erst in dem Maße richtig erschließen will, in dem wir in der Lage und bereit sind, die Dinge so zu sehen, wie sie sich dem anderen darstellen. Das gilt für Individuen ebenso wie für ganze Gesellschaften.
Das Verstehen geschichtlicher Ereignisse oder fremder Kulturen beispielsweise setzt voraus, dass wir uns die Mühe machen, in ihr Welt- und Menschenbild einzutauchen und es nachzuvollziehen. Bis uns das gelingt – und vorausgesetzt, dass es uns gelingt –, wird die Begegnung mit einer fernen geschichtlichen Epoche oder Kultur eine Begegnung mit etwas Fremdem und als solche vielleicht exotisch und interessant sein, letzten Endes aber unbegreiflich und verborgen und stets nur Stückwerk bleiben. Der Grund: Die Welt des anderen hat sich uns noch nicht erschlossen; es ist uns »gedanklich fern« – also erschließt sich uns auch sein Verhalten und Handeln nicht:
A vereinbart mit B, dass er diesen am nächsten Morgen begleiten werde, ein Haus zu besichtigen, das B erwerben will. Die beiden machen sich auf den Weg; plötzlich erklärt B, er werde das Haus doch nicht heute besichtigen und vielmehr nach Hause zurückkehren. Er gibt anfänglich keine Gründe an; auf Drängen sagt er schließlich: »Aber haben Sie denn nicht die schwarze Katze gesehen, die über den Weg lief? Es wäre sicher nichts Gutes herausgekommen.« B lebt in der Welt des Aberglaubens, der Vorzeichen, in der Ereignisse beachtenswert und bedeutungsvoll, bestimmend für das Handeln werden, die in der Welt des A einfachhin nicht existieren, weil die dort keine Rolle spielen.2
Schwarze Katzen gibt es auch in der Welt desjenigen, der ihnen keine größere Bedeutung beimisst. Aber es ist gerade diese zusätzliche Bedeutung oder auch genereller die Bereitschaft, hinter Vorkommnissen und Dingen, die dem einen ganz belanglos erscheinen, weitere Bedeutungszusammenhänge zu vermuten, die den Unterschied zwischen Verstehen und Unverständnis unseres eigenen Verhaltens oder des Verhaltens anderer ausmacht.
Lebensbild und Lebenswirklichkeit
Nun ist das Verstehen und Nachvollziehen anderer Standpunkte, das sagt uns die psychologische Forschung ebenso wie wahrscheinlich auch die Alltagserfahrung der meisten, kein besonders leichtes Unterfangen.3 Mehr noch – dieselbe Forschung legt auch nahe, dass uns nicht einmal das Verstehen und Nachvollziehen unserer eigenen Welt- und Selbstbilder immer und auf Anhieb gelingen will.4 Das liegt vermutlich unter anderem daran, dass ein Großteil der Einstellungen und Ideen, die unserem Welt- und Menschenbild zugrunde liegen, nur selten bewusst erworben und noch seltener regelmäßig rational auf ihre Wirklichkeitsnähe hin durchleuchtet wurden und werden.
Würde man sie aber durchleuchten, würde man vielleicht bald feststellen, dass manche dieser Einstellungen gar nicht mehr zu unseren Lebenswirklichkeiten passen, womöglich sogar widersprüchlich sind (»Gleich und gleich gesellt sich gern« ist mindestens so einleuchtend wie »Gegensätze ziehen sich an«). Wieder andere mögen sich kurzfristig bewähren, uns aber langfristig mehr Schaden als Nutzen bringen; und wieder andere mögen nur uns Nutzen bringen, unsere Umwelt und Mitmenschen aber schädigen, entwerten, verletzen. Wobei im Folgenden noch zu untersuchen sein wird, ob Verhalten, das nur uns nutzt und das Wohlergehen anderer ignoriert, nicht auch zu jenen Lebensweisen zählt, die uns selbst langfristig am meisten schaden: entweder, weil wir durch ein solches ichbezogenes Handeln weit hinter dem zurückbleiben, was wir an Talenten und Fähigkeiten für das Gute und Wertvolle einzusetzen und in die Welt auszusenden fähig wären; oder, weil wir heute auf das Wohlwollen, die Hilfe und Unterstützung eben jener Menschen angewiesen sein können, die wir gestern noch als bloßes Mittel zum Zweck für unser eigenes kleines »Glück« benutzten.
So oder so: Am Beispiel der egoistischen Lebenshaltung lässt sich leicht illustrieren, wie eng die Beziehung zwischen unserem Lebensglück und unserer Lebenseinstellung wirklich ist. Diese Einstellung, von der man eigentlich im ersten Moment erwarten sollte, dass sie zumindest – oder wenigstens – dem, der sie sich zum Lebensprinzip gemacht hat, dienlich sein sollte, kann viel Leid hervorbringen. Eine solche Haltung zu korrigieren, ist um ein Vielfaches leichter, wenn man sie als das begreift, was sie wirklich ist: nämlich ein grundlegendes existenzielles Missverständnis über das Verhältnis zwischen unserem persönlichen Lebensglück, unserer Erfüllung und dem, was wir von uns und der Welt erwarten. Anders formuliert: Was sich im Endresultat wie ein moralisches Defizit ausnimmt, ist unter einem anderen Blickpunkt oft nur die Folge einer Lebenshaltung, die sich wohl die wenigsten zu eigen gemacht haben, weil sie ichsüchtig und moralisch etwas fragwürdig ist. Wenn man dem Egoisten seinen Egoismus vorhält, nimmt man daher nicht selten einen vergeblichen Kampf auf. Man kämpft gegen ein Symptom an, nicht aber gegen dessen Gründe und Ursachen. »So ist die Welt nun einmal – jeder muss an sich und seinen Vorteil denken, weil niemand anderer es für einen tut«, mag der Egoist zum Beispiel denken.
In einer so gedeuteten Welt stellen nicht nur schwarze Katzen, sondern nahezu alle Menschen eine Bedrohung dar. Sie werden zu Gegnern, Konkurrenten, Feinden. Auch wenn einem also das Verhalten, das aus einer solchen Haltung erwächst, moralisch zweifelhaft erscheint: Es wäre ungerecht, dem...