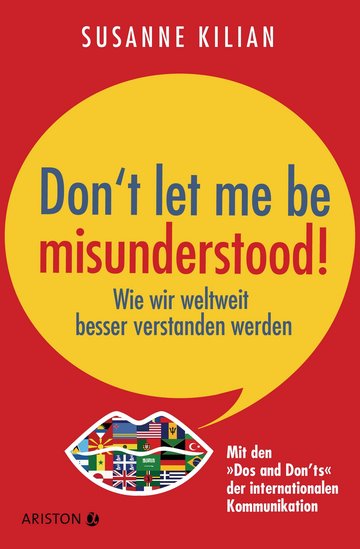1
Jeder hört, was seine Kultur ihn zu hören gelehrt hat
Mit einem verschmitzten Lächeln beendete Sascha seine mitreißende Rede und genoss den Applaus. Er hatte das Auditorium mit Witz, Charisma und Leidenschaft für sein Anliegen begeistert.
»Was für eine Stimmung! Diese Konferenz hat richtig Spaß gemacht. Solch einen Elan hätte ich einer Ingenieurstagung im tiefsten Norddeutschland gar nicht zugetraut. Das hatte ich mir viel trockener, eher langweilig vorgestellt. Danke, dass du mich zu diesem Einsatz mitgenommen hast«, wandte ich mich an meine Kollegin Bettina.
Sie nickte. »Ja, dieser Mann besitzt nicht nur Ausstrahlung, sondern bringt zugleich ein bewundernswertes Engagement rüber. Was er auf die Beine gestellt hat, das ist German engineering at its best. Diese Art von Unternehmertum begeistert mich.«
Saschas Firma entwickelt Überlebenstechnologie für UN-Flüchtlingslager, in denen Menschen Schutz suchen, die durch die Hölle gegangen sind. Viele erreichen die rettenden Notunterkünfte dehydriert, unterernährt, krank, verletzt und zutiefst traumatisiert. Von einer funktionierenden Infrastruktur des Lagers hängt daher alles ab. Sie entscheidet über Leben und Tod. Wenn etwa die Wasseraufbereitungsanlage nicht reibungslos arbeitet, bedeutet dies schnell den Tod vieler Menschen. Die »Hardware« eines Flüchtlingslagers muss selbst unter extremen klimatischen Bedingungen funktionieren.
Saschas Schilderungen über die Zustände in den Notunterkünften hatten uns zutiefst erschüttert, der Ehrgeiz und die Hingabe, mit der sein Team Lösungen erarbeitet, uns tief beeindruckt.
Doch nicht nur sein Thema, auch sein Vortragsstil war etwas Besonderes. Einen solch kompetenten Redner zu dolmetschen, gehört zu den Höhepunkten unseres Berufs.
Wenige Wochen später, bei einer UNO-Konferenz auf einer der schönsten deutschen Inseln, traf ich den engagierten jungen Unternehmer überraschend wieder.
»Herzlich willkommen zum tollsten Vortrag der gesamten Konferenz«, begrüßte mich meine Kollegin Elisabeth mit genervtem Unterton, als ich zu ihr in die Kabine trat. Sie verdrehte die Augen und deutete dabei auf den Redner, der sich auf dem Podium sichtlich unwohl fühlte, sogar richtiggehend litt. Das konnte doch nicht wahr sein!
»Also dieser Typ da unten – dem Akzent nach kann er nur Deutscher sein«, fuhr Elisabeth fort, »der stammelt sich gerade um Kopf und Kragen.«
Ungläubig starrte ich auf meinen Landsmann, der sich und das Auditorium quälte. Es war Sascha, der junge, dynamische Macher, der erst vor wenigen Wochen in seiner Muttersprache die Zuhörer in seinen Bann gezogen und begeistert hatte. Derselbe Mann, dasselbe packende Thema, das niemanden kaltlassen konnte. Nur war allzu deutlich, dass diesmal weder Sascha noch sein Thema zu fesseln vermochten. Der Funke wollte einfach nicht überspringen. Die Zuhörer lasen, blätterten in Unterlagen, schauten auf ihre Uhren, spielten mit ihren Smartphones – nicht wenige schliefen sogar.
Wo bitte schön waren Saschas Charisma, sein Witz, seine Leidenschaft geblieben? An seinem Englisch konnte es nicht liegen, denn das war durchaus brauchbar. Was also ging hier so fürchterlich schief?
Da war sie wieder, diese bohrende Frage. Es kam mir vor, als wäre ich in einer Zeitschleife gefangen, alle Zeichen standen auf Wiederholung. Ich konnte aber weder die Stopp-Taste drücken noch die Play-Taste, damit es endlich weiterging.
Ich musste hier raus. Murmeltiertag. Ganz eindeutig. Denn Murmeltiertage sind ein gewaltiges Grauen. Warum? In dem legendären Film Und täglich grüßt das Murmeltier kämpft Wetterfrosch Phil Connors alias Bill Murray gegen eine endlose Wiederholung des 2. Februar, jenes Tages, an dem er alljährlich in Punxsutawney, Pennsylvania, über den Murmeltiertag zu berichten pflegt. Dabei geht es nur um einen einzigen Moment: Wenn dieses Erdhörnchen nach einem ausgedehnten Winterschlaf beim ersten neugierigen Blick aus dem Bau den eigenen Schatten sieht, wird der Winter noch weitere sechs Wochen dauern – ist das nicht der Fall, beginnt der Frühling. Eigentlich ganz einfach. Nicht so für Connors, denn er erlebt dieses Ritual wieder und wieder. Er sitzt mit seinen Gedanken in einer Zeitschleife fest.
Und nun befand ich mich ebenfalls in einer Art Punxsutawney. Nur hielt ich nicht unentwegt Ausschau nach einem bräunlichen Nagetier, das Szenario war anders. Ich saß in meiner Dolmetschkabine und litt. Ich musste wieder einmal zuhören, wie ein Landsmann sich redlich abmühte, auf Englisch die Vorzüge seines Unternehmens anzupreisen. Und zwar eines Unternehmens, das doch so wichtig war in diesen Zeiten des Krieges.
Seitdem ich für die UN arbeitete, schien es kein anderes Thema als Krieg zu geben. Gerade ging es um Afghanistan, davor um Irak, Ruanda, den Balkan. Eine endlos lange Liste. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen.
Als junges Mädchen hatte ich mich intensiv – was damals niemand verstand – mit dem Thema Krieg und Kriegsschuld auseinandergesetzt. Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues zog mich vollkommen in seinen Bann. Immer und immer wieder las ich jene ergreifende Szene, in der ein französischer Soldat in den Armen eines Deutschen stirbt. Meine kindlich-naive Schlussfolgerung aus dieser Schlüsselszene: Wenn Menschen sich als Menschen und nicht als Feinde kennenlernen dürfen, wird es keine Kriege mehr geben.
Zeitgleich besprachen wir in der Schule Woodrow Wilson.
Der achtundzwanzigste Präsident der Vereinigten Staaten hatte viel zur Beendigung des Ersten Weltkriegs beigetragen und sich auf den Friedenskonferenzen 1918 maßgeblich für die Gründung des Völkerbunds und eine weltweite Friedensordnung eingesetzt. Er hatte die Vision, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen treffen konnten, um Kriege zu verhindern, den Frieden zu sichern. Die Vereinten Nationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Völkerbund hervorgingen, wurden zu einem solchen Ort, nicht umsonst ist ihr Emblem die Friedenstaube.
Wilson wurde eines meiner Idole. Mein Mann. Ich würde den Frieden sichern und die Welt retten, indem ich zu den Vereinten Nationen ging, sobald ich dieses unsägliche Abi geschafft hatte. Stolz verkündete ich dies meinen Eltern.
Ich war ein lebhaftes Mädchen mit täglich neuen Ideen im Kopf, und so lautete die Antwort: »Geh lieber schwimmen, draußen scheint die Sonne.«
Zwar ging ich schwimmen, ließ mich dennoch nicht beirren und wünschte mir ein eigenes Radio. Tag und Nacht hörte ich nur einen Sender: die BBC. Insbesondere nachts ließ ich deren Programm laufen, da mein Vater bei einem Tischgespräch erwähnt hatte, man könne am besten im Schlaf lernen.
Meine Verehrung für Wilson und seine Visionen ließ auch in den folgenden Jahren nicht nach – vielleicht deshalb, weil sie so naiv war. In keiner Weise hatte ich mich nämlich näher mit dem Friedensnobelpreisträger von 1919 und seinem Menschenbild beschäftigt. Bei Rassenfragen trat er wenig progressiv auf. Als Präsident aus den Südstaaten, der erste seit dem Bürgerkrieg, hielt er mit seinem racial nationalism unvermindert an der Rassentrennung fest. Und dem Frauenwahlrecht stimmte er nur aus Gründen der Opportunität zu. All das las ich allerdings erst viel später nach.
Noch später erfuhr ich, dass mein Großvater im Ersten Weltkrieg jene von Remarque so bewegend beschriebene Sterbeszene selbst in ähnlicher Weise hatte erleben müssen. Während der Grabenkämpfe in den durch Bomben verursachten Trichtern schoss er auf einen Franzosen und sah sich mit dem Sterben des Mannes konfrontiert. Er versuchte, dem lebensgefährlich Verwundeten zu helfen, seinen Körper schützend zu lagern und die Wunden zu verbinden. Dabei fielen Fotos aus der Uniform des Franzosen. Sie zeigten ihn mit zahlreichen kleinen Kindern und seiner Frau. Die Folge: Mein Großvater kam nicht nur als überzeugter Antimilitarist aus dem Krieg zurück, sondern auch voller Schuldgefühle. Sie ließen ihn nicht mehr los.
Da er bei meiner Geburt fast achtzigjährig war, kann ich mich nicht an ihn erinnern. Meine Mutter erzählte, dass er mich als Baby über viele Stunden im Arm gehalten und mich mit Löffelbiskuits gefüttert habe. Während ich wuchs und gedieh, wurde mein Großvater immer dünner. Der Magenkrebs fraß ihn auf, und bald darauf starb er.
Und ich? Mit neunundzwanzig war ich angekommen bei der UN, der Institution, die den Frieden sichern sollte. Und nun dolmetschte ich hilflos Reden über Flüchtlingselend, Krisengebiete und Krisenmanagement. Es war mir nicht gelungen, die Welt zu retten. Stattdessen musste ich mir schlecht präsentierte englische Vorträge wie den meines Landsmanns mit dem wichtigen Anliegen anhören.
Ich war mir sicher, dass Sascha den Auftrag nicht bekam, und litt mit ihm, als wäre ich selbst betroffen. Litt sogar so sehr, dass ich unbedingt einen Tapetenwechsel brauchte. Deshalb verließ ich die Konferenz, gönnte mir eine Erholungspause in einem Straßencafé und dachte nach.
Gut, Susanne, gestand ich mir ein, an der Friedenssicherung und dem Weltretten bist du kläglich gescheitert. Es ist an der Zeit, kleinere Brötchen zu backen. Zeit für ein neues Ziel: Vielleicht solltest du erst einmal verstehen lernen, wie wir Deutschen auf Englisch ähnlich gewinnend und souverän wirken können wie in unserer Muttersprache.
Menschen wie Sascha brauchten Unterstützung, daran gab es keinen Zweifel. Ihnen diese zu geben, kam mir auf einmal wie ein Traum vor, eine Vision. Wenn man diese Leute auf dem internationalen Parkett anhörte...