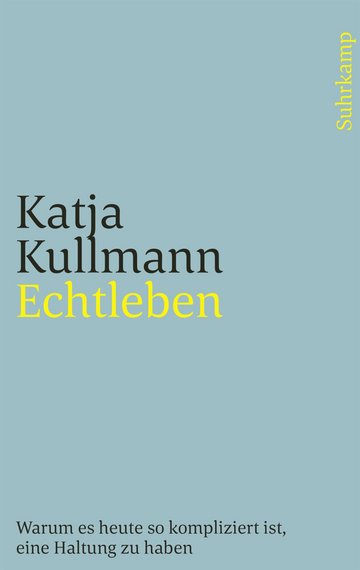VORWORT
Ich bin eine von den Leuten, die ständig Fotos machen. Meine Digitalkamera hat einmal 89,90 Euro gekostet, hat ein schwarzes Gehäuse, ein paar Funktionen, die ich nicht verstehe, und einen Pixel-Grad, den ich immer wieder vergesse, denn er ist mir völlig gleichgültig. Es ist ein lächerlicher Apparat, aber er genügt mir. Hauptsache, er funktioniert. Egal wohin ich mich bewege, ob ich meine Kamera in eine Tasche meines Allwetter-Parkas stopfe oder in meine zierliche Vintage-Bag mit den nachtblauen Pailletten, in meine aktentaschenähnliche Aktentasche oder in meinen baumwollenen Einkaufsbeutel mit der Aufschrift Berufsschullehrer gegen Atomkraft: Sie ist immer dabei.
Einige Kratzer und Dellen hat sie über die Jahre davongetragen, weil sie mir unterwegs ein paar Mal aus der Hand gerutscht und auf den Asphalt irgendeiner Großstadt geknallt ist. Wann immer ich glaube, einen Fetzen Wirklichkeit vor Augen zu haben, der mir etwas sagt, drücke ich ab – damit ich die Unübersichtlichkeit der Dinge wieder einmal sehen kann. Oft fotografiere ich mich selbst oder bitte Freunde, den Auslöser zu betätigen. Zwei meiner Lieblingsaufnahmen sind auf diese Art entstanden, in Berlin, in ein und derselben Nacht: Ich lehne mich an einen elfenbeinfarbenen Jaguar, der irgendwo in Mitte zufällig unter einer Straßenlaterne geparkt ist, fast wirkt es so, als gehörte mir der prächtige Wagen und als stiege ich gleich ein. Das zweite Foto ist eine Stunde später aufgenommen worden, in der gekachelten Vorhalle eines Edeka-Markts. Ich stehe vor einem Mitternachts-Imbiss, halte eine türkische Pizza für um die Einsfünfzig in den Händen und beiße, mit übertrieben gezückten Augenbrauen, hinein.
Wir machen es alle so. Liebevoll, akribisch, manchmal narzisstisch, in jedem Fall detailversessen archivieren wir die Welt, wie sie sich uns darstellt (oder wie wir sie uns vorstellen – oder wie wir uns uns in ihr vorstellen), drehen wackelige Videos im YouTube-Format, betätigen uns als Dokumentare unseres eigenen Lebens und packen die Bilder in ein Facebook-Album oder einen Blog. Wir versuchen, uns selbst und den anderen von der Wirklichkeit zu erzählen. Damit wir sie so vielleicht irgendwie zu fassen kriegen.
Gelegentlich entsteht ein Foto, das wie Kunst aussieht. Man kann abgerissene Plakatwände, verwehte Plastiktüten, Burger-Reste im Rinnstein und Sonderangebotsschilder – Alles muss raus! – ganz leicht so fotografieren, dass sie perfekte Motive für einen modernen Bildband ergäben, der in begrenzter Auflage in einer Art Edition erscheinen könnte, mit einem klein gedruckten, schwer verständlichen Einführungs-Essay auf Englisch. Traumhafte Trümmer wäre ein Titel, der uns neugierig macht. Wir stellen uns vor ein Bulgari-Schaufenster und ziehen Grimassen. Wir knipsen die Warenauslage eines Ein-Euro-Shops und verstärken die Farben mit der High-Contrast-Funktion. Wir setzen uns auf verwitterte Kunststoff-Elefanten in heruntergekommenen Freizeitparks, klettern stillgelegte Rolltreppen hinauf und hinab, spazieren an Backsteingebäuden mit zerschlagenen Fensterscheiben entlang und schneiden mit. Manche hängen sich Geweihe an die Wand oder stellen sich ausgestopfte Tierkadaver ins Regal und nehmen sie bei unterschiedlichem Tageslicht auf. Wir halten die Pressspan-Einrichtungen sanierungsreifer Autobahnraststätten fest und fotografieren brach liegende Industrieanlagen im Sonnenuntergang. Wir sind fasziniert von Ruinen aller Art. Schwarz-weiß ist unsere Lieblingsfarbe. Oder wir wählen die grobkörnige Retro-Ästhetik der Hipstamatic-Funktion. Sentimental ist der Name, den wir unserem hochbegabten Kind gern gäben, gleich ob es schon geboren ist oder nie zur Welt kommen wird, weil die Zeit irgendwie nie die richtige dafür ist. Wir werden alle älter und leben in einem nicht enden wollenden Jim-Jarmusch-Film.
Eines der berühmtesten Bilder der Gegenwart ist gleich in Dutzenden Varianten aufgenommen worden, in London, Madrid, Kopenhagen, Paris, Wien, Zürich, Krakau, Antwerpen, Köln, Leipzig und Berlin. Es zeigt ein hell erleuchtetes Schaufensterladen-Büro, spätnachts: Man sieht zwei bis drei halbwegs jung wirkende Menschen hinter Glas, wie sie dünn und erschöpft vor ihren chronisch aufgeweckten Computern sitzen.
Das Bild erzählt von gutem Willen, gepaart mit Ratlosigkeit.
Von Formschönheit bei gleichzeitiger Verzweiflung.
Von Müdigkeit, die sich den Schlaf nicht gönnt.
Es ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse von »neu-erwachsenem« Leben. Um ebenjenes Leben geht es in diesem Buch.
Als »neu-erwachsenes Leben« sind hier all jene biografischen Entwürfe begriffen, die einmal anders gedacht waren als das, was die Vorgänger gelebt haben. »Neue Erwachsene« sind diejenigen, die vor zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren angetreten sind, endlich ein paar Dinge neu zu gestalten und ein weltoffenes, selbstbestimmtes, freundliches, emanzipiertes Leben zu führen – eine Existenz, die weitgehend frei ist von Hierarchien und in der Geld, Geschlecht und Geburtsurkunden, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle spielen.
Jene Leute dürften heute, grob gerechnet, zwischen 30 und 45 Jahre alt sein. Lang befreit vom wirtschaftswunderdeutschen Spießer-Muff, entwachsen auch der Theorie-Wut der Achtundsechziger und der Honecker-Agonie, nahmen sie die Einladung zum spielerisch-ambitionierten Umgang mit den »vielfältigen Möglichkeiten« der späten neunziger und frühen nuller Jahre begeistert an. Sie stellten einst die erste große Praktikantenschwemme und die Vorhut des forcierten Quereinsteigertums. Die Selbstverwirklichung war für sie ein ehrfürchtig bis lustvoll, ernsthaft bis verwegen verfolgtes Ideal. Manche tauften ihre Abenteuerlust von Anfang an etwas übermütig »Unternehmergeist«.
Inzwischen sind die Verheißungen des »vielfältigen Lebens« für viele allerdings in ein barsches Funktionierenmüssen gemündet, und den meisten entfährt nur mehr ein böses Keckern, wenn sie das Wort Selbstverwirklichung irgendwo hören oder lesen. Manche haben die ersten Not-Runden beim Amt gedreht, als »Aufstocker« oder Interims-Hartzer, mit Doktortitel, Fachabitur oder respektabler Ausbildung im Rücken. Ihre Ideen und Ideale gibt es längst im Sonderangebot zu kaufen, als T-Shirt-Aufdruck und Magazin-Booklet, als Ratgeber-DVD und in Seifenform. Oft sind sie es selbst, die ihr Innerstes durch eine Marktforschung jagen, verbraucherfreundlich aufbereiten und in den immerwährenden Warenkreislauf einspeisen, in irgendeiner Nische der sogenannten Kreativwirtschaft, und im Grunde hassen sie sich dafür. Den eigenen Praktikanten bezahlen sie nichts mehr, mal wollen, öfter können sie nicht. Was einst als Lebenskunst gedacht war, ist zur Überlebenskunst verkommen. Die eigene Biografie: ein knallhartes Geschäft. Der eigene Standort: anhaltend unbestimmt. Die Mitte des Lebens: von einem Break-even weit entfernt. Gut ein Jahrzehnt der verschärften Flexibilisierung liegt hinter den neuen Erwachsenen, zehn, fünfzehn Jahre unberechenbares Leben – ein Heranreifen, das auf ungeahnte, oft ungewollte und schier unentrinnbare Art vom Faktor »Arbeit« bestimmt ist. Angestellte, die ahnen, dass ihr Job nächsten Monat weg sein könnte oder die selbst Kündigungen aussprechen müssen, Ausgegliederte, die verzweifelt wieder Anschluss suchen, Minijobber wie Umschüler, insbesondere die Selbstständigen haben verstanden: Nicht der Beruf ist das Leben, sondern das Leben ist jetzt der Beruf. Irgendwie war das früher aber einmal ganz anders gedacht.
Konstante Selbsterfindung, -optimierung und -überarbeitung ist kein freiwilliges Vergnügen für Wagemutige mehr, sondern jetzt Staatsbürger(innen)pflicht – und das Attribut kreativ bedeutet oft nichts anderes als »marktgängig« und »verwertbar«. Zehntausende einst hoffnungsvoll gestartete Freelancer sind über die nuller Jahre zu traurigen Tagelöhnern geworden. Ob freie Grafiker, Sprachlehrer, PR-Assistenten, Miet-Pflegekräfte, Veranstaltungstechniker, Programmierer, Fotografen oder Leih-Lohnbuchhalter: Sie unterbieten sich gegenseitig bei den Honoraren und im Verschenken ihrer Ideen, Rechte und Patente. Und diejenigen, die weiterhin festangestellt arbeiten, sehen sich oft gezwungen, den sogenannten Kostendruck an Gleichaltrige weiterzugeben. Während sie vielleicht um ihren eigenen Job bangen, müssen sie Honorarkürzungen, Umstruktierungsmaßnahmen, Kostenpoker verwalten – und werden nicht selten für die Illoyalität gegenüber den freien Zuarbeitern belohnt. Viele sind mehrfach von der einen auf die andere Seite gewechselt und wieder zurück. Befristet, verliehen, überraschend mal wieder gebucht: Der Alltag vollzieht sich konstant auf Zuruf und wird, in seiner oft unfreiwilligen Beliebigkeit, für viele zäh und zäher.
Oft wissen die Eltern der neuen Erwachsen, die heute Sechzig- oder Siebzigjährigen, nicht, was sie von der Lebensrealität der Nachfahren halten sollen. Viele bieten, wenn sie es können, materielle Unterstützung an, andere sehen ihre Söhne und Töchter grau und grauer werden, nicht nur auf dem Kopf, auch im Gesicht, und sagen: »Kind, du musst doch einmal zur Ruhe kommen, irgendwann. Wenigstens ein bisschen.«
So wie der Soziologe und Essayist Siegfried Kracauer (1889–1966) vor rund achtzig Jahren Die Angestellten als neue soziale Gruppe markiert und untersucht hat, so ist es heute an der Zeit, deren Nachfolger im Auge zu behalten – die...