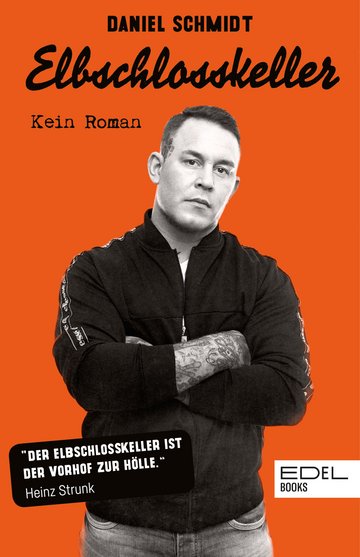Im Elbschlosskeller landen die Gestrandeten, die Erledigten, die Einsamen. Wir lassen jeden rein. Das sieht man, das riecht man auch. Ich bin 34 Jahre alt, Wirt mit Leib und Seele und mit dem Elbschlosskeller groß geworden. Ich erzähle meine Geschichte und die des Elbschlosskellers, einer Institution für verlorene Seelen. Keiner ist davor gefeit, hier zu landen.
Oft genug habe ich gesehen, wie das Schicksal genau dort zugeschlagen hat, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Tiefer runter als in den Elbschlosskeller geht es nicht, und doch geht es irgendwie weiter, manchmal auch aufwärts, nicht immer, aber es kommt vor. Bei uns kann jeder so sein, wie er ist. Wir sind eine Familie. Mal ist es leise, mal laut. Mal beängstigend, mal dreckig, mal wunderschön. Alle, die gesellschaftlich geächtet sind, gehen hier ein und aus: Obdachlose, Prostituierte, Süchtige, Kaputte. Und dann gibt es auch die anderen: Millionäre, Sozialpädagogen, Lehrer, Hausfrauen. Aber die sozialen Unterschiede lösen sich Im Elbschlosskeller auf. Hier sind alle Menschen gleich.
Vier Stufen führen runter in den Elbschlosskeller. Vier Stufen und du bist in einer anderen Welt. Jedes Mal, wenn ich da hinuntergehe, passiert etwas mit mir. Der Elbschlosskeller ist alles und nichts für mich. Heimat – ja, das trifft es. Mit jedem, der da unten hockt, fühle ich mich irgendwie verbunden. Damit meine ich unsere Stammgäste, nicht die Horden, die jedes Wochenende in St. Pauli einfallen und sich in die Seitenstraßen der Reeperbahn ergießen. Ich rede von denen, die auf dem Kiez leben und jeden Tag im Elbschlosskeller sitzen. Viele sind arbeitslos, sie kommen schon tagsüber. Andere trinken bei uns nach Feierabend ein Bier. Oder mehr. Sobald ich die Schwelle übertrete, überfallen mich die Leute. War ich ein paar Tage nicht da, heißt es: „Mensch, Daniel, du musst hier wieder mehr stehen“, und damit haben sie recht. Ich sehe mich manchmal als weißes Licht in all dem Dunkel. Das soll nicht arrogant klingen. Damit meine ich die Glut in meinem Herzen. Manchmal sitzen Leute vor mir im Elbschlosskeller, die sind kalt, deren Glut ist erloschen. Aber ich trage so viel davon in mir, dass ich denke, ich kann ihr Feuer mit meiner Glut wieder entfachen. Indem ich ihnen meine Energie und mein Mitgefühl gebe. Als ich mit 18 hinter der Theke anfing, hieß es immer noch: „Lothar, Lothar!“ Damit war mein Vater gemeint. Jahrzehntelang war er der Zampano im Elbschlosskeller. Er hat den Laden zu dem gemacht, was er heute ist.
Die Menschen im Elbschlosskeller, von denen ich erzählen werde, brauchen einen hinterm Tresen wie mich. Viele von ihnen haben nichts. Sie waren mal wer und sind jetzt nichts mehr. Oder wie es der schöne Klaus, ein legendärer Lude aus den Achtzigern, mal gesagt hat: „Früher war ich eine große Nummer, heute nur noch eine Nummer.“ Die, die abgestürzt sind, die Verlierer des Lebens, die hinauskatapultiert wurden, ins Abseits, auf die Verliererseite – sie kommen nicht nur in den Keller, um ihr Bier zu trinken. Klar gehört das dazu, aber was sie vor allem suchen, ist Geborgenheit. Sie wollen sagen können: „Ich trinke mein Bier zu Hause, bei einem, der meine Geschichte kennt. Einer, der selbst eine Geschichte hat.“ Ich biete ihnen dieses Zuhause, ich bin gerne ihre Familie. Es sind die Emotionen der Menschen, die mich diese vier Stufen nach unten ziehen.
Seit fast 70 Jahren gibt es den Elbschlosskeller schon. Hamburger Berg Nummer 38, schräg gegenüber vom Goldenen Handschuh. Das ist eine Menge Kiez-Geschichte. Wir sind eine der ältesten Kneipen Hamburgs. Und nicht nur das: Seit der Eröffnung im Jahr 1952 hat der Keller sieben Tage die Woche geöffnet, rund um die Uhr. Immer. Mit einer Ausnahme, das war 2016, als der Laden über mehrere Tage jeweils für einige Stunden geschlossen hatte. Grund war eine ernste Familienangelegenheit.
Im Grunde sah der Keller damals schon so aus wie heute. Anfangs gab es noch weiße Tischdeckchen und Teelichter, bis mein Vater kam und aus dem Laden eine Partyhölle machte. Ansonsten wurde kaum etwas verändert. Derselbe Tresen, dieselbe Holzvertäfelung.
Die Rückenspeckpatina an den Wänden, die gab’s damals noch nicht. Diese Wände erzählen viel. So viele Spritzer Flüssigkeit, so viel Lebensenergie, die hier abgeladen wurden. Du kommst rein und kommst nicht mehr weg, versackst. Manchmal sind hier Fremde von außerhalb, Leute mit ganz normalen Jobs, und die bleiben drei Tage lang, obwohl sie sich zunächst fragten, wo sie hier nur gelandet sind. Und dann kommen sie immer wieder. Es ist ein bisschen wie schwarze Magie. Der Hamburger Berg, unsere Straße und seine Kneipen, ist eine Art Bermudadreieck, in das es dich reinzieht wie in einen Strudel. Und der Elbschlosskeller ist das schwarze Loch, in dem man verschwindet. Eines Tages stand ein gutaussehender junger Mann an meiner Theke. Er hatte was im Kopf, stand mit beiden Beinen im Leben, hatte einen guten Job, eine eigene Wohnung, er war anders als die meisten unserer Stammkunden, das fiel mir gleich auf. Er kam wieder. Und wieder. Er sieht immer noch gut aus, aber inzwischen ist er obdachlos. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich fragte ihn, warum er zu uns komme, und er meinte, der Elbschlosskeller sei ein Ort, an dem er für voll genommen werde: „Ich habe mich in meinem Leben noch nie so frei gefühlt.“ Keine Pflichten mehr, in den Tag hinein leben, nicht an morgen denken müssen. Das sei zwar kein Zustand auf Dauer, irgendwann wolle er wieder einen Job, eine Wohnung, aber jetzt nicht, jetzt genieße er seine Situation und lasse sich einfach treiben.
Elbschlosskeller in den Siebziger Jahren
In meinem eigenen Leben war es oft genauso. Wenn mich etwas richtig zurückgeworfen hat, ist daraus etwas Neues entstanden. Die schönste Blume wächst im tiefsten Schlamm, sagt man. Wie Phoenix aus der Asche. Als meine kleine Schwester starb, verpasste mir die Trauer einen so krassen Energieschub, dass ich sechs Tage die Woche zum Thaiboxen gehen musste. Ich hatte damals die beste Fitness meines Lebens. Ich war vom Kopf her stark und klar wie nie zuvor, begann eine Lehre, direkt nach Janas Tod, schrieb Bestnoten in der Berufsschule, zog wieder zu meiner Mutter, unser Verhältnis besserte sich. Ich wohnte spartanisch, verzichtete auf vieles, was mir bis dahin wichtig erschienen war. Ich besaß zwei Paar Schuhe, zwei Hosen, zwei T-Shirts, ging jeden Abend zur gleichen Uhrzeit ins Bett und stand früh am Morgen auf, funktionierte wie ein Uhrwerk. Körper, Geist und Seele waren eine Einheit. Damals war ich 26. Und Ähnliches sehe ich im Elbschlosskeller, dieses Von-oben-nach-unten und Von-unten-nach-oben, Genie und Wahnsinn, Hass und Liebe, hell und dunkel – das eine bedingt das andere, so unterschiedlich und trotzdem gleich. All das erlebst du im Keller. Es ist der tiefste Abgrund, aber hier zeigen sich auch die schönsten Dinge. Liebe, Glück. Hier finden Menschen zusammen, manche haben bei uns sogar geheiratet. Die, die nichts besitzen, teilen ihr Weniges. Ich habe Menschen kennengelernt, die, obwohl sie keinen Schuh am Fuß, keinen Cent in der Tasche hatten – ihr letztes Hemd für einen anderen gaben. Du siehst ihnen an, dass sie tagelang nichts gegessen haben. Irgendwie kriegen sie schließlich das Geld für ein Dreieckssandwich von Penny zusammen, dann kommt jemand, der ähnlich fertig ist, und dem geben sie die Hälfte ab. Solche herzergreifenden Momente erlebe ich tagtäglich. Viele, die zu uns kommen, sind so tief unten. Alles wurde ihnen genommen, die Klamotten, die Wohnung, die Familie, die Würde, sie waren im Knast, wurden missachtet, misshandelt. Nicht wenige von denen waren aber auch mal ganz oben. Firmeninhaber mit Familien, wie sie im Bilderbuch stehen, eine einzige Idylle. Und dann stranden sie im Elbschlosskeller.
Es gibt diese Tage, an denen 30 Gestalten vor dir sitzen. Die schmutzig sind, die nicht gut riechen, gespenstisch aussehen, sich über Blödsinn unterhalten und rumstreiten. Und auf einmal ist da ein Moment von Nächstenliebe, ein Gefühl, das jemand ausstrahlt und das von den anderen empfunden wird. Plötzlich sitzen sie zusammen, teilen ihr Bier und sind glücklich wie am Weihnachtstisch. Sie eint ein Gefühl, das sie von früher kennen und nach dem sie sich zurücksehnen.
Die Geschichte des Elbschlosskellers ist untrennbar mit der Geschichte meiner Familie verbunden. Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter: „Wenn dein Vater mal ein Buch über den Elbschlosskeller schreibt, das wird ein Bestseller.“ Ohne zu wissen, was ein Bestseller ist und was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, sagte ich: „Mama, ich schreibe eins, wenn ich groß bin.“ Meine Mutter lächelte und meinte: „Ja, du schaffst das, aber nur, wenn du auch daran glaubst.“ So war sie immer. Ein optimistischer Mensch, sehr lebensbejahend. Bis sie krank wurde und ihre Psychosen einsetzten. Aber damals hatte sie ein besonderes Funkeln in ihren Augen und strahlte eine Energie aus, die mich glücklich machte.
Von klein auf war mir klar, dass es bei uns zu Hause anders zuging als in anderen Familien. Ganz deutlich spürte ich das, wenn ich Schulfreunde besuchte. Wir wohnten in einem schönen Hamburger Vorort, aber das Rotlichtviertel von St. Pauli, die Reeperbahn, wo meine Eltern ihr Geld verdienten, war nicht zu leugnen. Wir fielen auf. Allen voran mein Vater. Er war eine echte Erscheinung. Von seiner Optik, den Klamotten, der Frisur, von seinem ganzen Gehabe her. Ich war fünf Jahre alt, als er sich einen Opel Lotus zulegte. Schwarz mit gelben Highlights, Ledersitzen, einem kleinen Lenkrad, Highend-Ausstattung. „Das ist die schnellste Limousine der...