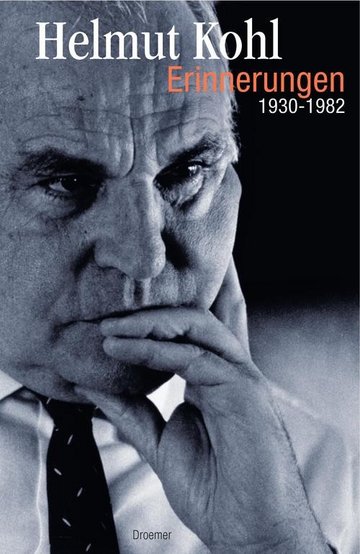1.
Kindheit
Ich bin ein klassisches Beispiel dafür, welchen Einfluss das Elternhaus hat. Mein Großvater Josef Schnur, der 1930 kurz vor meiner Geburt in Ludwigshafen starb, entstammte einer Bauern- und Lehrerfamilie aus dem Hunsrück. Zu Beginn der achtziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts studierte er in Trier an der Präparandenanstalt, wie man damals eine Pädagogische Akademie nannte. Nach dem Ende seiner Ausbildung fand er aber im Gefolge des Kulturkampfs keine Anstellung im preußischen Trier. Er bewarb sich dann mit Erfolg in der liberalen bayerischen Pfalz um eine Stelle an der Volksschule von Friesenheim. Das Dorf am westlichen Rheinufer, das mein Heimatort werden sollte, wurde wenige Jahre später, 1892, von der Stadt Ludwigshafen eingemeindet, die durch den Aufstieg der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) eine ungeheuer dynamische Entwicklung nahm.
Mein Großvater heiratete 1889 eine Bauerntochter aus Friesenheim und gründete eine Familie. Bis zu seinem Lebensende blieb er Lehrer und leitete die Volksschule in Friesenheim. Das Haus, das er 1890/91 baute und das später mein Elternhaus wurde, lag damals am Stadtrand. Mein Großvater hatte es auf Zuwachs berechnet. Es verfügte über sieben Zimmer, Küche und Keller, kleine Nebenräume, einen großen Speicher und vor allem über einen großen, weit über hundert Meter langen Garten, in dem er neben Hühnern und anderen Haustieren auch Bienen hielt. Es war, wie damals üblich, ein Nutzgarten, in dem alles angebaut wurde, was man im eigenen Haushalt benötigte. Besonders stolz war der Großvater auf seine vielen Obstbäume, über vierzig an der Zahl. Er selbst war ein Meister im Okulieren, im Veredeln von Obstbäumen.
Mein Großvater liebte die Musik. Er spielte die Orgel in der katholischen Kirche und dirigierte viele Jahre lang den Kirchenchor von Friesenheim. Er war eine allgemein anerkannte, angesehene Respektsperson, was ich als Enkel noch oft erfahren durfte. Er galt als gewissenhaft, ernst, fleißig und fromm, war aber als Lehrer auch ein Mann von großer Autorität.
* * *
Mein Vater, Hans Kohl, stammte aus Unterfranken in Bayern, aus einer bäuerlichen Familie mit elf Kindern. Er wurde 1887 in Greußenheim bei Würzburg geboren. Mein Vater drückte in Greußenheim die Schulbank, nur wenige Jahre nach Adam Stegerwald, dem bedeutenden Sozialpolitiker der Weimarer Republik, der aus einem Nachbarhaus stammte und es bis zum preußischen Ministerpräsidenten und zum Reichsarbeitsminister bringen sollte. 1906, im Alter von neunzehn Jahren, rückte mein Vater bei der bayerischen Armee ein. Er kam in ein Regiment nach Landau in der Pfalz, wurde Berufssoldat, sammelte im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 mehr als genug Fronterfahrung und kehrte als Oberleutnant zurück.
Für meinen Vater, wie für viele seiner Kameraden, war der Erste Weltkrieg eine wichtige und tief prägende Erfahrung. An verschiedenen Abschnitten der Westfront hat er den Krieg in seiner ganzen Brutalität erfahren. Es gehört zu unserer Familientradition, dass meine Mutter, als beide schon in hohem Alter waren, wiederholt davon berichtete, wie mein Vater nachts noch immer aus dem Schlaf aufschreckte und »Angriff!« befahl. Das Trauma eines Soldaten blieb bei ihm zeitlebens präsent.
Bei Kriegsende 1918 war mein Vater Kompaniechef in einer Transporttruppe. Da die Armee abgerüstet wurde, wechselte er als Steuersekretär zur bayerischen Finanzverwaltung. 1920 heiratete er Cäcilie Schnur, meine Mutter, die er schon vor dem Krieg in der Pfalz kennengelernt hatte. Meine Eltern wohnten mehrere Jahre in Gerolshofen in Unterfranken. Nach dem Tod meines Großvaters Josef Schnur zogen sie nach Ludwigshafen, in die Heimatstadt meiner Mutter. Die Ehe war mit drei Kindern gesegnet. Den Anfang machte 1922 meine Schwester Hildegard. Ihr folgte vier Jahre später mein Bruder Walter. 1930 wurde ich als das jüngste der Kinder in Ludwigshafen geboren – zu einer Zeit, als unsere Familie bereits im Friesenheimer Haus des Großvaters heimisch geworden war.
In diesem Haus an der Hohenzollernstraße – heute eine der wichtigsten Straßen Ludwigshafens, zu Großvaters Zeiten nur ein Feldweg – fanden wir ausreichend Raum und Bewegungsmöglichkeiten. Der weitläufige Garten grenzte ans freie Feld. Hier hatten wir drei Geschwister eine gute Zeit. Wir wuchsen gemeinsam auf, obwohl der Altersunterschied nicht gering war. In diesen Jahren sind zwischen uns Bindungen gewachsen, die das ganze Leben anhielten.
* * *
Das Gehalt eines Finanzbeamten schuf eine ausreichende materielle Basis – mehr aber auch nicht. Entsprechend lautete ein Prinzip meiner Eltern: Man muss nichts vererben, aber wichtig ist für die Kinder eine bestmögliche Ausbildung. Wir hatten keine Sorge um das tägliche Brot, es reichte auch zum Sonntagsbraten, aber wir lebten gezwungenermaßen sparsam und bescheiden, immer in dem Bewusstsein, dass das Geld nicht auf der Straße liegt, sondern hart erarbeitet werden muss. Es war ein typischer kleiner Beamtenhaushalt wie Millionen andere. Was man hatte, schien verhältnismäßig sicher, das Gesetz des Maßhaltens, des Einschränkens, des Verzichtens war aber immer gegenwärtig. Es regulierte den Alltag von morgens bis abends. So musste ich natürlich die abgelegten Kleider und Schuhe meines älteren Bruders auftragen, bis meine Füße länger waren als seine und ich zum ersten Mal ganz neues Schuhwerk bekam. Mutter ging meistens erst dann zum Markt, wenn die Händler ihre Stände schon abbauten und die Preise für ihre Ware senkten.
Gegessen wurde, was auf den Tisch kam: werktags Mehl- und Eierspeisen, freitags Fisch, am Samstag Eintopf und nur zweimal die Woche Fleisch. Meine Mutter war eine ausgezeichnete Köchin, und unser Garten lieferte viel an frischem Gemüse, Kräutern und Salaten, an Rhabarber, Beeren und Obst. Der Garten diente schon seit Großvaters Tagen auch der Tierhaltung. Hühner und Puten gehörten gewissermaßen zum Haushalt, ebenso Kaninchen, die ich als Kind frühzeitig zu versorgen hatte. Täglich musste ich Futter für sie suchen. Ich wurde zeitweilig ein passionierter Kaninchenzüchter. Auch in der Seidenraupenzucht habe ich mich versucht, angelockt von den zwanzig Mark, die ein Kilo Kokons einbrachte.
Für große Festivitäten fehlte unserer Familie das Geld, Theater- und Konzertbesuche waren die Ausnahme. Ein Rundfunkapparat, der »Volksempfänger«, kam erst in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre ins Haus. Nur bei Schnee und Eis leistete Vater sich eine Straßenbahnkarte. Von einem Auto hätte er nicht einmal zu träumen gewagt. Den Urlaub verbrachte er zu Hause, meist im Garten arbeitend. Allenfalls fuhren wir einmal zu unseren bäuerlichen Verwandten in Unterfranken. Aber auch dort hieß es dann »zufassen und mithelfen« – ein Gebot, das auch für uns Kinder galt. Weil wir für Reisen kein Geld hatten, machten wir »Ferien auf dem Bauernhof«, wie man heute sagen würde. In einer Mühle kamen wir unter. Dort war ich von 1936 bis 1941 jeden Sommer in den Ferien, zunächst mit meinem Vater und meinem Bruder, später fuhr ich dann allein mit dem Bummelzug von Ludwigshafen nach Würzburg, übernachtete dort bei einem Onkel und verbrachte anschließend vier Wochen lang eine wunderschöne Zeit in der Mühle mit Bauernhof. Es gab alles: Pferde, Kühe, Schweine, Tauben, Gänse, Enten. Es war ein Paradies, und ich war sehr gerne dort. Überhaupt hatte ich eigentlich eine Kindheit, wie man sie sich nur wünschen kann.
Auch die Feste in meinem Elternhaus waren dem Gesetz des Maßhaltens unterworfen. Zwar bekam ich schon zu meinem fünften Geburtstag ein Fahrrad geschenkt, aber da handelte es sich um einen Gelegenheitskauf, es war gebraucht und kostete nur acht Mark; mein Vater hielt jede Art körperlicher Betätigung für sinnvoll und gesund. Das nächste größere Geschenk erhielt ich zur Erstkommunion – eine Uhr, die natürlich nicht getragen, sondern sorgfältig aufgehoben, »für später« geschont wurde. Was sonst auf den Gabentisch kam, sei es zum Geburtstag, sei es zu Weihnachten, waren meist »praktische Sachen«, die ohnehin gekauft werden mussten: Pullover, Hemden, Socken. Einmal, zu Weihnachten, erhielt ich allerdings eine mittelalterliche Ritterburg.
An meinen Geburtstagen hatten wir immer ein volles Haus. Alle meine Spielkameraden stellten sich dann pünktlich ein. Ich hatte viele Freunde, schon weil unser großer Garten und das angrenzende freie Feld an der damaligen Stadtgrenze zu ausgelassenen und lautstarken Spielen lockten. Mutter, die meine Geburtstagsgäste, wie das Ritual es vorsah, mit Unmengen von selbstgebackenem Kuchen und heißem Kakao versorgte, kannte sie fast alle, die meisten allerdings nur mit ihren Spitznamen. Später, als sie erwachsen waren, kombinierte sie diese Spitznamen mit der Anrede »Herr …«. So kamen Bezeichnungen wie »Herr Stalin« dabei heraus.
Am feierlichsten wurde natürlich das Weihnachtsfest begangen. Die Vorbereitungen begannen schon Wochen vorher und erzeugten jene merkwürdige Unruhe und Geschäftigkeit, die vor allem uns Kinder in Spannung und Vorfreude versetzte. Noch heute erinnere ich mich der Abende, an denen das unerlässliche Festgebäck entstand: Lebkuchen, Spritzgebackenes, Zimtwaffeln. Das ganze Haus duftete nach Mandeln und Vanillezucker, nach Zitronat und zerlassener Butter, und schon der frische Teig schmeckte köstlich. Er vor allem – und der Karamelpudding – ist es gewesen, der meine Neigung zu Süßspeisen geweckt hat.
Meine Erinnerung an die Weihnachtsabende in unserem Elternhaus ist frisch und lebendig. Sie begannen traditionell mit dem Besuch der Christmette. Zu Hause lasen Vater oder...