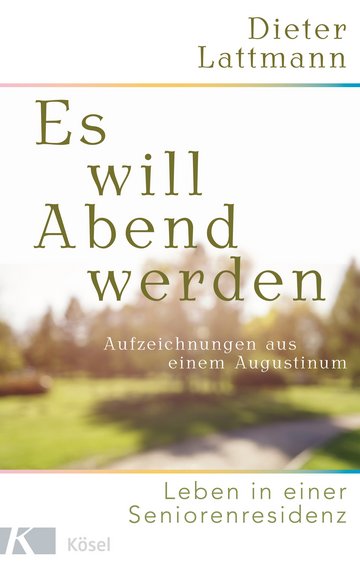Christel
Sie hieß Christa, alle Freundinnen nannten sie nur Christel. Sie gehörte zu den seltenen Menschen, die einen Raum heller erscheinen lassen, wenn sie eintreten. Christel war im Jahr vor uns in das Augustinum München Nord eingezogen. Auf unser Nachrücken hatte sie sich gefreut, und sie war einer der ersten Menschen, die wir, neu angekommen, auf dem Weg vom Mittagessen zum Fahrstuhl von Haus 5 trafen. Wir umarmten einander. Als ich sie vor Freude, sie wiederzusehen, leicht an mich drückte, spürte ich, wie dünn, ja zerbrechlich sie inzwischen geworden war.
Marlen und sie gehörten zu einem Gesprächskreis von acht Frauen, der sich seit zwei Jahrzehnten bei seiner Gründerin in deren Wohnung traf. Von Zeit zu Zeit wechselte die Rolle der Gastgeberin, und das ging reihum. Jede war ein Charakter für sich. Christel erschien mir immer als die stillste von ihnen, wenn sie auch manchmal hell auflachte oder sich energisch gegen eine Zumutung wehrte. Sie konnte von innen her leuchten. Alles an ihr war hell: das gerundete, jedem neuen Gegenüber freundlich zugewandte Gesicht, das Haar, ihre Stimme, oft auch die Kleidung. Sie war klein, gerade und zart, körperlich ein Leichtgewicht, aber mit einem großen Herzen. Ganz aus sich heraus und unvergleichbar war Christel ein sehr lieber Mensch. Sie begegnete allen, die sie kennenlernte, mit einem Vertrauen, das ihr angeboren wirkte. Bei den Gesprächen, für die in der Regel ein allseits für wichtig befundenes Thema aus dem Zeitgeschehen, sozialen Konflikten und persönlichen Empfindungen vereinbart wurde, verhielt sich Christel oft schweigend. Gleichzeitig aber behielt sie auch in der Stille ihren eigenen Kopf. Plötzlich konnte sie sagen: »Das sehe ich anders.« Was sie dann aussprach, bewies jedes Mal, wie genau sie zugehört hatte. Und sie trug eine überraschende Ansicht des eben diskutierten Themas vor.
Christel und ihr Mann erkundeten auf ihren Ferienreisen viele ferne Länder. Es war ihre gemeinsame Leidenschaft, die sie immer wieder fortzog aus ihrem Haus in der Toni-Pfülf-Straße. Sie wohnten mit ihren zwei Töchtern und einem Sohn dicht am Fasaneriesee, da schwamm die ganze Familie oft schon am frühen Morgen.
Christels Mann war vor einigen Jahren einen bitteren Tod gestorben. Auf dem Westfriedhof hatten wir uns in einer zahlreichen Trauergemeinde von ihm verabschiedet. Christel war sich ihrer bleibenden Nähe zu ihm gewiss, sie überließ sich kaum spürbar der Traurigkeit. Sie sprach immer wieder mit Freude von ihrem langen gemeinsamen Leben.
Im Augustinum wohnte Christel hoch droben im 13. Stock. Als wir sie dort zum ersten Mal besuchten, schien die Sonne zu den Fenstern herein. Der Ausblick ging über den Stadtrand und weite Grünflächen bis zu den Alpen. Hier stellte sich heraus: Christel hatte sich nicht entschließen können, ihr Haus zu verkaufen. Das war ein Fehler. Vor allem wollte sie die in ihrem gemeinsamen Lebenshaus für sie noch ständig greifbare Gegenwart ihres Mannes Willi nicht versäumen. Obendrein hing sie weiter fest an der ihr so vertrauten Nachbarschaft.
Also pendelte sie immerzu zwischen Damals und Heute hin und her. Das lief auf eine dauernde Doppelrolle hinaus, und sie wusste wohl selber nicht immer genau, wo sie sich aufhielt. Vermutlich hat diese zerissene Existenz dazu geführt, dass ihr Herz ihr zunehmend zu schaffen machte. Sie musste sich mehrfach in einem Krankenhaus behandeln lassen. Dadurch sahen wir sie für längere Zeiten nicht. Als wir ihr eines Tages wieder auf dem Weg zum Speisesaal begegneten, erschraken wir, wie verfallen sie war: Aus Christel war ein Pflegefall geworden. Sie wurde im Rollstuhl gefahren. Als sie zu uns emporschaute, lief aber doch ein freudiges Erkennen über ihr Gesicht. Nun waren wir alarmiert.
Marlen hat Christel gleich am nächsten Tag auf ihrem Zimmer besucht. Keine Klage kam über ihre Lippen. »Ich habe es gut, ich werde liebevoll gepflegt.« Christel war tief erfüllt von einer Dankbarkeit, die ihr ganzes Leben einschloss. Gewiss sah sie klar vor sich: Es ging dem Ende zu. Für uns folgte eine versiegelte Zeit. Was konnten wir tun? Immer gab es diesen Zwiespalt zwischen unserer Scheu, bei ihrer Pflege zu stören, und dem Bedürfnis, ihr zu helfen.
Christels jüngere Tochter, die in Traunstein wohnte, kam jetzt öfter und blieb über Nacht bei ihrer Mutter. Sie und ihre ältere Schwester, die entfernt im Norden lebte, wechselten sich mit ihren Besuchen ab. Manchmal war uns, als könnten wir durch die Stockwerke wahrnehmen, wie es droben um Christel stand. Rätselhafte Wartezeit.
Es war hoher Sommer, aber wie oft in Bayern, kühlte sich das Wetter plötzlich ab, als habe es auf der Zugspitze geschneit: Wieder einmal wehte über München Eisschrankluft. Ich merkte in diesen Tagen, wie das Haus für mich hellhöriger wurde. Jedes Rattern in der leer stehenden Wohnung über uns, die für Neueinziehende renoviert wurde, drang zu mir wie ein Grollen. Gespräche, auf dem Flur geführt, schienen durch die Tür hereinzuschäumen, mit einem Wellenschlag der Silben. Das Telefon läutete nicht, es dröhnte. Meine Frau und ich sahen einander oft schweigend an.
Christels Schicksalstag wurde der 10. September. Die jüngste Tochter und eine Freundin waren bei ihr, neben der Pflegerin und dem Gärtner aus ihrer früheren Nachbarschaft, der sich aus Anhänglichkeit treu um sie kümmerte. Er war ein kräftiger Mann, der sie leicht auf seinen Armen tragen konnte. Am Nachmittag war die Sonne wieder sommerlich zum Vorschein gekommen.
Als Christel sah, wie das Licht zu ihren Fenstern hereinbrach, hielt ihr geplagtes Herz sie nicht mehr zurück. »Bitte bringt mich noch einmal hinunter ins Freie«, wünschte sie sich, »ich möchte so gern die Blumen sehen.«
Die kleine Gruppe führte sie im Rollwagen in den Park. Die vier berichteten später, Christel sei beim Anblick der blühenden Pracht der Rosenstöcke und des Blätterspiels zwischen Helligkeit und Schatten und so viel sonnenvergoldetem Grün selber noch einmal aufgeblüht. Sie sah die Kinder, die auf dem Nashorn herumkrabbelten, und sie war glücklich. Sie konnte jetzt wieder etwas freier atmen und wandte ihren Blick von einer Seite zur anderen, um all das Wunderbare in der Natur zu erfassen. »Wie gut mir das tut!«
Der Nachmittag träumte, als stünden die Uhren still. Wie in die Luft gezeichnet spürten die, die um sie waren, das Überwirkliche, das auf sie einwirkte, und sie waren erstaunt, dass es auf diese Weise sein durfte, ohne Wehmut. Schließlich bat Christel: »Nun bringt mich wieder hinauf. Ich kann nicht mehr.« Oben auf dem Zimmer wollte sie nur noch liegen, und sie wurde auf ihrem Bett mit einer leichten Decke umhüllt. »Ich bin so dankbar«, hörten sie Christel sagen. Ihr Atem ging leise und stockend, bald immer langsamer. Es kam nur noch ein Laut von ihr, nicht mehr klar zu verstehen. Ihr Leben verging zuletzt wie ein Hauch. Am Abend, ein Viertel vor 6 Uhr, ist sie gestorben.
Marlen wurde hinaufgerufen, damit sie sich von Christel verabschieden konnte, ich begleitete sie. Meine Frau beugte sich nah hinunter zum Gesicht ihrer Freundin und verharrte einen Augenblick lang.
In der ersten Nacht blieb die Tote noch dort aufgehoben. Am Sonntagmorgen wurde sie von der Stiftspfarrerin ausgesegnet. Wir sahen und hörten ihr zu. Sie ist eine kluge Frau. Ihre persönlichen Worte erreichten mich stärker als das Ritual, das ich respektiere. Wir waren gemeinsam dankbar, dass es die Pfarrerin unseres Vertrauens war, die Christel den Segen gab und für sie betete, während unsere Gedanken sich um sie versammelten und wir Christel mit unserem inneren Auge noch einmal lebendig vor uns sahen.
Als wir Nichtangehörigen den Raum verließen, wussten wir, die Tote wurde nun in die Tiefe des Hauses gebracht und von dort später auf den letzten Weg geleitet, für den die Familie sich entschieden hatte. – Das Requiem wurde, ebenfalls durch unsere Pfarrerin gestaltet, auf den Freitag danach festgesetzt, damit die Angehörigen Zeit für die Anreise und alle notwendigen Vorbereitungen erhielten. Die Kapelle füllte sich mit der Familie, Verwandten, Freunden und teilnehmenden Hausbewohnern. Blumenumkränzt glänzte Christels Bild neben dem Altar im Kerzenschein. Die Predigt stellte sie noch einmal mitten unter uns. Christel in ihrer ganzen Lebensstärke und ihrer unbegrenzten Fähigkeit zu Liebe und Freundschaft. Diesen kundigen und sehr bedachten Nachruf zu hören, tat uns allen gut.
Christel war die Erste aus dieser Gruppe, die starb. Alle Freundinnen aus dem Kreis waren zur Trauerfeier erschienen. Sie kamen danach mit in unsere Wohnung, um zu erfahren, wie wir wohnten und ob wir uns schon etwas eingelebt hatten. Sie erkannten die Sitzecke aus der Wohndiele in unserem Haus wieder. Wir freuten uns, dass es ihnen bei uns gefiel.
Dieser Tod hinterließ uns beiden einen tiefen Eindruck, er wurde zu einem spirituellen Sammelpunkt. Das hatte eine geistige und eine praktische Bedeutung. Es gibt wohl keine Erfahrung eines nahen Todes, die nicht die Vorstellung des eigenen Lebensendes wachruft. In unserem Denken würde uns dieses Erleben nun immer mit der Erinnerung an Christel begleiten. Für unsere realen Überlegungen trat die Gewissheit ein, dass wir es mit zwei Entscheidungen richtig gemacht hatten: zum einen mit unserem Einzug in das Augustinum, zum anderen mit der absoluten Trennung von unserem Haus und damit dem tatsächlichen Loslassen von allem, was wir nicht mitnehmen konnten.
Es war für uns wichtig, so bald nach unserem eigenen Umzug den Ablauf von ernsthaftem Krankwerden, ärztlichen Behandlungen, Krankenhaus und Wiederkehr, letzter Lebensphase, Sterben und Tod so handgreiflich miterlebt zu...