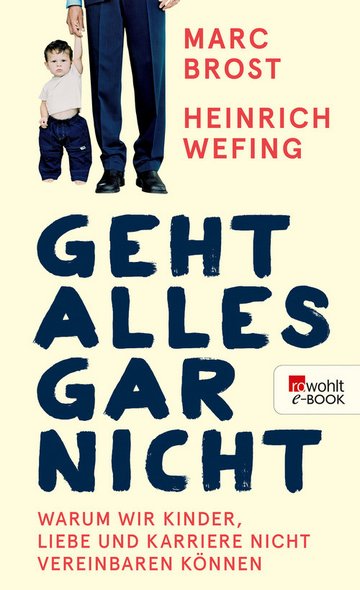Kapitel 1 Väterglück
Sonntagmorgen, ein Bolzplatz irgendwo in Deutschland. Wie jedes Wochenende kickst du mit anderen Vätern gegen die Jungs. Dein Sohn hat sich seit Tagen auf dieses Spiel gefreut und du dich auch. Du hast dich um halb acht hochgequält, obwohl du gern ausgeschlafen hättest, wenigstens einmal diese Woche. Du hast den Kaffee heruntergestürzt, hast deine Sportsachen aus dem Wäschekorb gefischt, Wasserflaschen gefüllt und fluchend seine kleinen Schienbeinschoner gesucht.
Jetzt steht ihr beide auf dem Platz, der Rasen ist noch feucht, die Sonne kommt langsam durch. Dein Sohn rennt, er kämpft, er strahlt, seine Wangen sind feuerrot. Du spielst auch mit, irgendwie. Aber in Wahrheit ist es nur eine Hülle, die da spielt. Denn mit deinen Gedanken bist du ganz woanders. Bei der Mail deines Vorgesetzten, die kurz vor Spielbeginn angekommen ist. Beim nächsten Meeting, am Montagmorgen. Bei deiner Arbeit, die du dir mit ins Wochenende genommen hast, wie so oft in der letzten Zeit.
Und dann kommst du nach Hause und fragst dich, warum es schon wieder nicht möglich war, sich so richtig einzulassen auf das Spiel. Warum du wieder nicht abschalten konntest. Und dabei hörst du gar nicht, wie dein Sohn von dir wissen will, ob du eigentlich das Tor gesehen hast, das er vorhin geschossen hat. Erst als er an deinem Ärmel zerrt und noch mal fragt, horchst du auf.
Jeder Gedanke an die Arbeit, jeder unaufmerksame Moment ist ein kleiner Verrat. Wieder eine Minute, die du für den Job opferst, obwohl du doch fest versprochen hattest, an diesem Wochenende wirklich nur für die Familie da zu sein. Wieder diese Zerrissenheit.
Was läuft da bloß schief? Jeder, der Kinder hat, kennt das Dilemma. Berufstätige Mütter vor allem, aber zusehends häufiger eben auch Väter. Je mehr Zeit Männer mit ihren Kindern verbringen, desto stärker erleben sie, was für Frauen mit Jobs schon lange der wichtigste Stressfaktor ist: dass der Tag immer zu wenig Stunden hat. Dass man immerzu drei, vier Dinge gleichzeitig jonglieren muss. Dass der Beruf der Familie in die Quere kommt und, ja, immer öfter auch die Familie dem Beruf.
Ständig haben wir das Gefühl, alles nur hinzuschludern, nichts wirklich richtig zu machen, nie ganz bei der Sache zu sein. Nicht im Büro, nicht in unserer Beziehung und auch nicht, wenn wir Zeit mit unseren Kindern verbringen.
Geht alles gar nicht.
Diese Erfahrung werden künftig immer mehr Männer machen. Denn immer mehr Männer helfen zu Hause mit – viele längst ziemlich selbstverständlich –, beim Einkaufen, beim Kochen, beim Wickeln, bei der Wäsche. Sie gehen mit ihren Kindern auf den Spielplatz, zum Sport und zum Arzt. Sie quälen sich durch die Elternabende, genau wie die Mütter und sitzen dabei, wenn ihre Kinder die Schulaufgaben machen. Noch ist das alles nicht gleich verteilt, keine Frage. Frauen erledigen mehr im Haushalt, deutlich mehr, aber die Schere schließt sich, der Trend ist eindeutig: Noch vor fünfzig Jahren leisteten Väter im Schnitt vier Stunden pro Woche Hausarbeit. Heute sind es immerhin schon zehn Stunden pro Woche.
Was aber noch wichtiger ist, geradezu revolutionär: Noch nie, in keiner Generation vor uns, haben Väter so viel Zeit mit ihren Kindern verbracht wie wir. Die aktuellsten Zahlen dazu stammen aus den USA. Dort stand ein Vater im Jahr 2011 im Durchschnitt dreimal länger auf dem Spielplatz oder am Wickeltisch als noch 1965. In Deutschland sind Väter ihrem Nachwuchs mittlerweile ebenfalls so nahe, wie das noch eine Generation früher kaum vorstellbar war. Es ist keine große Übertreibung zu behaupten: Wir sind die Generation Vater.
Manchmal, wenn du im Keller die alten Fotoalben aus deiner eigenen Kindheit findest und darin herumblätterst, dann entdeckst du: einen Mann, viel jünger als du selbst heute, der unbeholfen einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Einen Mann auf Skiern, den Sohn zwischen den Beinen, wie er ganz langsam die Piste hinunterfährt. Eine Fahrradtour. Ein Picknick auf einem Rastplatz neben der Autobahn. Der Mann, den du da siehst, das ist dein eigener Vater. Und natürlich würdest du gerne wissen, wie es ihm damals so ging. Ob er viel zu bewältigen hatte und wie er sein Leben als Vater und Ehemann empfand.
Aber du weißt auch: Du willst nicht so sein wie er. Du willst nicht bloß Geld nach Hause bringen und am Wochenende den Patriarchen geben – eine völlig absurde Vorstellung. Du willst mit deinen Kindern spielen, mit ihnen kochen und lernen, willst ihnen zuhören, wenn sie etwas auf dem Herzen haben, und willst sie trösten, wenn es sein muss. Wann immer es sein muss. «Was gehen mich die Kinder an, ich mach Karriere!» – das ist für uns keine denkbare Haltung mehr.
Als unsere Väter noch jung waren und wir klein, sollten Männer vor allem nützlich sein. Sie sollten den Großteil des Haushaltseinkommens verdienen; der Familie durch einen angesehenen und gutbezahlten Job sozialen Status verschaffen; die Ausbildung der Kinder finanzieren. Manchmal haben unsere Väter durchblicken lassen, wie stolz sie darauf waren, uns ein wirtschaftlich halbwegs sorgenfreies Leben ermöglicht zu haben.
«Abwesende Väter», nennt der dänische Familientherapeut Jesper Juul diesen Typ Männer. «Sie versuchten Vater zu sein, in dem sie in ihrem Heim die führende und bestimmende Funktion übernahmen, doch waren sie fast unsichtbar, emotional unerreichbar und so gut wie nie präsent.» Sie waren die einsamen Patriarchen an der Spitze des Familiengefüges.
Und wir, ihre Söhne, haben weitgehend ohne sie gelebt, als wir Kinder waren. Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hatten, dann riefen unsere Mütter, geht raus, spielen, seid zum Abendessen wieder da. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind um die Häuser gezogen und durch die Gärten. Haben Fußball gespielt, überall, wo es gerade ging, sind mit den Fahrrädern herumgefahren. Die Nachmittage waren eine endlose Zeit ohne Verpflichtungen. Und ohne Väter. Die tauchten irgendwann abends auf, mal früher, häufig später, und wollten von uns eigentlich nicht besonders viel wissen.
Das ist bei uns anders.
Denn bei aller Erschöpfung, allem Stress: Es ist wunderschön, Kinder zu haben. Sie sind das Beste, was uns je widerfahren ist. Sie bescheren uns all diese wunderbaren Momente, wenn für ein paar Sekunden die Welt stehen zu bleiben scheint und alle Last von uns abfällt.
Etwa, wenn deine kleine Tochter auf dem Bürgersteig neben dir geht und sich ihre Hand auf einmal in deine schiebt.
Wenn ihr gemeinsam Kinderfotos anschaut und du feststellst, wie unfassbar groß sie schon geworden ist. Und sie sich gar nicht mehr in dem Baby wiedererkennt, das sie doch eben gerade noch war, eigentlich erst gestern.
Wenn dein Sohn einen Nassrasierer aus Legosteinen baut und sich morgens im Bad neben dich stellt, um sich gleichzeitig mit dir zu «rasieren».
Wenn du das erste Mal mit ihm im Stadion bist, bei einem Spiel deines Lieblingsvereins – und er dich hinterher in den Arm nimmt, weil diese elende Gurkentruppe schon wieder verloren hat.
Wenn ihr gemeinsam am Ufer eines Sees steht, die Hände in den Hosentaschen vergraben, kein Wort sagt, hinaus aufs Wasser blickt und den Wolken zuschaut.
Wenn er heimlich dein Aftershave benutzt. Und ringen und boxen will. Und wenn ihr jeden Abend noch eine Kissenschlacht macht. Das sind so Momente. Und unzählige mehr.
Kinder zu haben bedeutet eben nicht nur: Stress, Stress, Stress. Es bedeutet auch: Glück, Glück, Glück. Es gibt eigentlich keine anderen Menschen, mit denen wir so gerne zusammen sind – unsere Partnerinnen einmal ausgenommen. Wir genießen die Zeit mit unseren Kindern, selbst wenn sie gerade mal nerven. Wenn sie sich streiten. Wenn sie uns mit dem ganzen aufreizenden Desinteresse, der pubertären Herablassung anschauen, zu der nur Vierzehnjährige in der Lage sind, und sagen: «Ach, Papa. Du bist peinlich.» Oder: «Eltern sind so ungeil.»
Auch unsere Väter haben uns geliebt, als wir klein waren, klar. Aber wir wollen dieser Liebe mehr Zeit und Raum geben, als unsere Väter das getan haben oder tun konnten. Warum wir uns stärker nach Nähe zu den eigenen Kindern sehnen, lässt sich gar nicht leicht sagen. Gewiss hat es mit der Auflösung der alten Rollenmodelle zu tun, mit der fortschreitenden Gleichberechtigung, vermutlich auch mit der generellen Abrüstung im Verhältnis der Generationen, die Familienforscher beobachten. Noch nie ging es zwischen den Altersgruppen, alles in allem, derart harmonisch und entspannt zu wie heute.
Einen anderen, tiefer weisenden Gedanken hat der Soziologe Heinz Bude formuliert. Er sieht im gewachsenen Bemühen der heutigen Väter um ihre Kinder einen Ausdruck von Angst, genauer: der Angst vor Einsamkeit in unserer zerfasernden Welt. Heute gibt es keine lebenslangen Arbeitsverhältnisse mehr, verschwinden große Firmen genauso rasch wie politische Grenzen. Institutionen zerbröseln, Beziehungen lösen sich, vierzig Prozent aller Ehen enden in der Scheidung. «Die einzig unkündbaren Beziehungen, die es heute noch gibt», schreibt Bude, «sind die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.»
Man bleibt Eltern seiner Kinder, auch wenn diese längst das Elternhaus verlassen und eine eigene Familie gegründet haben, «und man bleibt zeitlebens Kind seiner Eltern, auch wenn diese altersschwach und geistesverwirrt geworden sind», schreibt Bude: «Das ‹Blut ist ein ganz besonderer Saft›, es bindet noch in der Trennung und überdauert den Tod.»
Aber warum auch immer wir so gern Zeit mit unseren Kindern verbringen – es ist nie genug. Immer sitzt uns noch der Job...