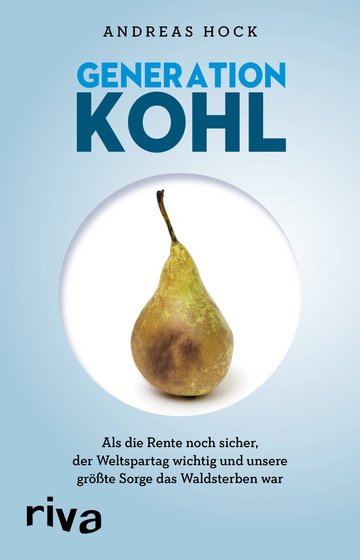Vorwort
Dass Helmut Kohl, zumindest für mich, ausgerechnet auf einem Brauereifest starb, war einigermaßen paradox. Schließlich war er bekennender Weintrinker, und es ist nicht bekannt, dass er in seinem geliebten »Deidesheimer Hof« oder irgendwo sonst jemals ein Pils oder ein Hefeweizen bestellt hätte. Aber die Nachricht von seinem Tod erreichte mich nun mal genau dort: Wir saßen zwischen einer Bühne, auf der die amtierende Hopfenkönigin einen kleinen, volkstümlichen Tanz vorführte, und einem Stand, an dem ein tätowierter Enddreißiger mit Vollbart und zwei Ohrlöchern in Untertellergröße irgendeine Craftbeer-Sorte ausschenkte, die sich »God’s own Piss« nannte und fünf Euro pro Glas kostete. Es war keine Frage, was einem Mann wie Kohl wohl besser gefallen hätte, das tanzende Mädchen mit seiner goldenen Schärpe oder die Herrgottspisse. Aber schon vor der traurigen Neuigkeit war auch ich leicht befremdet darüber, dass man selbst mit einem Bier inzwischen ungestraft Blasphemie treiben konnte. Ich betrachtete leicht beseelt die Hopfenkönigin und fragte mich ernsthaft, ob ich in den letzten Jahren womöglich ein bisschen altmodisch, bieder oder spießig geworden war. Die Antwort lautete offenbar in allen drei Punkten: Ja. Vielleicht war ich das aber auch schon immer und bemerkte es nur nicht.
Zuvor war unsere Stimmung ausgelassen. Zumindest so ausgelassen, wie sie eben sein konnte in diesen Zeiten – auf einer Veranstaltung mit ein paar Tausend dicht aneinandergedrängter, argloser Menschen. Am Eingang standen erstmals Sicherheitsmitarbeiter mit Tränengaspistolen, sie trugen Schlagstöcke und schusssichere Westen. Wir mussten unsere Rucksäcke öffnen und auf Handfeuerwaffen, Bomben oder was weiß ich für ein Zeug durchsuchen lassen, das kein normaler Mensch einfach mit sich herumtragen würde. Und auf der einzigen Zufahrtstraße hatte der Veranstalter mehrere schwere Betonpoller aufstellen lassen, um zu verhindern, dass ein Lastwagen in die Menge raste, die sich gerade gepflegt betrank.
Ich persönlich glaubte eher nicht, dass dieses Fest, auf dem ein paar Dutzend lokale Brauereien sowie ein gotteslästerlicher Rocker ihre Spezialitäten ausschenkten und auf dem sich an jedem Tag ein neuer Ochse namens Herbert an einem Grillspieß drehte, tatsächlich im Fokus des islamistischen Terrors stand. Aber man konnte heutzutage ja nie wissen – und allein die Tatsache, dass die Organisatoren derartige Maßnahmen umsetzten, war der unumstößliche Beweis, dass irgendwie etwas aus den Fugen geraten war.
Als Erster bekam Matthias die Mitteilung. Auf seinem Smartphone waren die »Push«-Nachrichten der Bild-Zeitung aktiviert, und so erhielt er alle Eilmeldungen immer sofort auf den Startbildschirm. Noch bevor Matthias etwas dazu sagen konnte, checkte Thorsten gewohnheitsmäßig wie alle ein bis zwei Minuten die Seite von Spiegel-Online und las ebenfalls im Live-Ticker von Kohls Tod. Und in Ollis Twitter-Account liefen zeitgleich die ersten Stellungnahmen anderer Politiker und weiterer besonders mitteilungsbedürftiger Menschen zu dem traurigen Ereignis auf. Vermutlich war der Altkanzler noch nicht einmal kalt, als das ganze Land bereits Bescheid darüber wusste, was da vor ein paar Stunden in Oggersheim passiert war. Es geschieht ja alles in Echtzeit heutzutage und gelegentlich sogar noch etwas schneller. Das muss man auch nicht immer unbedingt nur gut finden.
Früher hätten wir, wären wir gemeinsam auf einem Brauereifest oder ähnlich freudvollen Anlässen unterwegs gewesen, auch eine derartig wichtige Meldung allenfalls am Abend aus den »Tagesthemen« oder dem »Heute Journal« erfahren oder – wenn es mal wieder etwas später geworden war und wir ermüdet von guten Gesprächen und vermutlich fünf bis zehn alkoholhaltigen Getränken ins Bett fielen – aus der Zeitung oder dem Radio am nächsten Morgen. Nun aber saßen wir alle wie selbstverständlich mit unseren griffbereiten Mobiltelefonen am Tisch, was uns schon längst nicht mehr auffiel – und nahmen dank unserer LTE-tauglichen Datenverbindung mit dreihundert MBit pro Sekunde permanent am mal mehr und mal weniger wichtigen Weltgeschehen teil. Und wenn wir einmal nicht alle paar Sekunden im Internet nachguckten, ob sich die Erde auch wirklich noch drehte, welchen Fußballer irgendein Ölscheichverein als Nächstes für eine Ablösesumme in Höhe des Bruttoinlandsproduktes eines Dritteweltstaates verpflichten wollte oder wo sich wieder ein Arschloch in die Luft sprengte, dann fotografierten wir unser Essen und stellten es auf Facebook.
»Ach, der Kohl ist tot«, sagte Matthias.
»Weiß ich schon«, sagte Thorsten.
»Hab’s auch gerade mitbekommen«, sagte Olli.
Ich sagte nichts. Unter dem Tisch schaute aber auch ich auf mein Handy, las die Meldung und schluckte. Es stimmte also, und auch, wenn man angesichts von Kohls Zustand eigentlich seit Jahren täglich mit dieser Nachricht rechnen musste, war meine Stimmung einigermaßen im Keller. So kurios es mir auch vorkam, aber ich war tatsächlich: traurig. Ich wusste überhaupt nicht warum, schließlich stand Helmut Kohl schon lange nicht mehr im Vordergrund des öffentlichen Bewusstseins. Noch dazu war er ein Pflegefall, eine unwirklich gewordene Erscheinung aus der Vergangenheit, und ich konnte auch nicht gerade behaupten, dass ich näher mit dem Mann bekannt war – von einer, wenn auch denkwürdigen, einzigen persönlichen Begegnung einmal abgesehen. Aber in diesem Augenblick fühlte ich mich, als sei ein kleines Stück meines Lebens mit Kohl zusammen in seinem Oggersheimer Bungalow gestorben: Ich trauerte um das allerletzte Stückchen kindliche Unbeschwertheit, das von früher übrig geblieben war und das noch nicht von den zweifelhaften Errungenschaften des einundzwanzigsten Jahrhunderts wie der ständigen Erreichbarkeit, dem strapaziösen Überangebot an Freizeitmöglichkeiten oder zuletzt einer permanenten Terror-Angst verdrängt worden war.
Als ich später am Abend nach Hause kam, suchte ich in meinem Büroschrank nach einem Buch, das ich recht weit hinten fand – zwischen jenen Büchern, die ich schon längst aussortieren oder zumindest bei eBay verkaufen wollte. Es war der erste Teil der Memoiren von Helmut Kohl, die »Erinnerungen 1930-1982«. Ich wischte den Staub der vergangenen dreizehn Jahre vom Gesicht des Altkanzlers, schlug den Wälzer auf, den ich niemals über das Kapitel »Student in Frankfurt und Heidelberg« hinaus gelesen hatte, und blickte auf die Widmung, die Kohl mir einst in schnörkelloser Schrift hineinschrieb. »Für Andreas Hock, in guter Erinnerung und mit den besten Wünschen« las ich da neben dem in römischen Zahlen verfassten Datum »29. April 2004«. Dabei dachte ich nach, welche Erinnerung ich eigentlich an diesen so außergewöhnlichen wie umstrittenen Politiker besaß, an dem sich immerhin vier SPD-Kanzlerkandidaten und sechs Parteichefs die Zähne ausbissen.
***
Ich wurde 1974 geboren. Als Kohl im Herbst 1982 an die Macht kam, ging ich gerade in die zweite Klasse und begann erst langsam zu begreifen, dass das Leben nicht nur aus Spielen im Freien, der Biene Maja im Fernsehen, Sommerferien in Österreich und den Besuchen im Schrebergarten meines Patenonkels bestand. Die Bundestagswahl 1987 fand ausgerechnet in jener Woche statt, in der ich mich unsterblich in Susanne Fuchs verliebte, die kurz zuvor auf unsere Schule gekommen war; eine Liebe, die leider unerwidert blieb und die mir beinahe und zum ersten Mal das Herz aus dem Leib zu reißen drohte. Die deutsche Einheit erlebte ich dann als ungestümer Teenager, der sich anschickte, mit einem uralten und illegal fahrtüchtig gemachten Vespa-Roller wenn schon nicht die Welt, dann doch wenigstens das nähere Umland zu erobern. Den Wahlsieg über Rudolf Scharping 1994 bekam ich gar nicht live im TV mit, weil ich zu diesem Zeitpunkt die Sonntagabendschicht an der Bar im örtlichen Kino übernahm – um dringend benötigtes Geld zu verdienen, weil ich kurz zuvor von zu Hause ausgezogen war. Und Helmut Kohls unwürdiger Abgang vier Jahre später, als niemand ihn mehr wirklich ertragen mochte, markierte schließlich auch einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich hatte unmittelbar zuvor mein Jurastudium geschmissen und wollte Journalist werden.
Das alles hatte mit Helmut Kohl natürlich überhaupt nichts zu tun – und hing für mich doch auf eine seltsame Weise mit dem Bundeskanzler zusammen, der meine vielleicht wichtigsten Jahre prägte. Ob es auch die schönsten waren, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Manchmal, in besonders wehmütigen Momenten, wenn ich mich dabei ertappe, wie sich die Sorgen über die Zukunft und der Stress der Gegenwart unheilvoll miteinander vermengen, scheint es mir, als sei das Deutschland der Achtziger und frühen Neunziger ein Land gewesen, in dem in Rhein, Main und Donau kein verbracktes Abwasser, sondern Milch und Honig flossen. Ein Land ohne größere Probleme und innere Spannungen, in dem sich alle Menschen gegenseitig respektierten, jeder einer geregelten Arbeit nachging und genug Geld für alle dabei abfiel, sodass man zweiwöchige Urlaube in Italien ebenso selbstverständlich bezahlen konnte wie den neuen Nordmende-Fernseher, einen Videorecorder oder alle sechs oder sieben Jahre ein neues Auto. In anderen Momenten wiederum, beim Betrachten einiger alter Fotos aus jenen Tagen zum Beispiel, schaudert es mich beim Gedanken an diese Zeit, die grauenvolle Moden hervorbrachte, in der unser Wald zu sterben drohte und wir uns keine Pilze mehr zu essen trauten, weil in Russland ein Atomreaktor explodiert war.
Trotzdem oder auch gerade deshalb ließ sich nicht leugnen, dass Helmut Kohl für mich und wahrscheinlich viele andere...