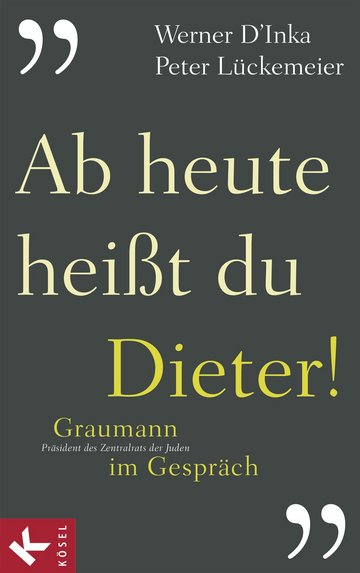3 »Ich könnte mir mein ganzes Leben nur mit Büchern vorstellen«
Studium und Beruf
Ihre Eltern haben es gern gesehen, dass Sie zunächst Jura studierten?
Ich weiß nicht, eigentlich hätten sie wohl am liebsten gehabt, dass ich Arzt geworden wäre, das ist so der Klassiker in jüdischen Familien: Der Sohn soll Doktor werden – das ist schon fast immer der Traum so vieler jüdischer Eltern gewesen.
Der Numerus clausus wäre kein Hinderungsgrund gewesen?
Nein. Aber ich bin dann nach dem Abitur ein Jahr lang nach England gegangen und habe Jura studiert. Es war für mich eine wunderbare Zeit am King’s College. Als ich nach einem Jahr nach Frankfurt zurückkam, um hier Volkswirtschaft zu studieren, erlebte ich einen enormen Kontrast, ja sogar einen Kultur-Schock. Am King’s College waren wir im ersten Jura-Semester gerade einmal siebzig Studenten; das Studium war zwar sehr verschult, aber auch sehr individualisiert. Zum Beispiel hatten wir vier Mal in der Woche im ganz kleinen Kreis »Tutorials« mit den berühmtesten englischen Juraprofessoren. Jeder Professor kannte nach ein paar Wochen jeden Studenten beim Namen. Es war einfach eine wunderbare Atmosphäre: Wir lernten und diskutierten und debattierten begeistert. Dann kam ich nach Frankfurt, wo ich Volkswirtschaftslehre studierte, und saß plötzlich in den schrecklichen, abgrundtief hässlichen Hörsälen V und VI mit über sechshundert Kommilitonen. Bis zum Ende kannte mich fast kein einziger Professor beim Namen, genau so wenig wie die anderen Studenten. Das erste Semester in Frankfurt verbrachte ich dann auch folgerichtig vor allem mit Skatspielen in der Mensa. Das war bestimmt die schönste Zeit während meines gesamten Studiums.
Warum blieben Sie nicht bei Jura und in London?
Weil mir noch klarer wurde als schon zuvor, dass ein Jurastudium immer ans Land gebunden, dass aber die englische Juristerei sogar noch viel stärker an England gebunden ist, weil das britische Rechtssystem sich mit dem auf dem Kontinent nicht vergleichen lässt. Ich habe mir, obwohl es mir in London und am King’s College wirklich sehr gut gefiel, gesagt, dass ich mit einem solchen Studium in Deutschland wenig bis gar nichts hätte anfangen können.
Und warum Volkswirtschaft?
Ich las damals viel Sigmund Freud und hätte eigentlich sehr gern Psychologie studiert. Eigentlich hätte ich das wohl auch machen sollen. Aber ich habe es halt dann doch nicht gemacht.
Sie waren zu vernünftig?
So war es. Vernünftig, aber vielleicht nicht wirklich klug. Volkswirtschaft eröffnet nun einmal viele Möglichkeiten, man legt sich zunächst auf nichts fest. Das Spektrum an Möglichkeiten nach dem Studium ist groß. Freilich war der Wirklichkeitsschock in Frankfurt an dieser ausgesprochen unschönen hässlichen Universität wirklich gewaltig. Ich beneide ein wenig die Studenten, die heute auf dem Westend-Campus studieren dürfen. Es ist heute vielleicht der schönste Campus in Deutschland, während der in Frankfurt-Bockenheim zu meinen Zeiten hässlicher kaum denkbar war.
Das Studium der Volkswirtschaft hat Ihnen keinen Spaß gemacht?
Überhaupt gar keinen. Die ersten vier bis fünf Semester lernte man Finanzmathematik, Statistik, Buchhaltung – man weiß gar nicht, wozu. Man weiß nur, dass es ziemlich scheußlich und staubtrocken ist. Und, ehrlich gesagt, mein Interesse für ökonomische Dinge hielt sich sowieso sehr in Grenzen. Ich lese ja schon seit Schülerzeiten die F.A.Z., habe aber damals den Wirtschaftsteil sofort immer ungelesen weggelegt. Erst als ich anfing, Volkswirtschaft zu studieren, dachte ich mir, das geht ja nun so nicht weiter. Dann habe ich mir drei verschiedene einzelne Aktientitel gekauft, nur um überhaupt einen Grund zu haben, überhaupt einmal in den Börsenteil zu schauen.
Dass Sie nach London gingen, war das Ihr Wunsch oder eine Anregung Ihrer Eltern?
Das war mein eigener Wunsch.
Warum England, warum nicht Amerika?
Heute gehen viele junge jüdische Leute nach Amerika, das ist richtig. Bei mir stellte sich die Frage gar nicht, Amerika war ja auch so weit fort.
Die jungen britischen Juden sagten: »I’m British first, then I’m Jewish.« Das war für mich vollkommen undenkbar.
Und ich war damals auch sehr englandaffin und schon als Schüler öfter dorthin gereist. Und dann wusste ich, es gibt in London ein intensives jüdisches Leben, das Jüdische war mir ja immer wichtig. In der Tat gab es an der Uni jüdische Studentenverbände, einen für jede Fakultät und noch einmal einen übergeordneten, und diese Jewish Society war sehr vital – etwas, wovon man in Deutschland nur träumen konnte. Ich machte dort auch eine sehr überraschende Erfahrung. Die jungen britischen Juden in London, die ich kennenlernte, sagten: »I’m British first, then I’m Jewish.« Das war für mich und meine Freunde vollkommen undenkbar. Wir konnten uns ja nicht mit Deutschland identifizieren. Da gab es immer diese Sperre, diese inneren Zweifel, das Zerrissensein. Dass ein Jude sich so mit seinem Land identifizieren konnte, das hat mich verblüfft und fasziniert. Und ich habe meine britischen Kollegen um dieses Gefühl sehr beneidet.
Der Satz »Ich bin jüdisch und Deutscher« würde Ihnen heute leichter von den Lippen gehen?
Viel leichter. Da hat sich an der Art, wie man die eigene Identität definiert und fühlt, doch viel geändert.
Wenn damals Deutschland im Fußball gegen England gespielt hat, zu wem haben Sie gehalten?
Was für eine gemeine Frage! Ich war ja schon immer begeisterter Fußballfan und kannte die deutschen Spieler allesamt sehr gut – darunter waren leider immer viel zu wenige von Eintracht Frankfurt –, insofern hielt ich aber doch zu Deutschland.
Bei dem engen Verhältnis zu Ihren Eltern müssen die doch traurig gewesen sein, als ihr Sohn mit neunzehn nach England gehen will.
Ja, das hat ihnen weh getan. Aber ich sagte ihnen, dass ich mal raus musste aus Frankfurt, auch aus dieser kleinen jüdischen Gemeinschaft. Es hat ja auch mir weh getan, sie zu verlassen, aber es musste damals einfach sein. Meine Eltern haben aber wohl auch gespürt, dass der Zeitpunkt für mich gekommen war, an dem ich Tapetenwechsel brauchte.
Als Sie beim Studium über die ersten Semester mit Statistik und Buchführung hinaus waren, hat Sie die Volkswirtschaft dann stärker interessiert?
Erst als es später um Wirtschaftspolitik ging. Mich hat die Profitmaximierung in einzelnen Unternehmen nicht wirklich interessiert, aber die Steuerung der Wirtschaft durch Konjunktur-, Geld- und Währungspolitik fand ich immer spannend und hochinteressant. Und dann hatte ich einen phantastischen Professor, der später auch mein Doktorvater war, Armin Gutowski, von dem ich so viel lernte. Er war damals im Sachverständigenrat, einer der »Fünf Weisen«. Besonders für sein Spezialgebiet Geld- und Währungspolitik habe ich mich sehr interessiert. Was mich faszinierte, war, dass ich plötzlich entdeckte: Ökonomie ist ein ganz wichtiger Teil von Politik. Provozierend gesagt: Politik hat den Spielraum, den die Ökonomie ihr lässt. Und als politisch interessierter Mensch, der ich immer war, bekam die Ökonomie so für mich auf einmal einen ganz neuen Stellenwert. Und als ich später akademischer Tutor war und selbst um die hundert Studenten unterrichtete, habe ich plötzlich Details von ökonomischer Theorie schätzen und dann endlich selbst auch zu verstehen gelernt wie nie in meinem Studium zuvor. Wer anderen etwas beibringen soll, sollte das Thema besser schon selbst auch ein wenig verstehen – das kam bei mir zwar recht spät, aber am Ende denn doch.
Wovon handelte Ihre Dissertation? Und wissen Sie den genauen Titel noch?
Natürlich: »Die Parallelwährung als europäische Integrationsalternative.« Es ging, lange vor dem Euro, um die Idee einer europäischen Währung neben den jeweiligen nationalen Währungen. Sozusagen als monetärer Motor der angestrebten Währungsintegration. Heute redet man in manchen ökonomischen Kreisen übrigens kurioserweise plötzlich wieder von einer »Parallelwährung« – freilich in ganz anderen Zusammenhängen als damals: nämlich als Instrument für eine zumindest partielle Rückabwicklung der inzwischen erreichten Währungsgemeinschaft.
Hat Ihnen viele Jahre später, als Sie die Finanzen der Jüdischen Gemeinde Frankfurt in Ordnung bringen sollten, Ihr Studium geholfen?
Geschadet hat es zumindest nicht, der Blick für ökonomische Zusammenhänge jedenfalls war geschärft. Was mich auch immer interessierte, war die Frage, wie man einen öffentlichen, staatlichen Haushalt aufstellt. Das ist von quasi-öffentlichen Körperschaften wie einer Jüdischen Gemeinde und ihrem Haushalt ja gar nicht so weit weg. Ein Haushalt hat ja immer eine politische Programmatik, die hier nur in Zahlen gegossen wird. Insofern hat mir das Studium schon genutzt. Es ist aber nur nicht so, dass einem ein Volkswirtschaftsstudium hilft, privat ökonomisch erfolgreich zu werden. Einer unserer Professoren erzählte uns immer, sein eigener Doktorvater, ein in der Weimarer Republik sehr bekannter Ökonom, habe in der Zeit der großen Inflation in den zwanziger Jahren sein Haus verkauft, weil er annahm, so viel Geld bekomme er nie mehr dafür – mit dem Ergebnis, dass er sich für sein Geld nur Wochen später nicht mal mehr ein Brot kaufen konnte. Das war mir immer eine Warnung: Ökonomisches Wissen schützt nicht vor ökonomischer Dummheit.
Bärtig: Als Student in London.
Hatten Sie am Ende Ihres Studiums eine halbwegs klare Vorstellung von Ihrem späteren...