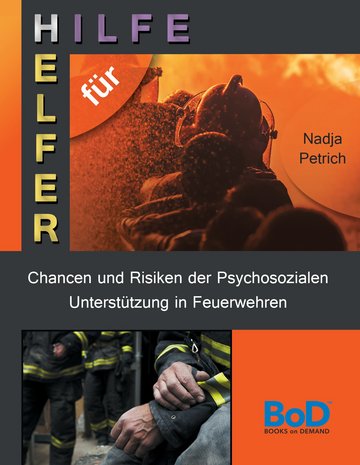2. Prävention
Kapitel 1 zeigt, dass Stress, Belastungen und deren Bewältigung in der Feuerwehrtätigkeit zentrale theoretische Grundlagen für die Betrachtung des PSU-Angebots durch Einsatzkräfte bilden. Aus den Themenbereichen ergeben sich einige Chancen und Risiken des Konzepts (vgl. 1.6).
Da es vorrangig entstanden ist, um Belastungen vorzubeugen und ihnen, sowie ihren gesundheitlichen, psychischen und physischen Folgen entgegenzuwirken (vgl. Einleitung), zählt es zu den Präventionsprogrammen (vgl. 2.1). Aus diesem Grund wird sich – ergänzend zu Kapitel 1 – mit dem Präventionsbegriff beschäftigt. Was ist darunter zu verstehen und welche für diese Arbeit relevanten Präventionsformen und -möglichkeiten gibt es in Feuerwehreinrichtungen? Daraus werden weitere Erkenntnisse in Bezug auf positive und negative Auswirkungen des PSU-Angebots von Einsatzkräften für Einsatzkräfte gewonnen.
2.1 Begriffsbestimmung und Präventionsarten
„Der Begriff „Prävention“ ist abgeleitet vom lateinischen Verb praevenire, welches mit „zuvorkommen“ übersetzt werden kann. Prävention wird der klassischen pathogenetischen Sichtweise in der Medizin zugeordnet, in der von einer Erkrankung auf die sie verursachenden bzw. begünstigenden Faktoren (Risikofaktoren) rekurriert wird.“ (Oster, 2009, S. 312) Überträgt man diese Definition auf den Themenbereich „Stress in der Feuerwehrtätigkeit“ meint Prävention, dass gezielt an den Auslösern und Ursachen der Belastung angesetzt wird, um ihr entgegenzuwirken oder sie zu verhindern.
Prävention lässt sich nach dem Zielpunkt des Handelns in Verhältnis- und Verhaltensprävention und nach dem Eingriffszeitpunkt in primäre, sekundäre bzw. tertiäre Prävention unterteilen (vgl. Galuske, 2007, S. 295 f.).
Verhaltensprävention setzt am menschlichen Verhalten an, um riskante Verhaltensweisen zu verhindern, zu verringern oder positiv zu verändern. Verhältnisprävention zielt dagegen auf eine Veränderung von Strukturen oder Verhältnissen in der Lebensumwelt ab. Es wird versucht Gesundheitsgefahren einzudämmen (vgl. Oster, 2009, S. 312 und Michel, 20045, S. 58). Ist eine Maßnahme also z.B. speziell auf das Verhalten einer Person oder Einsatzkraft ausgerichtet, fällt sie in den Bereich der Verhaltensprävention. Setzt sie dagegen direkt an den organisatorischen Abläufen einer Feuerwehreinrichtung an, handelt es sich um Verhältnisprävention.
Primäre Prävention schließt alle Maßnahmen ein, die einsetzten, bevor sich eine Situation ereignet. Sekundärprävention dagegen umfasst eine frühzeitige Intervention und frühzeitige Diagnose (vgl. Lasogga et al., 20122, S. 118). Die Tertiärprävention zielt, „(…) wenn jemand schon bestimmte Folgen zeigte (…)“ (ebd.), auf die Verhinderung weiterer Komplikationen, Rückfälle oder chronischer Verläufe ab (vgl. Michel, 20045, S. 58).
„Jede Intervention, egal ob sie vor Ort oder nach einem Einsatz stattgefunden hat, stellt eine Prävention dar. Es wird [im Folgenden] dem zeitlichen Ablauf entsprechend von (primärer) Prävention, Intervention (während eines Einsatzes) und Nachsorge (nach einem Einsatz) gesprochen.“ (Lasogga, 20122, S. 118)
2.2 Präventionsmöglichkeiten in Feuerwehreinrichtungen
Primärprävention kann Maßnahmen im Zusammenhang mit der Personalauswahl umfassen. Hier kann auf Charaktereigenschaften und Kompetenzen geachtet werden, die für den Umgang mit belastenden Situationen notwendig sind (vgl. Krampl, 2007, S. 97). Beispielsweise: Offenheit, ein angemessenes Selbstbewusstsein, Toleranz, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, körperliche Belastbarkeit, sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit. Es ist wichtig darauf zu achten, Personen mit eher ungünstigen Persönlichkeitsmerkmalen nicht zur Tätigkeit zuzulassen. Zu ihnen zählen unter anderem: Egoismus, geringes Selbstvertrauen, ausgeprägte Ängstlichkeit und Nervosität.
Darüber haben Schulungen und Fortbildungen mit folgenden Inhalten hohe präventive Qualität: Stress und Stressbewältigung, Belastungsfolgen und -reaktionen, Kommunikationstechniken, Einsatzvor- und -nachbereitung, Möglichkeiten der Stressprävention (vgl. Lasogga et al., 20122, S. 120 f.), der Umgang mit traumatisierten Personen (vgl. Krampl, 2007, S. 98) etc. Von Bedeutung ist, dass die Schulungen von qualifizierten, gut ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt werden (vgl. Lasogga et al., 20122, S. 120 ff.). Außerdem hat es sich bewährt, bei bestimmten Themen Einsatzkräfte in den Unterricht einzubeziehen, die aus ihrem Erfahrungsschatz berichten können. Das garantiert eine fachgerechte Verknüpfung von Theorie und Praxis. Vor allem ist es wichtig, Helfern in Schulungen zu vermitteln (vgl. Krampl, 2007, S. 98), „(…), dass Traumareaktionen eine „normale“ Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis sind und [,] dass die Aufarbeitung eines (…) belastenden Ereignisses mit einer Betreuung besser gelingt.“ (ebd.) Es muss verdeutlicht werden, dass es sich bei der Inanspruchnahme von Unterstützung nicht um Inkompetenz oder emotionale Instabilität und Weichheit sondern um einen Schritt in Richtung der Belastungsbewältigung handelt. Nicht selten nämlich fehlt den Unterstützungsangeboten die Akzeptanz durch potentielle Nutzer10. Sie fürchten, dass die Inanspruchnahme als Schwäche ausgelegt werden könnte und treten den Unterstützungsprogrammen aus diesem Grund und aus Gründen, die in den Symptomen von Belastungsfolgen (z.B. Sozialer Rückzug oder Vermeidung) liegen, nicht offen gegenüber (vgl. Krampl, 2007, S. 98). Bereits Punkt 1.5 zeigt, dass Beschimpfungen oder Beleidigungen als „Weichei“ durchaus vorkommen können. Ergänzend ist es wichtig, in Fortbildungen, bei Veranstaltungen und in Einsatzvor- und nachbesprechungen regelmäßig den Sinn und Wert der Feuerwehrtätigkeit zu verdeutlichen. Das kann helfen, Belastungen auch bei großen Anforderungen mehr in den Hintergrund rücken zu lassen (vgl. ebd., S. 99). Zu all diesen Präventionsmöglichkeiten kommen ergänzend die organisationsbezogenen Bewältigungsstrategien hinzu, die in 1.5: Tabelle 8 dargestellt werden.
In den Bereich der Intervention (während Einsätzen) fallen zum einen die kurzfristigen Bewältigungsstrategien und die speziellen Möglichkeiten für Einsatzkräfte aus 1.5: Tabelle 8. Sie können durch die Feuerwehrangehörigen selbst – während der Anfahrt zur Einsatzstelle (z.B. sich vor Augen führen, dass der Einsatz zeitlich begrenzt sein wird) oder während des Einsatzes (z.B. Wahrnehmungslenkung oder positive Selbstinstruktion) – durchgeführt werden (vgl. Lasogga et al., 20122, S. 133 ff.).
Außerdem können sich Kameraden in Einsatzsituationen gegenseitig unterstützen. Z.B., wenn sie erkennen, dass eine andere Person gestresst ist. Hilfreich ist in diesem Fall die Zuteilung einer konkreten Aufgabe. Wichtig ist, eine belastet wirkende Person unter keinen Umständen in der Einsatzsituation direkt auf ihr Befinden anzusprechen. Das kann als zusätzliche Belastung oder Störung empfunden werden. Auch kann eine Einsatzkraft andere Kameraden um Unterstützung bitten oder sich ablösen lassen (vgl. ebd., S. 139 ff.). „[Bei] (…) einem Helfer, der offensichtlich sehr gestresst ist, selbst aber nicht um eine Ablösung ersucht, sollten Führungskräfte (…) [diese] veranlassen (…).“ (ebd., S. 141) Sie sind sogar dazu verpflichtet, für rechtzeitige Ablösungen zu sorgen. Überbesorgtes Verhalten sollte vermieden werden, da es sich negativ auswirken kann. Wird ein Helfer ohne ersichtlichen Grund aus einem Einsatz abgezogen, kann das bewirken, dass er sich ungerecht behandelt, bevormundet bzw. so fühlt, als hätte er trotz seines Willens zu helfen nicht helfen dürfen (vgl. ebd., S. 142).
Die Nachsorge im Anschluss an einen Einsatz umfasst – ebenso wie die Primärprävention und die Intervention – einige Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen, die bereits in Punkt 1.5: Tabelle 8 angesprochen werden. So kann eine Person selbst nach einem belastenden Einsatzerlebnis für ihre Entlastung sorgen (vgl. Karutz, 2012, S. 4). Beispielsweise indem sie ihre Freizeit mit erholsamen Aktivitäten gestaltet oder Gespräche mit Personen aus dem sozialen Umfeld sucht (vgl. ebd. und 1.5). Auf institutioneller Ebene zählen Supervision, Besprechungen und Betreuungen durch Einzel- oder Gruppengespräche im Anschluss an Einsätze zur Nachsorge (vgl. Lasogga, 20122, S. 143). Die Betreuung wird häufig durch Peers (vgl. 4.4) angeboten.
Folgende Ziele werden verfolgt:
- Information über psychische Belastungssymptome, -phänomene und -verläufe
- Unterstützung bei der Belastungsverarbeitung (vgl. Reiprich-Meurer et al., 2007, S. 2)
- Strukturierte Aufarbeitung des Erlebten, die den Betroffenen die Integration ihrer eigenen Gedanken und Gefühle in die Psyche...