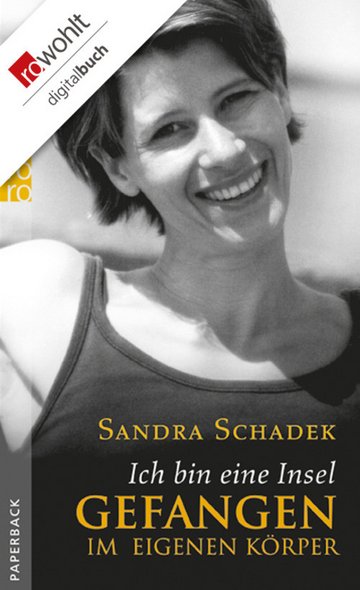2001
Loslassen und Annehmen
Inzwischen hatte ich schon über ein Jahr diese blöden Symptome, und nach und nach kamen immer mehr dazu, schleichend zwar, aber stetig. Meine Hände wurden ungeschickter, die Arme immer schwächer, und die Muskeln zuckten Tag und Nacht. Das Sprechen fiel mir zunehmend schwerer, meine Aussprache wurde undeutlicher, und ich musste öfter etwas zweimal sagen. Auch mein Gang war deutlich wackliger, ich fiel oft hin und holte mir am ganzen Körper blaue Flecken und Beulen. Nach der anfänglichen Diagnose «Verdacht auf ALS» bestätigten mir die Ärzte der ALS-Ambulanz in Bochum jetzt eine «wahrscheinliche ALS». Na super!
Es gibt bisher leider noch keine Untersuchungen, mit denen eine ALS nachgewiesen werden kann, daher handelt es sich stets um eine sogenannte klinische Diagnose. Sie wird bei typischem Untersuchungsbefund und Verlauf nach Ausschluss anderer ähnlicher Erkrankungen gestellt.
Ich wollte meine bisherige Taktik beibehalten und versuchte die ALS als einen Teil meines neuen Lebens anzunehmen und sie dennoch nicht zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen. Weil insbesondere Stresssituationen und sowohl körperliche als auch seelische Überanstrengung den Verlauf der Krankheit enorm beschleunigen können, musste ich mein Leben komplett umkrempeln. Mittlerweile empfand ich sogar Situationen als stressig, die ich früher vermutlich nicht mal bewusst wahrgenommen hätte. Ich vermied jede Art von negativem Stress, soweit es eben möglich war. Darunter fielen letztlich jede Form von Öffentlichkeit, fremde Menschen, unbekannte Orte oder Räumlichkeiten sowie jeder noch so geringe Zeitdruck.
Ich fand es furchtbar, aufgrund meines körperlichen Zustands andauernd unfreiwillig im Mittelpunkt zu stehen. Es machte mir Angst, irgendwo hinzumüssen, ohne zu wissen, ob zum Beispiel die Toiletten ohne schwer überwindbare Hindernisse wie Treppen überhaupt zu erreichen waren. Wenn ich mich nicht in Ruhe auf einen Termin vorbereiten konnte und Stefan womöglich genervt auf mich warten musste, dann spielte mein Körper komplett verrückt, und nichts ging mehr.
Diese vollkommen ungewohnten Reaktionen und Empfindungen verunsicherten mich in den nächsten Wochen zusätzlich, und ich versuchte unbewusst, solche Situationen ganz zu vermeiden. Das bedeutete, dass ich mich immer mehr in die halbwegs sichere Umgebung unserer eigenen vier Wände zurückzog. Hier konnte ich nach wie vor selbständig zur Toilette gehen, niemand redete mich unvorbereitet an oder begaffte mich, und ich bewegte mich in meinem eigenen Tempo. Stefan war nun häufiger ohne mich am Wochenende unterwegs, traf sich mit Freunden zum Essen oder ging auf Partys. Ich fing an, mich mehr und mehr zu verstecken, und musste feststellen, dass ich die ALS zwar vor mir selbst annehmen konnte, dass es jedoch ungleich schwerer war, dies auch vor anderen zu tun.
Ich wollte nicht anders, sondern normal sein und schämte mich, dass ich es offensichtlich nicht mehr war. Auch wenn meine Erkrankung noch nicht für jedermann offen – etwa in Form eines Rollstuhls – zu sehen war, konnte sie doch jeder hören. Häufig erschrak ich sogar, wenn ich meine gequälte Tonlage hörte, und bald hatte ich selbst zu Hause Angst, sobald das Telefon klingelte oder jemand an der Haustür war. Wenn ich irgendwo anrufen musste, schlug mir das Herz bis zum Hals, und ich übte vorher meinen Text, um am Ende wieder nur mehr oder weniger undeutliche Worte hervorzubringen.
Wenn ich doch mal mit Stefan vor die Tür ging, sah ich den Menschen, die uns entgegenkamen, direkt in die Augen, damit sie an meinem klaren Blick erkennen konnten, dass ich trotz meiner lallenden Stimme nicht betrunken war. Ich betete, dass mich keine Verkäuferin ansprach, ob sie mir helfen könne, oder dass mich auf der Straße kein Fremder nach dem Weg fragte. In Cafés und Restaurants versuchte ich aus lauter Scham möglichst leise zu sprechen.
Natürlich ging der Schuss meistens nach hinten los, denn je leiser ich sprach, desto genauer schienen die Leute hinzuhören. Hatte ich erst mal ihre Aufmerksamkeit erregt, ließen sie mich oft nicht mehr aus den Augen. Grauenhaft! Also schwieg ich häufiger und versuchte wenigstens dabei so normal wie möglich auszusehen. Selbst ein Brot beim Bäcker zu kaufen, kostete mich ungemeine Überwindung, und nicht selten verließ ich den Laden tatenlos, ehe ich mich irgendwann traute, mein «Wollhornbrod» zu bestellen. Im Nachhinein frage ich mich, was damals tatsächlich auffälliger war: die Sprachstörung an sich oder mein sonderbares Verhalten, um ja nicht aufzufallen?
Auch im Freundeskreis wurde es schwieriger, Gespräche ohne Stefan als Dolmetscher zu führen, was vor allem an meiner Aufregung und den damit verbundenen Emotionen lag. Konnte ich, wenn ich entspannt war, eigentlich noch einigermaßen verständlich reden, war bei Nervosität, Angst, Wut oder Traurigkeit alles vorbei. Wenn ich also etwas sagen wollte, musste ich mir ganz genau überlegen, wie ich meine Meinung in ein, zwei Sätzen so zusammenfassen konnte, damit dennoch alle mitbekamen, worum es mir ging.
Meistens war dieser Vorgang viel zu kompliziert, und ich brachte am Ende nichts als ein «Mhm» heraus. Innerlich diskutierte ich dagegen jedes Mal lebhaft mit. Am schlimmsten war, dass ich auch in Situationen, in denen Erklärungen sehr wichtig gewesen wären, nicht ein einziges Wort vernünftig über die Lippen brachte. Dabei schwirrten in meinem Kopf tausend Gedanken, unendlich viele fertige Sätze und flehende Bitten herum. Egal ob im Streit, beim Weinen oder nach einem Sturz, manchmal dachte ich, ich müsste nur laut genug denken, dann könnten die anderen mich schon hören und verstehen, was ich mitteilen will. Aber meistens blieben nur ein Höllenlärm in meinem Kopf, Hilflosigkeit und Verzweiflung zurück.
Meine Welt und damit der Radius, in dem ich mich bewegen, die Möglichkeiten, die ich wahrnehmen, die Dinge, die ich noch ohne Hilfe erledigen konnte, hatten sich enorm verringert. In meinem Mikrokosmos bewegten sich hauptsächlich Menschen, die ich gut kannte, die von meiner Erkrankung wussten und entsprechend Rücksicht auf mich nahmen. Mit dem wahren, wirklichen Leben hatte das nicht mehr viel zu tun.
Meine wichtigsten Bezugspersonen waren Stefan und seine Mutter Agnes. Sie half, wo sie nur konnte, und kümmerte sich um mich, wenn mein Freund unterwegs war. Sie ging einkaufen, machte sauber, bepflanzte unsere Terrasse, kochte Essen oder fuhr mich zur Therapie. Agnes und ich verstanden uns super, wir hatten immer viel Spaß zusammen und giggelten manchmal wie die Hühner. Natürlich erlebte sie auch die weniger schönen Momente mit, etwa wenn ich weinte oder einfach mal einen schlechten Tag hatte. Aber sie war immer für mich da und hörte zu. Eigentlich war Agnes eine Freundin, vielleicht sogar die einzige, die ich in Dortmund wirklich hatte.
Meine Freundinnen lebten in Wolfsburg oder Hamburg, und aufgrund meiner Probleme mit der Stimme waren lange Telefonate nicht mehr möglich. Wir sahen uns also nur, wenn ich meine Eltern in Wolfsburg besuchte oder wenn sie nach Dortmund kamen. Genauso war es bei meinen Eltern und meiner Schwester. Dadurch, dass sie alle meinen Alltag nicht mitbekamen und die Höhen und Tiefen nur aus der Entfernung miterlebten, blieb für sie die ALS sehr abstrakt und war in ihrem ganzen Ausmaß überhaupt nicht zu begreifen. Selbstverständlich sahen sie die Veränderungen und Verschlechterungen, doch sie wussten nicht, wie unendlich schwer der Weg bis dahin war.
Stefan war zudem der Meinung, meine Familie wolle den Tatsachen nicht ins Auge sehen, was immer öfter zu Auseinandersetzungen führte. Es war jedoch schwierig für meine Eltern, denn sie bekamen die Informationen nur häppchenweise und aus zweiter Hand. Sie konnten zwar die Unterlagen oder im Internet über die ALS lesen, aber ich glaube, diese Erkrankung kann man – wenn überhaupt – nur begreifen und verstehen, wenn man sie intensiv erlebt. Nicht mal ich konnte mir im Anfangsstadium richtig vorstellen, was es heißt, hilflos und abhängig zu sein.
Als meine Eltern im März für ein Wochenende zu Besuch bei uns waren, kam plötzlich das Thema Pflege oder vielmehr Pflegekraft auf. Während Stefan und die beiden fröhlich diskutierten, wann, wie oft und wobei mir diese Person helfen könnte, arbeitete ich innerlich ebenso gutgelaunt an meiner Mauer der Ablehnung. Pflege? Das ist vielleicht etwas für alte oder bettlägerige Menschen, aber doch nicht für mich!, dachte ich nur. Die Vorstellung, dass eine wildfremde Person in meine Privat- und Intimsphäre eindrang, dass ständig jemand in meiner Nähe war, den ich sozusagen unterhalten und mit irgendetwas...